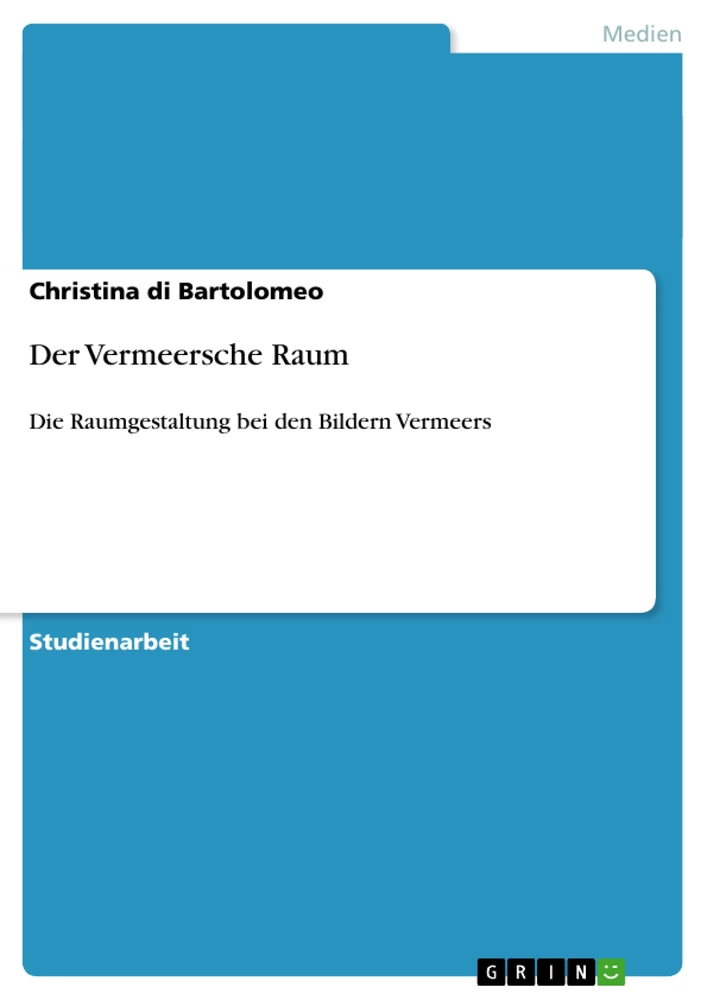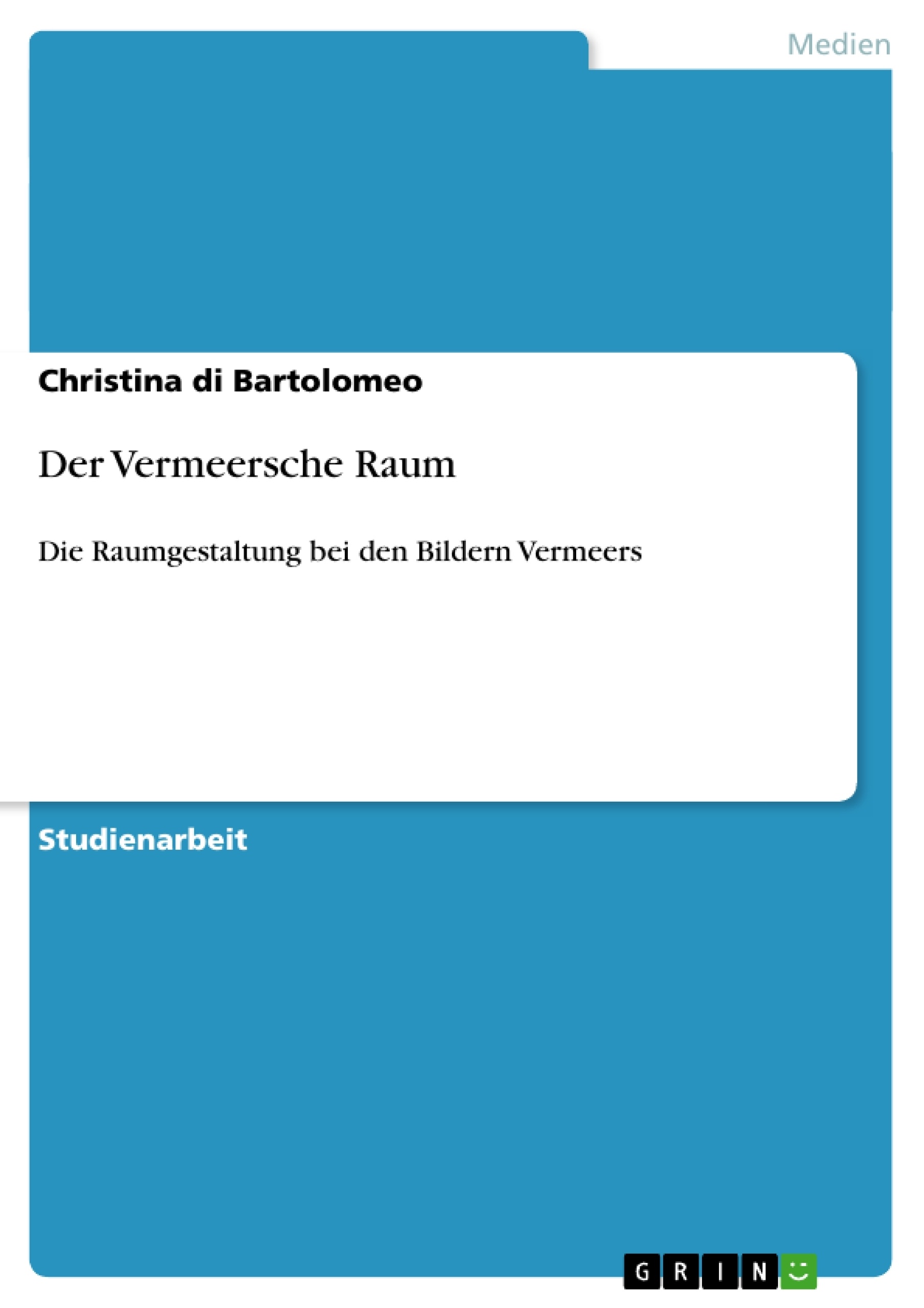Die Gattung des Genre erlebt ihren Höhepunkt in den Niederlanden des 17. Jahrhunderts, nach den gewonnen Kämpfen der Holländer gegen die Spanier, welche die Unabhängigkeit der Niederlande zufolge hatte.1 Johannes Vermeer ist der heutzutage bekannteste Vertreter der holländischen Genremalerei der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Obwohl nur wenige seiner Gemälde erhalten sind und er bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts fast vollständig vergessen wurd, wird er, seit seiner Wiederentdeckung durch den Kunstkritiker Théophile Thoré im Jahre 1863, als der virtuoseste Vertreter der Genremalerei seiner Zeit angesehen. Ein Grund hierfür ist vermutlich seine innovative und einzigartige Methode, das Licht in seinen Bildern darzustellen. Dabei gehört das Licht, genauso wie der von Vermeer gewählte Bildausschnitt und die im Raum dargestellten Gegenstände und Figuren, seiner neuerungsbewussten Methode der Raumgestaltung an.
Seine Art, den Raum darzustellen, einzuteilen und abzugrenzen ist einzigartig. Das Zusammenspiel der von ihm benutzten Effekte hat die Bezeichnungen „Vermeerscher Ort“ oder auch „Struktur Vermeer“ geprägt. Diese Begriffe beziehen sich auf die verschiedenen Vorgehensweisen, die Vermeer in seinen Genrebildern zur Darstellung von Interieurs verwendet, und setzen sich aus verschiedenen, immer wiederkehrenden, Elementen zusammen. In den unterschiedlichen Schaffensphasen sind die für ihn typischen Kennzeichen mal mehr und mal weniger intensiv ausgeprägt, aber die meisten Räume in seinen Genreszenen lassen sich doch auf einen gemeinsamen Nenner bringen. Die folgende Arbeit wird sich mit Vermeers Bemühen befassen, in seinen Bildern den für seine Genrebilder so typischen Intimraum zu gestalten auseinandersetzen und sich mit seiner Gestaltung eines, dem Betrachter verschlossenen und sich dennoch ihm erschließenden Bereiches auseinander zu setzen. Dabei werden vor allem die verschiedenen Möglichkeiten der Raumeinteilung, die mittels diverser Gegenstände und Figuren erzielt wird, analysiert. Ein weiterer wichtiger Punkt wird die Entwicklung der Perspektive in Vermeers Genremalerei sein. Als Ansatz für die Analyse dient die Untersuchung einiger Bilder Vermeers. Hierbei bezieht die Arbeit sich vor allem auf seine frühen Werke, bei denen die Entwicklung der Raumgestaltung am ausgeprägtesten ist.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Delft und die Genremalerei im 17. Jahrhundert
- III. Die Genre-Malerei Johannes Vermeers
- IV. Die Komposition des Vermeerschen Ortes in seinen frühen Interieurszenen
- IV.2 Die Briefleserin am offenen Fenster
- IV.3 Offizier mit lachender Frau
- IV.4 Merkmale der frühen Werke anhand der vorhergegangenen Bildanalysen
- V. Die Küchenmagd als Fixpunkt im Œuvre Vermeers
- VI. Der Vermeersche Raum nach der Küchenmagd
- VI.1 Der Liebesbrief
- VII. Definition des Vermeerschen Raumes
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung der Raumgestaltung in den Genregemälden Johannes Vermeers, insbesondere in seinen frühen Werken. Der Fokus liegt auf der Analyse der kompositorischen Elemente, die Vermeers einzigartige Darstellung des Raumes prägen – den sogenannten „Vermeerschen Ort“. Die Arbeit beleuchtet Vermeers innovative Herangehensweise an Licht, Perspektive und die Anordnung von Gegenständen und Figuren, um eine intime und dennoch dem Betrachter zugängliche Atmosphäre zu schaffen.
- Entwicklung der Raumgestaltung in Vermeers Genremalerei
- Analyse der kompositorischen Elemente des „Vermeerschen Ortes“
- Rolle von Licht, Perspektive und Objektanordnung in Vermeers Bildern
- Vergleich mit zeitgenössischen Genremalern in Delft
- Vermeers einzigartige Stilfindung und Abkehr von moralisierenden Erzählungen
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Genremalerei im 17. Jahrhundert ein, positioniert Johannes Vermeer als herausragenden Vertreter dieser Gattung und hebt seine innovative Raumgestaltung als zentralen Untersuchungsgegenstand hervor. Sie skizziert die Zielsetzung der Arbeit, die auf der Analyse der kompositorischen Elemente in Vermeers frühen Werken beruht, um seine einzigartige Art der Raumdarstellung zu verstehen. Besondere Aufmerksamkeit wird der Entwicklung der Perspektive und der Anordnung von Gegenständen und Figuren gewidmet, um die spezifische Atmosphäre in seinen Gemälden zu ergründen.
II. Delft und die Genremalerei im 17. Jahrhundert: Dieses Kapitel beschreibt Delft als bedeutendes künstlerisches Zentrum des 17. Jahrhunderts und beleuchtet die Entwicklung der Genremalerei in diesem Kontext. Es stellt Anthonie Palamadesz als wichtigen Vorläufer Vermeers vor, dessen Werk sich durch flache, weitläufige Räume auszeichnet, im Gegensatz zu Vermeers späterer innovativer Raumgestaltung. Der Tod von Willem II. und die daraus resultierende Veränderung der politischen Lage in Delft führten zu einem Wandel in der künstlerischen Produktion, mit Fokus auf naturalistischer Landschaftsmalerei und häuslichen Szenen, wodurch Delft zu einem Zentrum der Genremalerei aufstieg. Der Einfluss von Pieter de Hooch auf Vermeers Werk wird hier bereits angedeutet.
III. Die Genre-Malerei Johannes Vermeers: Dieses Kapitel bietet einen biografischen Überblick über Johannes Vermeer und seine künstlerische Entwicklung. Es beschreibt seine spärliche Biografie und seine relativ geringe Produktionsrate, betont aber die hohe Qualität und den Einfluss seiner Werke. Es hebt die Entwicklung seines Stils hervor: von frühen, großformatigen Bildern mit religiösen und mythologischen Motiven hin zu seinen charakteristischen, intimen Interieurszenen. Die „Küchenmagd“ wird als Wendepunkt in Vermeers Werk genannt, markierend den Übergang zu einem reduzierten, aber ausdrucksstarken Stil, der durch die präzise Anordnung von Objekten und die meisterhafte Lichtführung gekennzeichnet ist. Das Kapitel diskutiert auch Vermeers unverwechselbare Fähigkeit, Mehrdeutigkeit und Offenheit in seinen Bildern zu erzeugen, im Gegensatz zu den oft moralisierenden Tendenzen der zeitgenössischen Genremalerei.
Schlüsselwörter
Johannes Vermeer, Genremalerei, 17. Jahrhundert, Delft, Raumgestaltung, Komposition, Perspektive, Licht, „Vermeerscher Ort“, Interieur, Bildanalyse, Pieter de Hooch, Anthonie Palamadesz.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse der Raumgestaltung in den Genregemälden Johannes Vermeers
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Entwicklung der Raumgestaltung in den Genregemälden des niederländischen Malers Johannes Vermeer, insbesondere in seinen frühen Werken. Der Fokus liegt auf der Untersuchung der kompositorischen Elemente, die Vermeers einzigartige Darstellung des Raumes – den „Vermeerschen Ort“ – prägen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung der Raumgestaltung in Vermeers Genremalerei, die Analyse der kompositorischen Elemente des „Vermeerschen Ortes“, die Rolle von Licht, Perspektive und Objektanordnung in seinen Bildern, einen Vergleich mit zeitgenössischen Genremalern in Delft und Vermeers einzigartige Stilfindung und Abkehr von moralisierenden Erzählungen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung, Delft und die Genremalerei im 17. Jahrhundert, Die Genremalerei Johannes Vermeers, Die Komposition des Vermeerschen Ortes in seinen frühen Interieurszenen (inkl. Einzelanalysen von Bildern), Die Küchenmagd als Fixpunkt im Œuvre Vermeers, Der Vermeersche Raum nach der Küchenmagd und Definition des Vermeerschen Raumes.
Welche konkreten Bilder werden analysiert?
Die Arbeit analysiert unter anderem die Bilder „Die Briefleserin am offenen Fenster“ und „Offizier mit lachender Frau“ im Detail, um die Merkmale der frühen Werke Vermeers zu ermitteln. „Der Liebesbrief“ wird ebenfalls im Kontext der Entwicklung des „Vermeerschen Raumes“ behandelt. Die „Küchenmagd“ wird als Wendepunkt in Vermeers Werk hervorgehoben.
Welche Künstler werden im Vergleich zu Vermeer betrachtet?
Die Arbeit vergleicht Vermeers Werk mit dem von Anthonie Palamadesz und deutet den Einfluss von Pieter de Hooch an. Palamadesz wird als wichtiger Vorläufer vorgestellt, dessen Raumdarstellung sich von Vermeers späterer, innovativer Gestaltung unterscheidet.
Wie wird der „Vermeersche Ort“ definiert?
Der „Vermeersche Ort“ wird im Laufe der Arbeit durch die Analyse der kompositorischen Elemente (Licht, Perspektive, Anordnung von Gegenständen und Figuren) in Vermeers Bildern definiert. Es wird untersucht, wie Vermeer durch diese Elemente eine intime und dennoch dem Betrachter zugängliche Atmosphäre schafft.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit kommt zu Schlussfolgerungen über Vermeers einzigartige Art der Raumdarstellung, seine innovative Herangehensweise an Licht und Perspektive und seine Abkehr von moralisierenden Erzählungen in der Genremalerei. Die genaue Definition des „Vermeerschen Ortes“ wird durch die Kapitel über die Bildanalysen und die zusammenfassende Definition im letzten Kapitel geliefert.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren diese Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Johannes Vermeer, Genremalerei, 17. Jahrhundert, Delft, Raumgestaltung, Komposition, Perspektive, Licht, „Vermeerscher Ort“, Interieur, Bildanalyse, Pieter de Hooch, Anthonie Palamadesz.
- Quote paper
- Christina di Bartolomeo (Author), 2004, Der Vermeersche Raum, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/39373