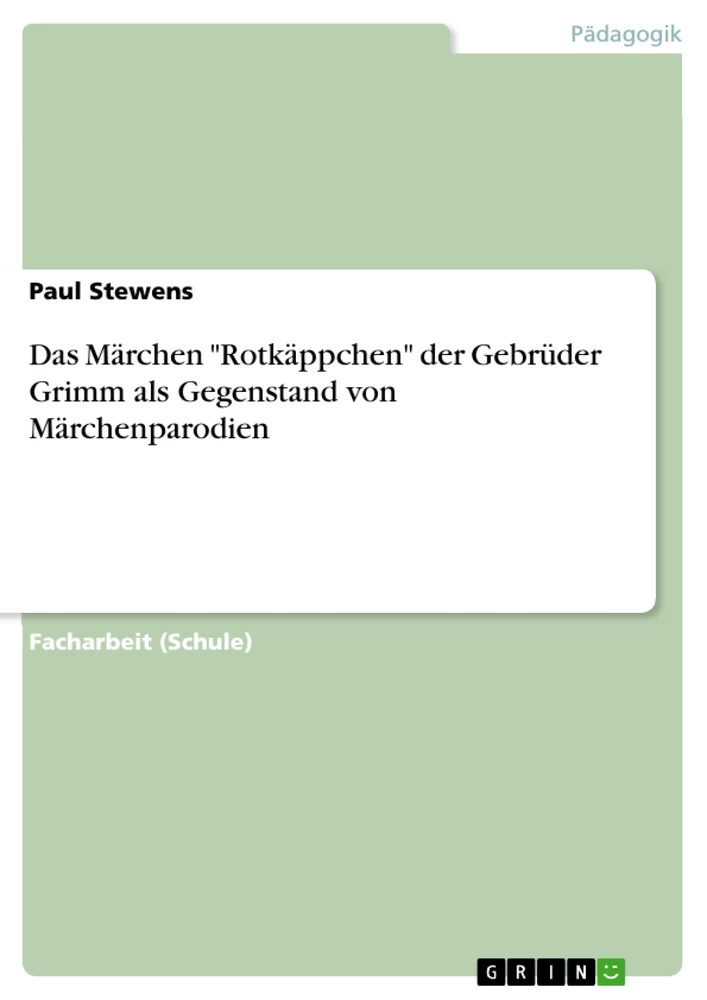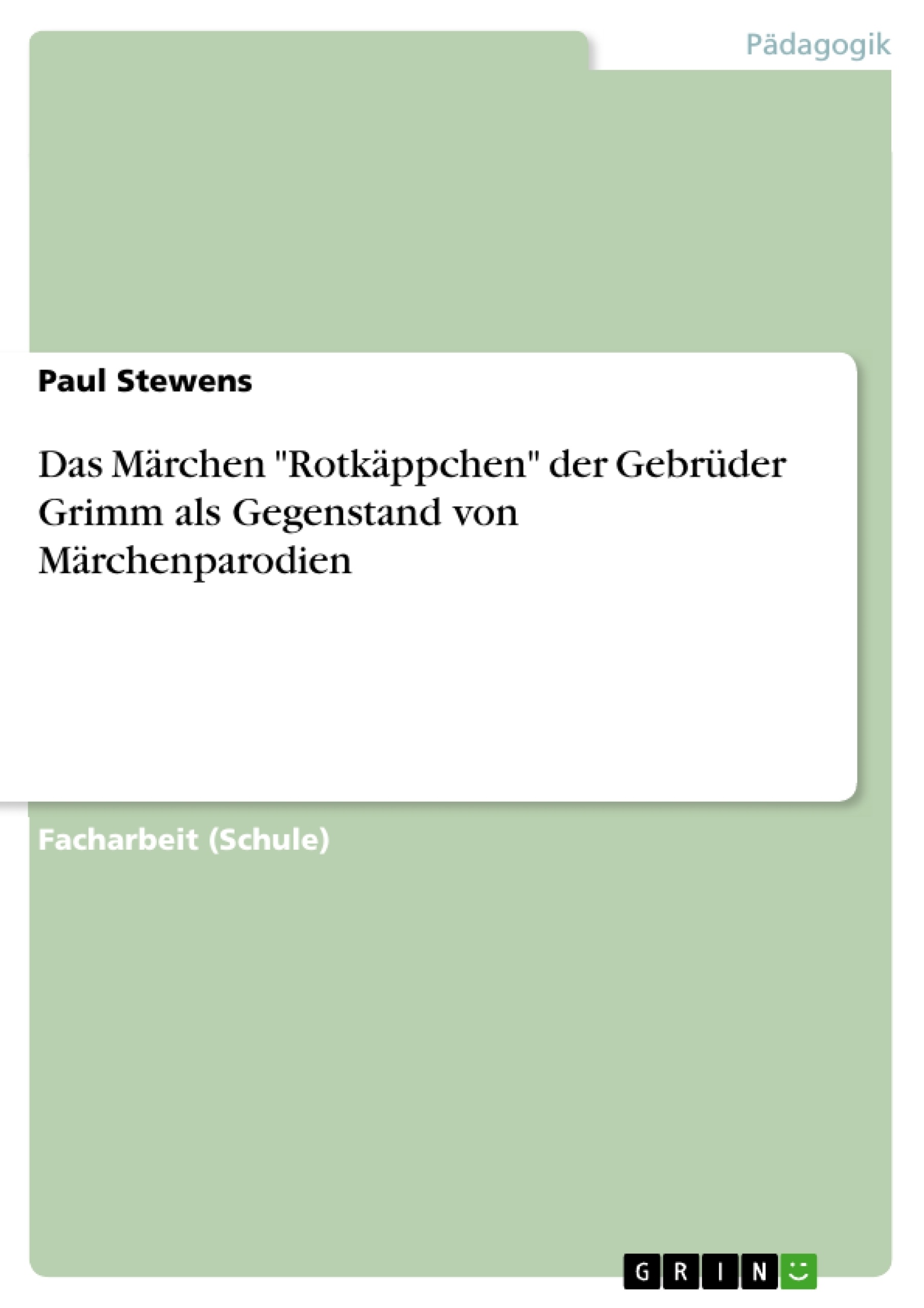Diese Arbeit hat das bekannte Märchen "Rotkäppchen" in der Fassung der Gebrüder Grimm zum Gegenstand. In einem ersten Schritt werden gattungstypische Merkmale des Volksmärchens am Beispiel von "Rotkäppchen" aufgezeigt und im Folgenden verschiedene Texte untersucht, die zum einen die Sprache und zum anderen den Inhalt von "Rotkäppchen" zum Gegenstand ihres parodistischen Ansatzes machen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Rotkäppchen als Volksmärchen
- 2.1 Handlung und Aufbau
- 2.1.1 Rotkäppchen als Kettenmärchen
- 2.1.2 Schema „Bewährungsprobe“
- 2.2 Sprache
- 2.2.1 Formelhaftigkeit
- 2.2.2 Satzbau
- 2.3 Abgrenzung vom Kunstmärchen
- 2.1 Handlung und Aufbau
- 3 Analyse von Parodien auf Rotkäppchen
- 3.1 Sprachliche Parodien auf Rotkäppchen
- 3.1.1 Rotkäppchen auf Amtsdeutsch: „Rotkäppchen, im amtlichen Sprachgut beinhaltet“ von Thaddäus Troll
- 3.1.1.1 Einordnung
- 3.1.1.2 Sprachliche Mittel
- 3.1.1.3 Interpretation
- 3.1.2 Rotkäppchen im Mathematik-Jargon: „Das Märchen Rotkäppchen aus der Sicht eines Mathematikers“ von Friedrich Wille
- 3.1.2.1 Einordnung
- 3.1.2.2 Inhaltliche Gestaltung
- 3.1.2.3 Sprachliche Mittel
- 3.1.3 Vergleich der beiden Texte
- 3.1.1 Rotkäppchen auf Amtsdeutsch: „Rotkäppchen, im amtlichen Sprachgut beinhaltet“ von Thaddäus Troll
- 3.2 Parodien auf das Motiv von Rotkäppchen
- 3.2.1 Ein modernes Rotkäppchen: „Das kleine Mädchen und der Wolf“ von James Thurber
- 3.2.1.1 Einordnung
- 3.2.1.2 Sprachliche Mittel
- 3.2.1.3 Inhaltliche Gestaltung
- 3.2.2 Rotkäppchen als Propaganda: „Little Red Riding Hood (Has a Gun)“ von Amelia Hamilton
- 3.2.2.1 Einordnung
- 3.2.2.2 Gesellschaftlicher Hintergrund
- 3.2.2.3 Sprachliche Mittel
- 3.2.2.4 Inhaltliche Gestaltung
- 3.2.3 Vergleich der beiden Texte
- 3.2.1 Ein modernes Rotkäppchen: „Das kleine Mädchen und der Wolf“ von James Thurber
- 3.1 Sprachliche Parodien auf Rotkäppchen
- 4 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit analysiert ausgewählte Parodien des Märchens „Rotkäppchen“ der Gebrüder Grimm. Ziel ist es, die verschiedenen Ansätze und Methoden der Verfremdung aufzuzeigen und zu untersuchen, wie die charakteristischen Merkmale des Volksmärchens in den Parodien aufgegriffen und verändert werden. Die Arbeit beleuchtet dabei sowohl sprachliche als auch inhaltliche Aspekte der Parodien.
- Analyse der sprachlichen Mittel in den Parodien
- Untersuchung der inhaltlichen Veränderungen im Vergleich zum Originalmärchen
- Vergleich verschiedener Parodietypen
- Einordnung der Parodien in ihren jeweiligen Kontext
- Die Funktion der Parodie als Mittel der literarischen Auseinandersetzung mit dem Originalmärchen
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Märchenverfilmungen und -verfremdungen ein und begründet die Wahl von „Rotkäppchen“ als Untersuchungsgegenstand aufgrund seiner vielfältigen literarischen Adaptionen. Sie hebt die Bedeutung von Märchen als über Generationen hinweg beliebte Erzählungen hervor und zeigt die Entwicklung von Märchenadaptionen im Film auf, bevor sie die Arbeit an ausgewählten literarischen Parodien ankündigt.
2 Rotkäppchen als Volksmärchen: Dieses Kapitel untersucht die Merkmale des Volksmärchens am Beispiel von „Rotkäppchen“. Es analysiert den Aufbau des Märchens als Kettenmärchen, beschreibt seine einfache Handlungsstruktur und die sprachlichen Besonderheiten wie Formelhaftigkeit und Satzbau. Der Vergleich mit Kunstmärchen dient der Abgrenzung und einem tieferen Verständnis der Gattungsmerkmale.
3 Analyse von Parodien auf Rotkäppchen: Dieses Kapitel bildet den Kern der Arbeit und analysiert verschiedene Parodien von „Rotkäppchen“, wobei sowohl sprachliche als auch inhaltliche Aspekte betrachtet werden. Der Fokus liegt auf dem Vergleich der jeweiligen Herangehensweise an das Thema. Es werden unterschiedliche Strategien der Verfremdung aufgezeigt und interpretiert. Die Kapitel 3.1 und 3.2 bieten detaillierte Analysen der einzelnen Parodien, wobei auf sprachliche Mittel und inhaltliche Gestaltung eingegangen wird.
Schlüsselwörter
Rotkäppchen, Gebrüder Grimm, Volksmärchen, Parodie, Sprachliche Mittel, Inhaltliche Gestaltung, Märchenverfremdung, Literaturanalyse, Vergleichende Analyse.
Häufig gestellte Fragen (FAQs) zur Seminararbeit: Parodien auf Rotkäppchen
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit analysiert verschiedene Parodien des bekannten Märchens „Rotkäppchen“ der Brüder Grimm. Der Fokus liegt auf der Untersuchung der Methoden und Ansätze der Verfremdung des Originals und wie die charakteristischen Merkmale des Volksmärchens in den Parodien verändert und aufgegriffen werden. Sowohl sprachliche als auch inhaltliche Aspekte der Parodien werden beleuchtet.
Welche Parodien werden untersucht?
Die Arbeit untersucht mehrere Parodien von „Rotkäppchen“, die in zwei Gruppen unterteilt sind: Sprachliche Parodien (z.B. eine Version im Amtsdeutsch und eine im Mathematik-Jargon) und Parodien des Motivs (z.B. eine moderne Version und eine mit Propagandahintergrund). Konkret werden die Parodien von Thaddäus Troll ("Rotkäppchen, im amtlichen Sprachgut beinhaltet"), Friedrich Wille ("Das Märchen Rotkäppchen aus der Sicht eines Mathematikers"), James Thurber ("Das kleine Mädchen und der Wolf") und Amelia Hamilton ("Little Red Riding Hood (Has a Gun)") analysiert.
Welche Aspekte der Parodien werden analysiert?
Die Analyse konzentriert sich auf die sprachlichen Mittel (z.B. Formelhaftigkeit, Satzbau, spezifische Jargons) und die inhaltliche Gestaltung der Parodien im Vergleich zum Originalmärchen. Die Arbeit untersucht, wie die Parodien das Originalmärchen uminterpretieren und welche Effekte durch die Verfremdung erzielt werden.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: Eine Einleitung, ein Kapitel zur Analyse von „Rotkäppchen“ als Volksmärchen, ein Hauptkapitel mit der Analyse der ausgewählten Parodien (unterteilt in sprachliche und motivbezogene Parodien) und ein Fazit. Jedes Kapitel enthält eine Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die verschiedenen Strategien der Verfremdung in den Parodien aufzuzeigen und zu vergleichen. Sie untersucht, wie die charakteristischen Merkmale des Volksmärchens in den Parodien transformiert werden und welche Funktion die Parodie als literarisches Mittel der Auseinandersetzung mit dem Originalmärchen hat. Die Einordnung der Parodien in ihren jeweiligen Kontext ist ebenfalls ein wichtiges Ziel.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Rotkäppchen, Gebrüder Grimm, Volksmärchen, Parodie, Sprachliche Mittel, Inhaltliche Gestaltung, Märchenverfremdung, Literaturanalyse, Vergleichende Analyse.
Wie wird das Originalmärchen „Rotkäppchen“ in der Arbeit behandelt?
Das Kapitel 2 analysiert „Rotkäppchen“ als Volksmärchen. Es untersucht den Aufbau (als Kettenmärchen), die Handlungsstruktur und die sprachlichen Besonderheiten (Formelhaftigkeit, Satzbau). Ein Vergleich mit Kunstmärchen hilft, die Gattungsmerkmale besser zu verstehen und dient als Vergleichsgrundlage für die Analyse der Parodien.
Wie werden die verschiedenen Parodien verglichen?
Die Arbeit vergleicht die Parodien sowohl innerhalb der Gruppen (sprachliche Parodien untereinander, motivbezogene Parodien untereinander) als auch zwischen den Gruppen. Der Vergleich konzentriert sich auf die verwendeten sprachlichen Mittel, die inhaltlichen Veränderungen und die Gesamtstrategie der Verfremdung.
- Quote paper
- Paul Stewens (Author), 2016, Das Märchen "Rotkäppchen" der Gebrüder Grimm als Gegenstand von Märchenparodien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/393048