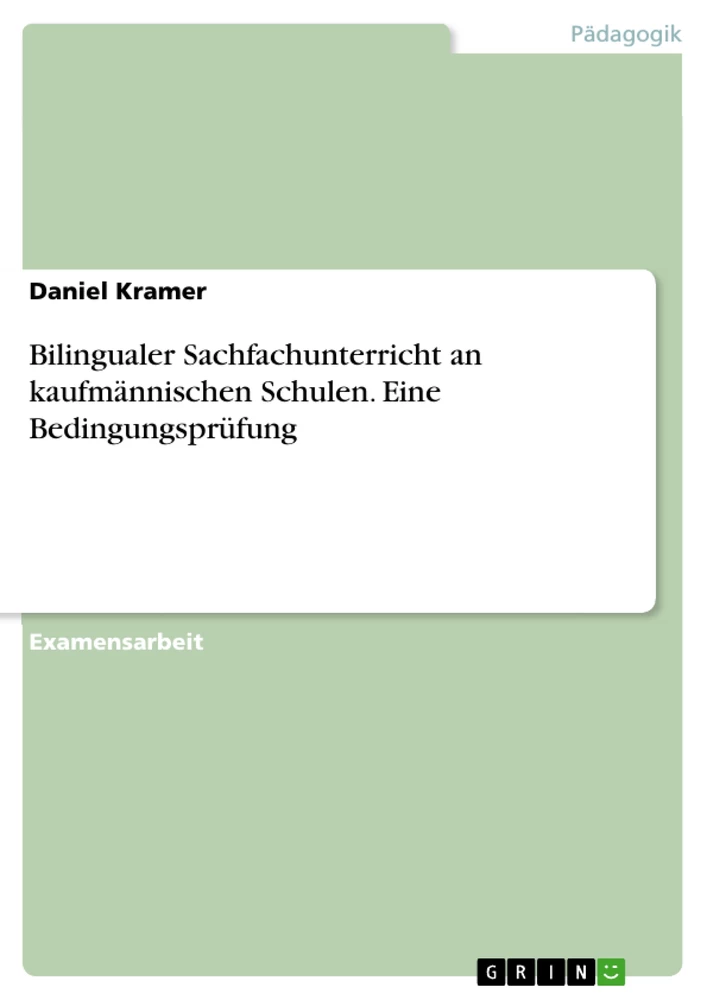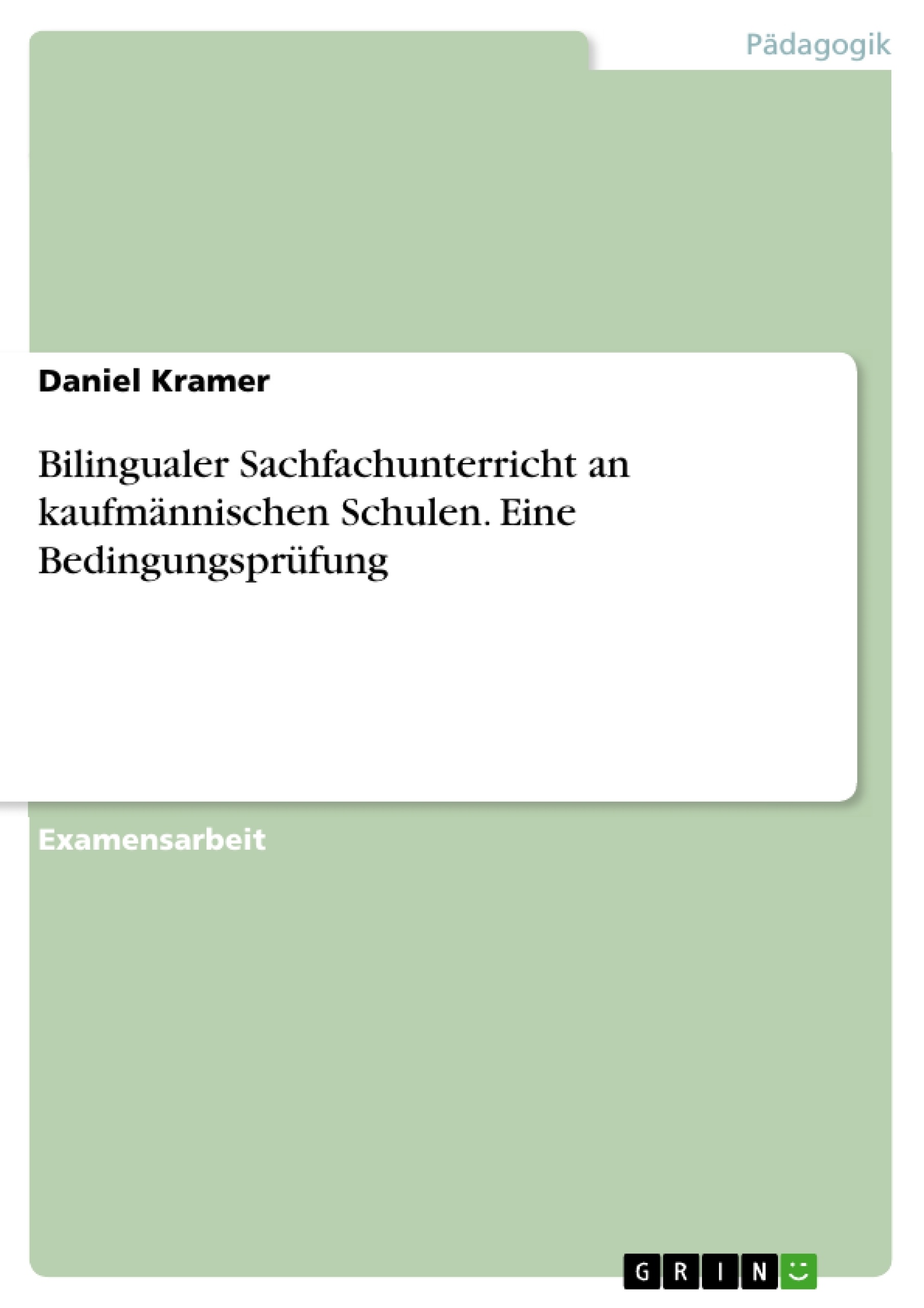In den letzten Jahren und Jahrzehnten ist die Forderung nach mehr und besseren Fremdsprachenqualifikationen für deutsche Berufsschüler immer lauter und immer dringender geworden, vor allem unter dem Schlagwort der Globalisierung. Hinter diesem vielzitierten Begriff verbergen sich so unterschiedliche Entwicklungen wie die Verschärfung des weltweiten Wettbewerbs um Kapitalzuflüsse und die harte Konkurrenz von weit auseinanderliegenden Standorten um Arbeitsplätze, aber auch der voranschreitende Abbau von Zoll- und Handelschranken innerhalb und außerhalb Europas und die gestiegenen Chancen für persönliche berufliche Mobilität. Sowohl für die volkswirtschaftliche als auch für die persönliche Wettbewerbsfähigkeit auf dem globalen Markt sind fremdsprachliche Kompetenzen entscheidend.
In der vorliegenden Arbeit wird untersucht, wie das an deutschen Schulen des allgemeinbildenden Schulwesens verbreitete Konzept des bilingualen Sachfachunterrichts auf kaufmännische Berufsschulen übertragen werden kann, um während der Berufsausbildung fremdsprachliche Kompetenzen zu fördern. Als zukünftiger Lehrer sowohl der Fremdsprache Englisch als auch der Fachrichtung Wirtschaft an dieser Schulform interessiert mich insbesondere die mögliche Verknüpfung meiner Fakulten im Sinne eines Content and Language Integrated Learning (CLIL), einer noch recht jungen Bezeichnung für die Verwendung von Fremdsprachen in Sachfächern. Die Leitfragen, die sich hier stellen, sind verschiedener Natur. So muss geklärt werden, ob das Konzept überhaupt anwendbar ist und in welcher Ausprägung, in welchem Umfang, mit welchen fachlichen Inhalten und mit Hilfe welcher Materialien es umgesetzt werden kann.
Neben der systematischen Analyse im Rahmen der einzelnen Kapitel habe ich diese Arbeit auch zum Anlass genommen, probeweise eine Unterrichtseinheit bilingual an einer kaufmännischen Berufsschule zu unterrichten. Bei dieser Stunde habe ich einen der in Kapitel fünf analysierten Texte als Unterrichts-material verwendet. Da diese Unterrichtseinheit nicht Grundlage und Gegenstand dieser Arbeit ist, sondern lediglich als Ergänzung zu betrachten ist, ist die Probestunde nur im Anhang 2 kurz dokumentiert. Es wird zwar an einigen Stellen in dieser Arbeit auf Parallelen zwischen theoretischer Darstellung und exemplarischer Umsetzung sowie auf Ergebnisse der Evaluation verwiesen, Schlussfolgerungen können jedoch auf Basis dieser Stichprobe kaum gezogen werden.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- ANFORDERUNGEN AN BERUFSBEZOGENE FREMDSPRACHENKOMPETENZ
- Allgemeine und berufliche Bildung
- Allgemeine und berufsbezogene Fremdsprachenkompetenz
- Grundfragen des berufsbezogenen Fremdsprachenunterrichts
- Die Berufsschule: Institutioneller Rahmen und Bildungsauftrag
- Das duale System als Teil des beruflichen Schulwesens
- Bildungsauftrag der Berufsschule im dualen System
- Fremdsprachenkompetenz: Bedarf und Bedürfnisse
- Einleitung und Begriffsbestimmung
- Bedarf an Fremdsprachenkompetenz: Anforderungen der Wirtschaft
- Individuelle Fremdsprachenbedürfnisse
- SITUATION DER FREMDSPRACHENAUSBILDUNG IN DER BERUFSSCHULE
- Quantitative Aspekte
- Umfang und Stellung des Fremdsprachenunterrichts
- Curriculare Einordnung des Fremdsprachenunterrichts in ausgewählten Berufen
- Qualitative Aspekte
- Überblick
- Leitprinzipien berufsbezogenen Englischlernens
- Lehrpläne und Richtlinien für berufsbezogenen Englischunterricht
- Möglichkeiten zur Verbesserung des Fremdsprachenunterrichts
- BILINGUALER UNTERRICHT: EINE EINFÜHRUNG
- Grundlegendes zu Terminologie und Hintergrund
- Ausgewählte Konzepte
- Immersionsunterricht in Kanada
- Das deutsche Modell des „bilingualen Sachfachunterrichts“
- Das österreichische Modell „Englisch als Arbeitssprache“
- Überblick und Versuche zur Kategorisierung
- Ergebnisse und Fundierung des bilingualen Unterrichts
- Untersuchungen zur Effektivität
- Fremdsprachendidaktische und lernpsychologische Fundierung
- Fragen der Sachfach- und Sprachdidaktik
- Content and language integrated learning
- Einzelne Fächer und ihre Eignung für CLIL
- Die Wirtschaftslehre und ihre Eignung für CLIL
- Methodisch-didaktische Aspekte bilingualen Unterrichts
- Sprachbezogene Kognitivierung
- Texte und Materialien für bilingualen Unterricht
- Lernerzentrierung und Sprachproduktion
- Bilingualer Unterricht an Berufsschulen
- BEDINGUNGSANALYSE ZUM BILINGUALEN WIRTSCHAFTSLEHREUNTERRICHT BEI INDUSTRIEKAUFLEUTEN
- Zur Auswahl des Bildungsgangs und Ausbildungsberufs
- Curriculare und organisatorische Rahmenbedingungen
- Fremdsprachliche Vorbildung und Rahmenbedingungen
- Berufs- und wirtschaftspädagogische Unterrichtsprinzipien
- Exemplarische Skizze eines bilingualen Moduls: Authentische Texte und ihre Eignung
- Zur Auswahl des Lernfelds
- Zur Auswahl von Unterrichtsmaterialien
- Beurteilung der ausgewählten Texte
- Analyse der inhaltlichen Eignung
- Darstellung der sprachlichen Analysekriterien
- Analyse der sprachlichen Eignung
- Schlussfolgerungen aus der Analyse der Texte
- SCHLUSSBEMERKUNGEN
- Übertragbarkeit auf andere Bildungsgänge des Berufskollegs
- Übertragbarkeit auf andere Sprachen
- Perspektiven der Umsetzung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Bedingungsprüfung für bilingualen Sachfachunterricht an kaufmännischen Schulen. Sie analysiert die Anforderungen an berufsbezogene Fremdsprachenkompetenz im dualen System und untersucht die Situation des Fremdsprachenunterrichts in der Berufsschule. Die Arbeit befasst sich mit verschiedenen Konzepten und Modellen bilingualen Unterrichts und beleuchtet deren Effektivität sowie didaktische Herausforderungen.
- Anforderungen an berufsbezogene Fremdsprachenkompetenz in der Berufsschule
- Situation des Fremdsprachenunterrichts in der Berufsschule
- Modelle und Konzepte bilingualen Unterrichts
- Bedingungen für die Implementierung bilingualen Unterrichts in der kaufmännischen Berufsschule
- Didaktische Herausforderungen und methodische Ansätze im bilingualen Sachfachunterricht
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 2 analysiert die Anforderungen an berufsbezogene Fremdsprachenkompetenz im Kontext der allgemeinen und beruflichen Bildung. Es werden die Grundfragen des berufsbezogenen Fremdsprachenunterrichts sowie der Bildungsauftrag der Berufsschule im dualen System beleuchtet.
- Kapitel 3 beleuchtet die Situation der Fremdsprachenausbildung in der Berufsschule. Es werden quantitative und qualitative Aspekte des Fremdsprachenunterrichts betrachtet, einschließlich Umfang, Stellung, curriculare Einordnung und Leitprinzipien.
- Kapitel 4 liefert eine Einführung in den bilingualen Unterricht. Es werden verschiedene Konzepte und Modelle vorgestellt, wie z.B. Immersionsunterricht in Kanada, das deutsche Modell des bilingualen Sachfachunterrichts und das österreichische Modell „Englisch als Arbeitssprache“. Es werden zudem Untersuchungen zur Effektivität sowie die didaktische und lernpsychologische Fundierung des bilingualen Unterrichts betrachtet.
- Kapitel 5 fokussiert auf die Bedingungsanalyse für bilingualen Wirtschaftslehreunterricht bei Industriekaufleuten. Es werden die curricularen und organisatorischen Rahmenbedingungen sowie die fremdsprachliche Vorbildung der Schüler untersucht. Zudem werden exemplarisch authentische Texte analysiert und deren Eignung für den bilingualen Unterricht bewertet.
Schlüsselwörter
Bilingualer Sachfachunterricht, Fremdsprachenkompetenz, Berufsschule, duales System, Wirtschaftslehre, Industriekaufmann, Content and Language Integrated Learning (CLIL), authentische Texte, Bedingungsanalyse, Unterrichtsmaterialien, didaktische Herausforderungen.
- Quote paper
- Daniel Kramer (Author), 2004, Bilingualer Sachfachunterricht an kaufmännischen Schulen. Eine Bedingungsprüfung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/39080