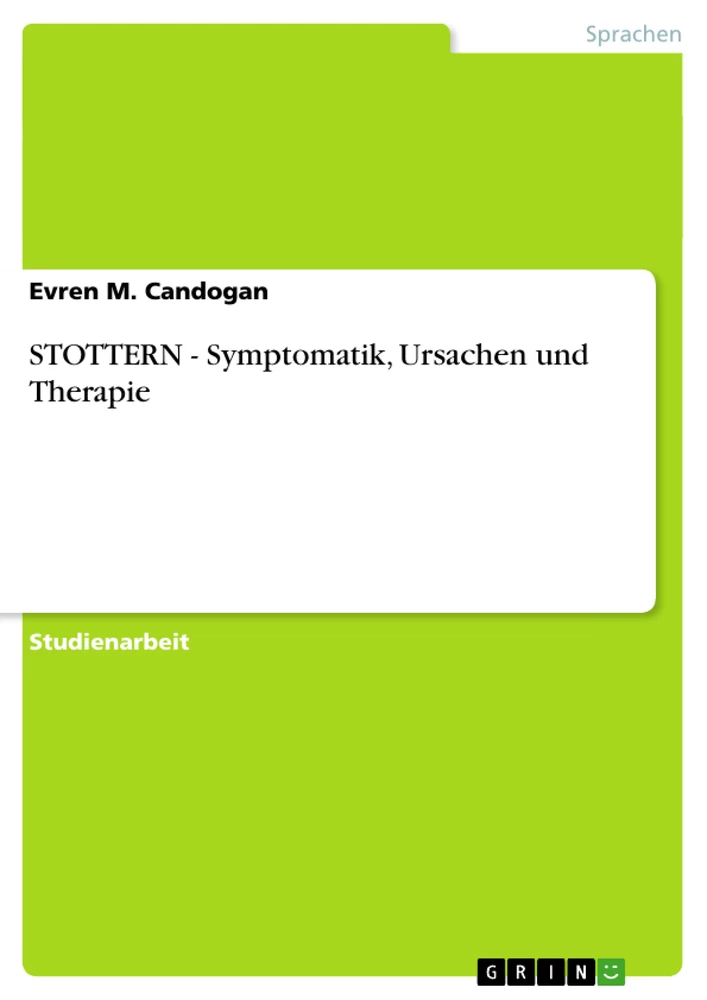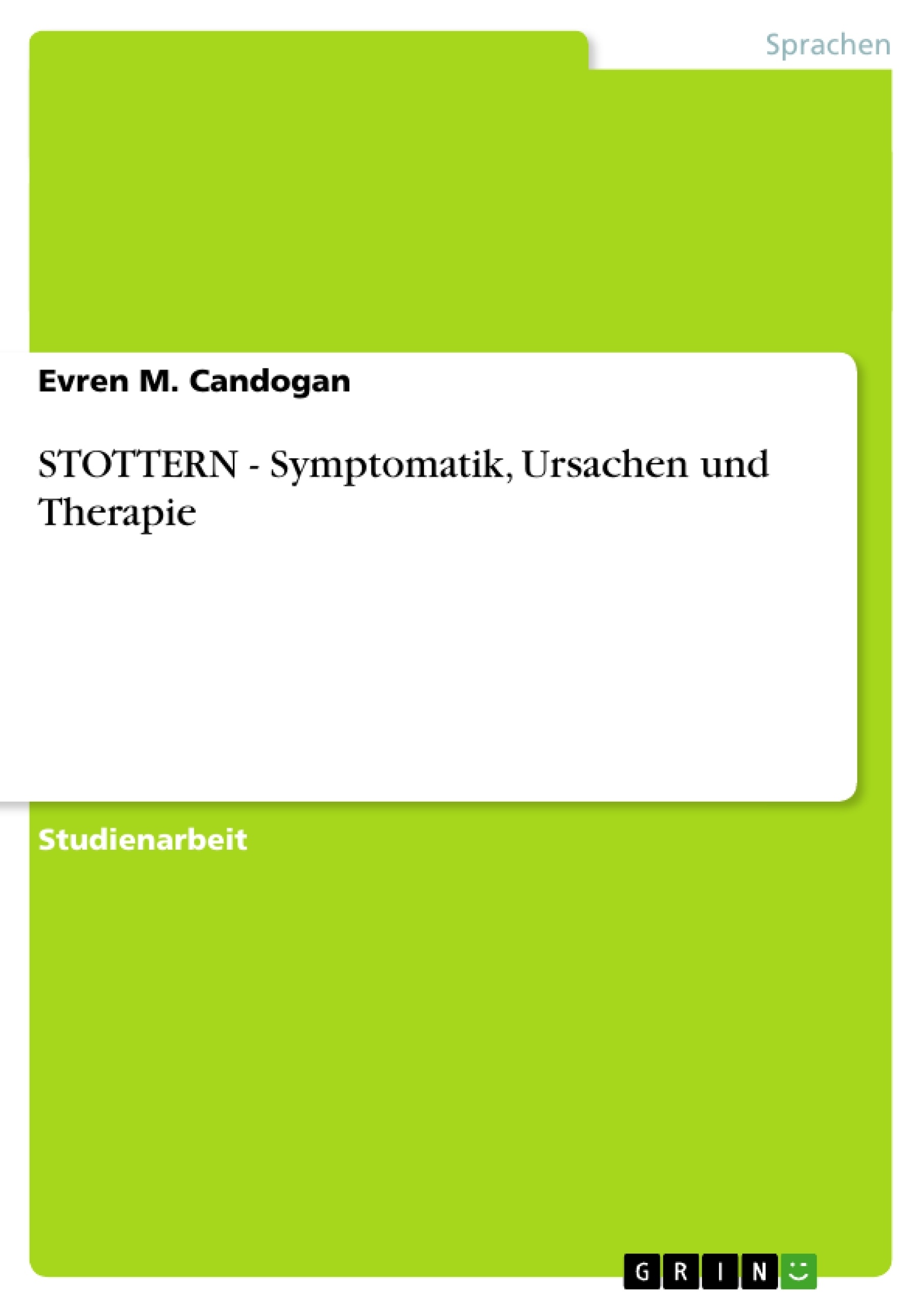Die Anzahl der wissenschaftlichen Veröffentlichungen, die sich mit dem Thema Stottern befassen, sind unüberschaubar. Daher hatte ich während meiner Vorbereitungen für diese Hausarbeit die Möglichkeit viele interessante Seiten des Stotterns kennen zulernen. Die entsprechenden Vorbereitungen haben oft hochinteressante Studien erfahrener Therapeuten dargestellt und sind daher von großem bleibendem Wert. Die daraus abgeleiteten Meinungen zu Ursachen, Bedingungen, Therapieansätzen sind allerdings recht unterschiedlich, je nachdem, ob der Verfasser Logopäde, Arzt, Psychoanalytiker, Verhaltenstherapeut oder Stimm- und Sprachheilpädagoge ist. Aber in einem sind sich alle einig. Stottern ist keine moderne Störung, sondern begleitet die Menschheit schon seit längerer Zeit. Es gibt z.B. ein 2500 Jahre altes chinesisches Gedicht, in dem Stottern erwähnt wird. Viele berühmte Menschen haben gestottert, unter ihnen Charles Darwin, Isaac Newton, König George der 6. von England (der Vater von Queen Elizabeth), Winston Churchill, Marylin Monroe, Bruce Wills (der mittlerweile schon geheilt ist), James Earl Jones (Stimme von "Darth Vader"), Rowan Atkinson alias Mr. Bean, Ben Johnson. u.v.m. Stottern ist also ein universelles Phänomen, das in allen Kulturen und sozioökonomischen Schichten auftritt und in hohem Maße die Befindlichkeit und die Persönlichkeitsentwicklung des Betroffenen beeinträchtigen kann. Diese Hausarbeit soll ein Einblick in die Erkenntnisse des Stotterns geben, die bis heute gesammelt worden sind.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition
- Entwicklungsverläufe und Differenzialdiagnose
- Der Beginn des Stotterns
- Entwicklungsverläufe frühkindlichen Stotterns
- Geschlechtsspezifische Verteilung
- Das Auftreten des Stotterns im familiären Kreis
- Symptome
- Äußere Symptome
- Kernverhalten
- Sekundärsymptomatik
- Fluchtverhalten
- Vermeidungsverhalten
- Innere Symptome
- Äußere Symptome
- Differenzialdiagnose
- Therapie des Stotterns
- Historischer Exkurs
- Stottermodifikation
- Identifikation
- Desensibilisierung
- Modifikation
- Stabilisierung
- Fluency Shaping
- Kombination von Stottermodifikation und Fluency Shaping
- Therapie bei Kindern
- Medikamentöse Behandlung
- Selbsthilfegruppen
- Apparative Sprechhilfen
- Metronom
- Maskierung
- Verzögerte auditive Rückmeldung
- Frequenzverschobene auditive Rückmeldung
- Biofeedback
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit bietet einen Überblick über das derzeitige Wissen zum Thema Stottern. Ziel ist es, verschiedene Definitionen, Entwicklungsverläufe, Symptome und Therapieansätze zu beleuchten und die Komplexität dieser Sprechstörung aufzuzeigen. Die Arbeit vermeidet abschließende Bewertungen und konzentriert sich auf die Darstellung unterschiedlicher Perspektiven.
- Definition und Abgrenzung des Stotterns
- Entwicklungsverläufe und Phasen des Stotterns im Kindesalter
- Symptombilder des Stotterns (äußere und innere Symptome)
- Unterschiedliche Therapieansätze
- Apparative Sprechhilfen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung betont die große Anzahl an wissenschaftlichen Veröffentlichungen zum Thema Stottern und die Vielfalt der Meinungen zu Ursachen, Bedingungen und Therapieansätzen, abhängig von der Profession des Verfassers. Sie hebt die historische Präsenz des Stotterns hervor und nennt prominente Stotternde, um das universelle und weitreichende Ausmaß der Störung zu veranschaulichen. Die Arbeit soll einen Einblick in die gesammelten Erkenntnisse geben.
Definition: Dieses Kapitel präsentiert unterschiedliche Definitionen von Stottern aus der Literatur und zeigt die Schwierigkeiten auf, eine allgemeingültige Definition zu finden. Es wird deutlich gemacht, dass selbst umfassende Definitionen unzureichend sind, da Symptome durch Vermeidungsstrategien oft nicht sichtbar sind. Die Komplexität des Stotterns und der Mangel an einer perfekten Definition werden hervorgehoben.
Entwicklungsverläufe und Differenzialdiagnose: Dieses Kapitel behandelt den Beginn des Stotterns, meist zwischen dem 2. und 5. Lebensjahr, und die Schwierigkeiten, den genauen Zeitpunkt zu bestimmen. Es werden verschiedene Modelle zur Beschreibung des Entwicklungsverlaufs vorgestellt (Bluemel, Froeschels, Bloodstein), die sich in der Anzahl und Beschreibung der Phasen unterscheiden. Die Kapitel verdeutlicht die Vielfältigkeit der Entwicklungsverläufe und die Komplexität der Diagnostik.
Symptome: Der Abschnitt beschreibt die äußeren und inneren Symptome des Stotterns. Äußere Symptome beinhalten Kernverhalten (z.B. Wiederholungen, Dehnungen), Sekundärsymptomatik (z.B. Grimassieren), Flucht- und Vermeidungsverhalten. Innere Symptome umfassen die emotionalen und psychischen Belastungen, die mit dem Stottern einhergehen. Das Kapitel unterscheidet zwischen beobachtbaren und subjektiv erlebten Aspekten der Störung.
Therapie des Stotterns: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über verschiedene Therapieansätze. Es werden historische Ansätze erwähnt sowie moderne Methoden wie Stottermodifikation (Identifikation, Desensibilisierung, Modifikation, Stabilisierung) und Fluency Shaping. Weiterhin werden die Therapie bei Kindern, medikamentöse Behandlungen und Selbsthilfegruppen angesprochen. Die Vielfältigkeit der Therapiemöglichkeiten wird hervorgehoben.
Apparative Sprechhilfen: Das Kapitel beschreibt verschiedene apparative Sprechhilfen wie Metronom, Maskierung, verzögerte und frequenzverschobene auditive Rückmeldung sowie Biofeedback. Diese Hilfsmittel sollen das Sprechen flüssiger gestalten und die Therapie unterstützen. Die technischen Aspekte der Hilfsmittel werden kurz erläutert.
Schlüsselwörter
Stottern, Sprechstörung, Entwicklungsverlauf, Symptome, Therapie, Stottermodifikation, Fluency Shaping, Apparative Sprechhilfen, Differenzialdiagnose, frühkindliches Stottern.
Häufig gestellte Fragen zu: Übersicht über Stottern
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit bietet einen umfassenden Überblick über das Stottern. Sie umfasst Definitionen, Entwicklungsverläufe, Symptome, verschiedene Therapieansätze (inklusive Stottermodifikation und Fluency Shaping), apparative Sprechhilfen und eine Differenzialdiagnose. Der Fokus liegt auf der Darstellung unterschiedlicher Perspektiven und vermeidet abschließende Bewertungen.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Definition und Abgrenzung des Stotterns; Entwicklungsverläufe und Phasen des Stotterns im Kindesalter; Symptombilder (äußere und innere Symptome); verschiedene Therapieansätze; apparative Sprechhilfen; Der Beginn des Stotterns; Entwicklungsverläufe frühkindlichen Stotterns; geschlechtsspezifische Verteilung; familiäres Auftreten; Kernverhalten, Sekundärsymptomatik, Flucht- und Vermeidungsverhalten; Historischer Exkurs zur Therapie; Medikamentöse Behandlung; Selbsthilfegruppen; Metronom, Maskierung, verzögerte und frequenzverschobene auditive Rückmeldung sowie Biofeedback.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in Kapitel unterteilt, beginnend mit einer Einleitung, gefolgt von einer Definition von Stottern. Es folgen Kapitel zu Entwicklungsverläufen und Differenzialdiagnose, Symptomen, Therapieansätzen und apparativen Sprechhilfen. Jedes Kapitel enthält eine Zusammenfassung.
Welche Definitionen von Stottern werden vorgestellt?
Die Arbeit präsentiert verschiedene Definitionen von Stottern aus der Literatur und hebt die Schwierigkeiten hervor, eine allgemeingültige Definition zu finden. Es wird betont, dass Symptome durch Vermeidungsstrategien oft nicht sichtbar sind, was die Komplexität der Definition verdeutlicht.
Welche Entwicklungsverläufe des Stotterns werden beschrieben?
Die Arbeit beschreibt den typischen Beginn des Stotterns (zwischen dem 2. und 5. Lebensjahr) und die Schwierigkeiten, den genauen Zeitpunkt zu bestimmen. Verschiedene Modelle zur Beschreibung des Entwicklungsverlaufs (Bluemel, Froeschels, Bloodstein) werden vorgestellt und verglichen.
Welche Symptome von Stottern werden unterschieden?
Es werden äußere (Kernverhalten wie Wiederholungen und Dehnungen, Sekundärsymptomatik, Flucht- und Vermeidungsverhalten) und innere Symptome (emotionale und psychische Belastungen) unterschieden. Der Unterschied zwischen beobachtbaren und subjektiv erlebten Aspekten wird hervorgehoben.
Welche Therapieansätze werden vorgestellt?
Die Arbeit gibt einen Überblick über verschiedene Therapieansätze, von historischen Ansätzen bis hin zu modernen Methoden wie Stottermodifikation (Identifikation, Desensibilisierung, Modifikation, Stabilisierung) und Fluency Shaping. Auch die Therapie bei Kindern, medikamentöse Behandlungen und Selbsthilfegruppen werden angesprochen.
Welche apparativen Sprechhilfen werden erwähnt?
Die Arbeit beschreibt verschiedene apparative Sprechhilfen wie Metronom, Maskierung, verzögerte und frequenzverschobene auditive Rückmeldung sowie Biofeedback. Die technischen Aspekte dieser Hilfsmittel werden kurz erläutert.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit richtet sich an ein akademisches Publikum, das sich umfassend über das Thema Stottern informieren möchte. Sie ist geeignet für Studierende, Wissenschaftler und Fachkräfte im Bereich der Logopädie und Sprachtherapie.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Stottern, Sprechstörung, Entwicklungsverlauf, Symptome, Therapie, Stottermodifikation, Fluency Shaping, Apparative Sprechhilfen, Differenzialdiagnose, frühkindliches Stottern.
- Quote paper
- Evren M. Candogan (Author), 2005, STOTTERN - Symptomatik, Ursachen und Therapie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/39044