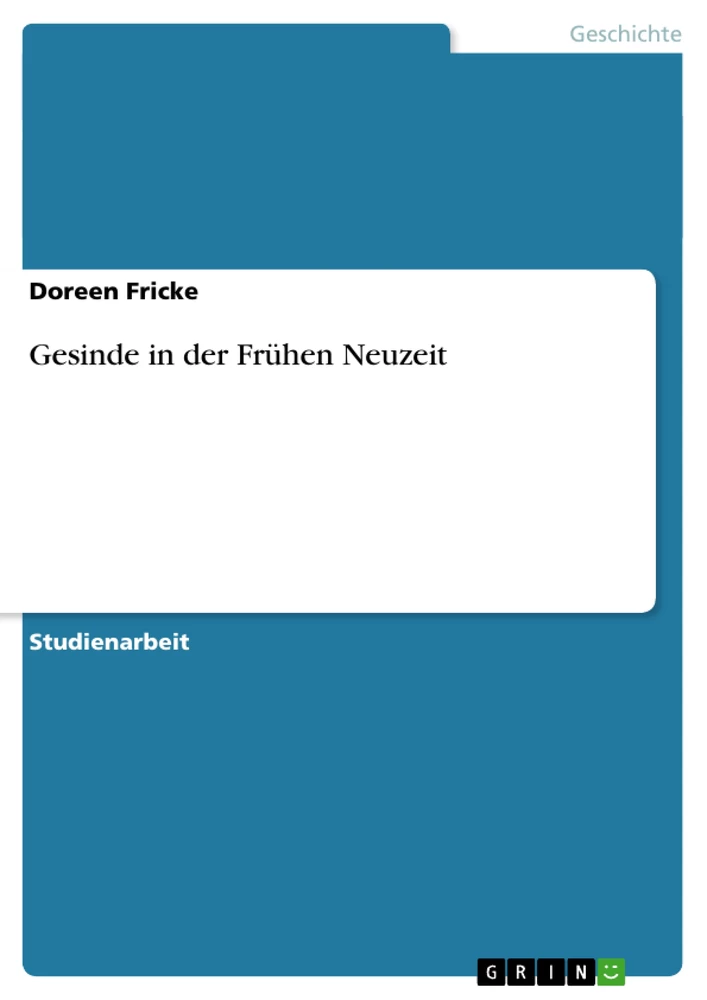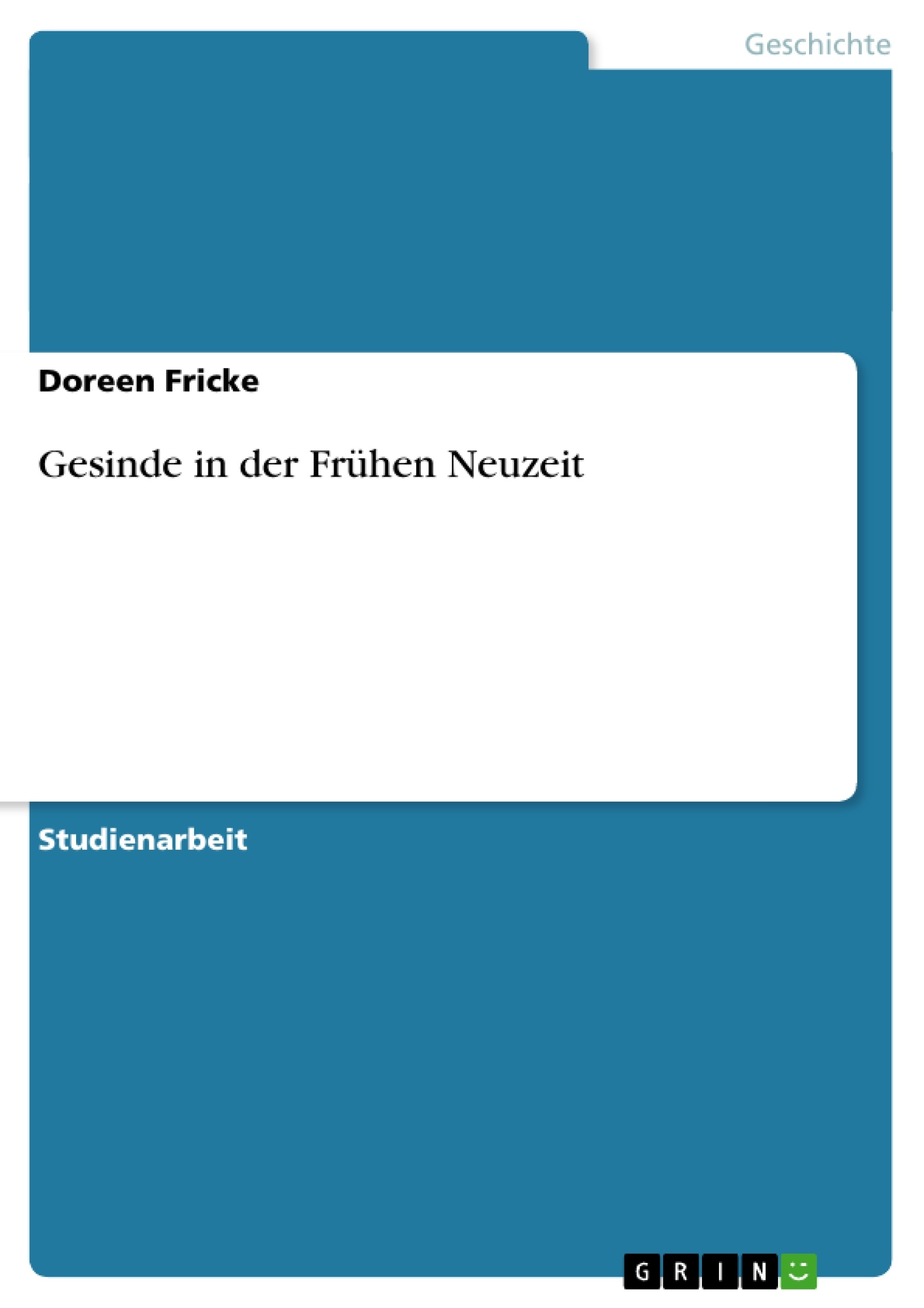Der Alltag des früh-neuzeitlichen Lebens wurde vor allen Dingen dadurch geprägt, dass den Menschen für die Arbeit im Haushalt und in der Landwirtschaft keine modernen technischen Geräte zur Verfügung standen. Somit wurde für alle anfallenden Tätigkeiten eine Vielzahl von Personen benötigt, die diese verrichteten. Da der Hausherr, seine Ehefrau und deren Kinder jedoch je nach Größe von Haus und Hof kaum in der Lage waren, diese allein zu bewirtschaften, war es notwendig, zusätzliche Arbeitskräfte einzustellen. Besagte Arbeitskräfte wurden in der Regel unter dem Begriff „Gesinde“ zusammengefasst. Die Art und Weise wie das Gesinde seinen Lebensunterhalt verdiente, unterschied sich von anderen Formen des Nahrungserwerbs durch die Arbeitsfelder und Pflichten, die es übernahm sowie durch die Gegenleistungen, die es für den geleisteten Dienst erhielt.
Wie sich der Gesindedienst im einzelnen gestaltete, welchen rechtlichen und religiösen Normen er unterlag und welche Spannungen sich daraus ergeben konnten, soll in dieser Arbeit genauer untersucht werden.
Dazu wird im ersten Teil zunächst den Gesindebegriff im Allgemeinen beleuchtet. Der zweite Abschnitt wird sich exemplarisch mit dem Gesinde im Kirchspiel Belm beschäftigen. Jürgen Schluhmbohm hat sich in seinem Buch „Lebensläufe, Familien, Höfe“ ausführlich mit den Menschen, die in der Frühen Neuzeit dort lebten und arbeiteten, auseinander gesetzt. Seine Ergebnisse sollen den theoretischen Fakten aus dem ersten Teil eine gewisse Lebendigkeit und Anschaulichkeit verleihen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- I. Teil: Gesinde - Stellung in der Familie, der Rechtsprechung und der Religion
- Was verbirgt sich hinter dem Gesindebegriff?
- Gesindeordnungen
- Der Vertragsschluss
- Die Entlohnung des Dienstes
- Die Fürsorge
- Pflichterfüllung und Disziplinierung
- Gesinde und Religion
- II. Teil: Das Gesinde im Kirchspiel Belm (basierend auf den Forschungsergebnissen Jürgen Schluhmbohms)
- Vorstellung des Kirchenspiels
- Der Gesindedienst
- Schlussbemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Stellung des Gesindes in der Frühen Neuzeit. Ziel ist es, den Gesindebegriff zu klären, die rechtlichen und religiösen Rahmenbedingungen des Gesindedienstes zu beleuchten und diese theoretischen Erkenntnisse anhand eines Fallbeispiels (Kirchspiel Belm) zu veranschaulichen.
- Definition und Entwicklung des Begriffs „Gesinde“
- Rechtliche Regelungen und Verträge im Gesindedienst
- Rollen und Pflichten von Gesinde und Dienstherren
- Der Einfluss religiöser Normen auf das Gesindeverhältnis
- Ein Fallbeispiel aus dem Kirchspiel Belm
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Kontext des Gesindedienstes in der Frühen Neuzeit, geprägt vom Mangel an technischer Unterstützung in Haushalt und Landwirtschaft. Sie führt den Begriff „Gesinde“ ein und skizziert die Forschungsfragen der Arbeit: die Gestaltung des Gesindedienstes, die rechtlichen und religiösen Normen und daraus resultierende Spannungen. Die Einleitung benennt zentrale Quellen und Forschungsliteratur, die im weiteren Verlauf der Arbeit herangezogen werden, und hebt die Fokussierung auf das 16. bis 18. Jahrhundert hervor.
I. Teil: Gesinde - Stellung in der Familie, der Rechtsprechung und der Religion: Dieser Teil befasst sich umfassend mit dem Gesindebegriff, beginnend mit seiner etymologischen Herleitung. Anhand von Definitionen aus Zedlers Universallexikon und Krünitz' Oeconomischer Encyklopädie wird der Begriff präzisiert und der Fokus auf die Arbeitsfelder, Pflichten und Gegenleistungen gelegt. Ausführlich behandelt werden die rechtlichen Aspekte des Gesindedienstes, einschliesslich des Vertragsabschlusses, der Entlohnung (in Barlohn und Kost), der Fürsorgepflicht der Dienstherren und der Disziplinierung des Gesindes. Die Rolle religiöser Normen im Gesindeverhältnis wird ebenfalls beleuchtet, mit Bezugnahme auf relevante Literatur zur Hausväterliteratur und Predigten über den christlichen Hausstand. Der Teil synthetisiert verschiedene Perspektiven aus der historischen Forschung zum Gesinderecht, um ein umfassendes Bild des Themas zu zeichnen.
II. Teil: Das Gesinde im Kirchspiel Belm (basierend auf den Forschungsergebnissen Jürgen Schluhmbohms): Dieser Teil wendet die im ersten Teil gewonnenen theoretischen Erkenntnisse auf das konkrete Beispiel des Kirchspiels Belm an. Basierend auf den Forschungen von Jürgen Schluhmbohm in „Lebensläufe, Familien, Höfe“ werden die Lebensumstände und Arbeitsbedingungen des Gesindes in Belm veranschaulicht. Der Fokus liegt darauf, die theoretischen Überlegungen anhand konkreter Beispiele aus dem Kirchspiel zu illustrieren und ihnen Lebendigkeit zu verleihen. Die Zusammenfassung integriert Schluhmbohms Ergebnisse, um das Verständnis des Gesindedienstes in der Frühen Neuzeit zu vertiefen und zu konkretisieren.
Schlüsselwörter
Gesinde, Frühe Neuzeit, Gesindedienst, Rechtsprechung, Religion, Haushalt, Landwirtschaft, Vertrag, Lohn, Fürsorge, Pflichten, Kirchspiel Belm, Jürgen Schluhmbohm, Zedler, Krünitz.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: "Stellung des Gesindes in der Frühen Neuzeit"
Was ist der Gegenstand der Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die Stellung des Gesindes in der Frühen Neuzeit. Sie beleuchtet den Gesindebegriff, die rechtlichen und religiösen Rahmenbedingungen des Gesindedienstes und veranschaulicht diese anhand eines Fallbeispiels (Kirchspiel Belm).
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Definition und Entwicklung des Begriffs „Gesinde“, die rechtlichen Regelungen und Verträge im Gesindedienst, die Rollen und Pflichten von Gesinde und Dienstherren, den Einfluss religiöser Normen auf das Gesindeverhältnis und ein Fallbeispiel aus dem Kirchspiel Belm. Sie analysiert den Gesindedienst anhand von Quellen wie Zedlers Universallexikon und Krünitz' Oeconomischer Encyklopädie sowie der Forschungsarbeit von Jürgen Schluhmbohm.
Welche Kapitel umfasst die Hausarbeit?
Die Hausarbeit besteht aus einer Einleitung, einem ersten Teil über die Stellung des Gesindes in Familie, Rechtsprechung und Religion, einem zweiten Teil über das Gesinde im Kirchspiel Belm (basierend auf Jürgen Schluhmbohms Forschung) und Schlussbemerkungen. Der erste Teil untersucht den Gesindebegriff, rechtliche Aspekte wie Vertragsabschluss, Entlohnung und Fürsorge sowie den Einfluss religiöser Normen. Der zweite Teil wendet die gewonnenen Erkenntnisse auf das Kirchspiel Belm an, basierend auf Schluhmbohms "Lebensläufe, Familien, Höfe".
Welche Quellen und Literatur werden verwendet?
Die Hausarbeit bezieht sich auf Zedlers Universallexikon und Krünitz' Oeconomischer Encyklopädie zur Definition des Gesindebegriffs. Sie berücksichtigt Forschungsliteratur zur Hausväterliteratur und Predigten über den christlichen Hausstand, um den Einfluss religiöser Normen zu beleuchten. Im zweiten Teil stützt sich die Arbeit auf die Forschungsergebnisse von Jürgen Schluhmbohm, insbesondere auf sein Werk "Lebensläufe, Familien, Höfe".
Was ist das Ziel der Hausarbeit?
Das Ziel der Hausarbeit ist es, den Gesindebegriff zu klären, die rechtlichen und religiösen Rahmenbedingungen des Gesindedienstes zu beleuchten und diese theoretischen Erkenntnisse anhand eines konkreten Fallbeispiels (Kirchspiel Belm) zu veranschaulichen. Sie will ein umfassendes Bild des Gesindedienstes in der Frühen Neuzeit zeichnen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Hausarbeit?
Schlüsselwörter sind: Gesinde, Frühe Neuzeit, Gesindedienst, Rechtsprechung, Religion, Haushalt, Landwirtschaft, Vertrag, Lohn, Fürsorge, Pflichten, Kirchspiel Belm, Jürgen Schluhmbohm, Zedler, Krünitz.
Wie wird das Kirchspiel Belm in der Hausarbeit behandelt?
Das Kirchspiel Belm dient als Fallbeispiel im zweiten Teil der Hausarbeit. Anhand der Forschungsergebnisse von Jürgen Schluhmbohm werden die Lebensumstände und Arbeitsbedingungen des Gesindes in Belm veranschaulicht, um die im ersten Teil gewonnenen theoretischen Erkenntnisse zu konkretisieren und zu vertiefen.
- Quote paper
- Doreen Fricke (Author), 2003, Gesinde in der Frühen Neuzeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/39027