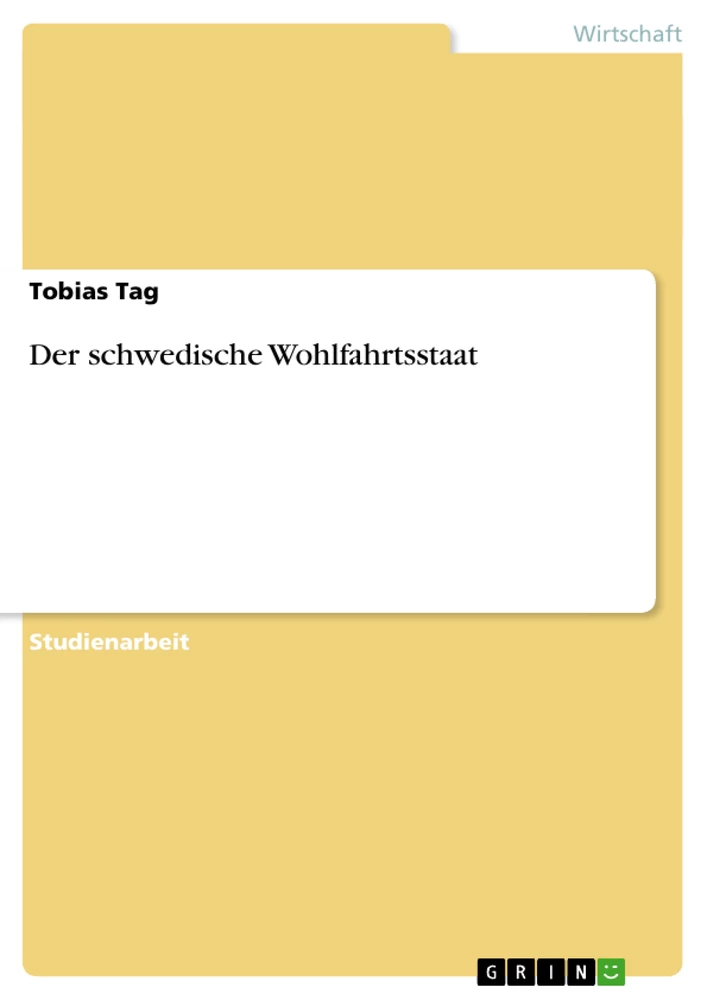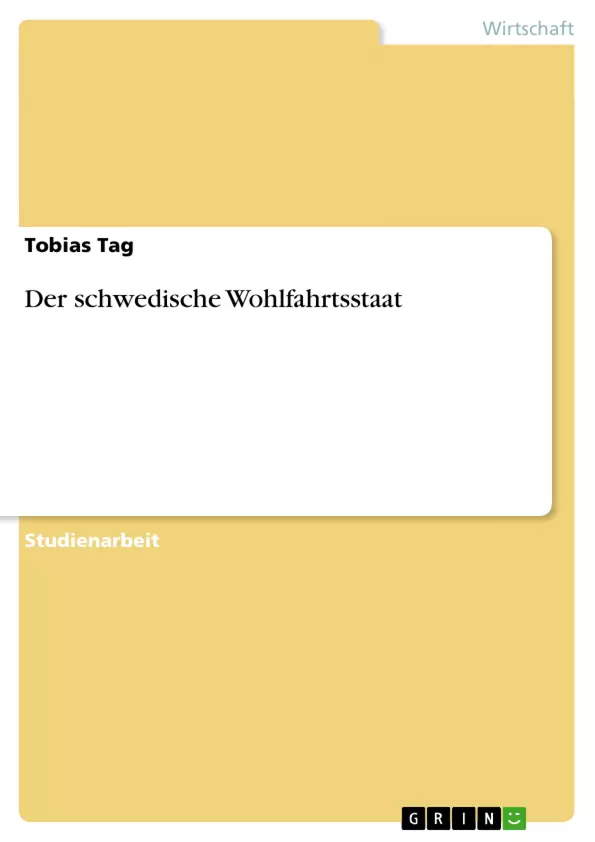Das schwedische Sozialsystem wurde die letzten Jahrzehnte – und wird zumindest in manchen Bereichen heute immer noch – von einer unvergleichbaren Universalität der Sozialleistungen, einer äußerst geringen Arbeitslosenquote und einer bemerkenswert aktiven Arbeitsmarktpolitik geprägt, alles bei starker staatlicher Regulierung und einer hohen Umverteilungsquote. Und man kann konstatieren, dass Schweden tatsächlich eine beispiellose Entwicklung von einem einfachen Agrarstaat hin zu einem modernen Wohlfahrtsstaat durchlaufen hat. Doch auch in Schweden kam es im Laufe dieser Entwicklung zu Krisen und Finanzierungsproblemen des Systems. Besonders Ende der 80er und zu Beginn der 90er Jahren wurde Schweden von einer Krise heimgesucht, die das universalistische Sozialsystem in seinen Grundmauern zu erschüttern drohte und die Kürzung einiger Leistungen nach sich zog. Nach eingehenden Reformen kämpft das Land auch zu Beginn des 21. Jahrhunderts, um an den alten wohlfahrtsstaatlichen Leistungskatalog anknüpfen zu können, muss jedoch gravierende Einschnitte konzedieren.
Zentrale Frage dieser Arbeit wird stets sein, was gerade Schweden so auszeichnete, dass jenem Land diese vorbildliche Modellhaftigkeit zugeschrieben wurde. Das Hauptaugenmerk der Analyse des Sozialstaates soll auf den Besonderheiten des schwedischen Modells liegen, welche sonst, zumindest außerhalb Skandinaviens, in dieser Form nicht zu finden sind. Gerade das sog. Rehn-Meidner-Modell der Vollbeschäftigung, das regelmäßig als die Basis und zugleich auch als das übergeordnete Ziel des Wohlfahrtsstaates in Schweden angesehen wurde, soll genauer untersucht werden. Ferner wird diese Entwicklung in ihrem geschichtlichen Kontext dargestellt, um schließlich den status quo zu Beginn des 21. Jahrhunderts des bestehenden Sozialstaates genauer verstehen zu können.
Das Modell mit all seinen Auswirkungen soll letztlich einer kritischen Betrachtung unterzogen werden, zum einen in Bezug auf die aktuellen Leistungen des Sozialstaates und die zukünftigen Möglichkeiten Schwedens im Hinblick auf eine stärkere Integration in das europäische System, zum anderen sollen mögliche negative Einflüsse des enorm starken staatlichen Einflusses kritisch hinterfragt werden. Da jedoch keine Vergleiche zu Sozialsystemen anderer Länder angestrebt werden, bedarf es hier keiner quantitativen oder monetären Vergleichsbasis der staatlichen Maßnahmen. Dieser Arbeit soll es genügen, die Leistungen qualitativ zu beschreiben und zu bewerten.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Begriffsdefinitionen
- 2.1 GLEICHHEIT UND SOZIALE GERECHTIGKEIT
- 2.2 DER WOHLFAHRTS- BZW. SOZIALSTAAT
- 2.3 DIE DREI MODELLE DES WOHLFAHRTSSTAATES
- 3. Schweden
- 3.1 DIE BEVÖLKERUNG
- 3.2 WERTE UND NORMEN DER SCHWEDISCHEN GESELLSCHAFT
- 3.3 DAS LAND IN ZAHLEN
- 4. Entwicklung und Status quo der schwedischen Wohlfahrtspolitik
- 4.1 DIE ZEITLICHE ENTWICKLUNG DES WOHLFAHRTSSTAATES
- 4.1.1 Die Ursprünge des Konzepts
- 4.1.2 Die Entwicklung nach 1950
- 4.1.3 Die Konsolidierungsphase seit 1980
- 4.2 AUFBAU UND FINANZIERUNG DES WOHLFAHRTSSTAATES
- 4.2.1 Ausgewählte Einzelleistungen des aktuellen Systems
- 4.2.2 Am Beispiel der Arbeitsmarktpolitik und der Krankenpflege
- 4.2.3 Die Finanzierung des Wohlfahrtsstaates
- 5. Herausragende Merkmale des schwedischen Wohlfahrtsstaates
- 5.1 KONTINUITÄT DURCH JAHRZEHNTELANGE SOZIALDEMOKRATISCHE REGIERUNG
- 5.2 STARKE STAATLICHE REGULIERUNG UND HOHER EINFLUSS DER GEWERKSCHAFTEN
- 5.2.1 Starke Regulierung durch den Staat
- 5.2.2 Zentralisierungseffekte durch die Gewerkschaften
- 5.3 HOHE FRAUENERWERBSQUOTE FÜHRT ZU DOPPELVERSORGERMODELL
- 5.3.1 Der Ursprung des geschlechterneutralen Konzeptes
- 5.3.2 Die gesetzlichen Rahmenbedingungen
- 5.4 DER AUSGEPRÄGTE UNIVERSALISMUS DER SOZIALLEISTUNGEN
- 5.5 ZIELE UND GESAMTWIRTSCHAFTLICHE AUSWIRKUNGEN DES RHEN-MEIDNER-MODELLS
- 5.5.1 Das übergeordnete Ziel der Vollbeschäftigung
- 5.5.2 Ursprung und Entwicklung des Rhen-Meidner-Modells
- 5.5.2.1 Restriktive Fiskalpolitik
- 5.5.2.2 Solidarische Lohnpolitik
- 5.5.2.3 Aktive Arbeitsmarktpolitik
- 6. Kritik am System und Fazit
- 6.1 UNMÜNDIGKEIT DER BÜRGER IN EINEM TOTALITÄREN SYSTEM
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Studienarbeit analysiert das schwedische Wohlfahrtsmodell. Ziel ist es, die Entwicklung des Wohlfahrtsstaates in Schweden im historischen Kontext zu betrachten und seine wichtigsten Merkmale zu beleuchten. Dabei werden die politischen, sozialen und wirtschaftlichen Faktoren betrachtet, die zur Entstehung und Entwicklung des schwedischen Wohlfahrtsstaates beigetragen haben.
- Entwicklung und Wandel des schwedischen Wohlfahrtsstaates
- Schlüsselelemente des schwedischen Wohlfahrtsmodells
- Soziale und wirtschaftliche Auswirkungen des Wohlfahrtsstaates
- Kritikpunkte und Herausforderungen
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung - Diese Einleitung stellt die Thematik der Studienarbeit vor und führt in das Thema des schwedischen Wohlfahrtsstaates ein. Es wird die Relevanz des Themas hervorgehoben und ein Überblick über die wichtigsten Themenbereiche der Arbeit gegeben.
- Kapitel 2: Begriffsdefinitionen - Dieses Kapitel definiert die zentralen Begriffe, die in der Analyse des schwedischen Wohlfahrtsmodells verwendet werden, wie Gleichheit, soziale Gerechtigkeit und das Wohlfahrtsstaat-Konzept. Es wird zudem auf die verschiedenen Modelle des Wohlfahrtsstaates eingegangen.
- Kapitel 3: Schweden - Dieses Kapitel präsentiert einen Überblick über Schweden und seine gesellschaftlichen Gegebenheiten. Es werden wichtige Aspekte wie die Bevölkerung, die Werte und Normen der schwedischen Gesellschaft sowie die wirtschaftliche Situation dargestellt.
- Kapitel 4: Entwicklung und Status quo der schwedischen Wohlfahrtspolitik - Dieses Kapitel untersucht die historische Entwicklung des schwedischen Wohlfahrtsstaates. Dabei werden die Ursprünge des Konzepts, die Entwicklung nach 1950 und die Konsolidierungsphase seit 1980 beleuchtet. Weiterhin wird der Aufbau und die Finanzierung des Wohlfahrtsstaates detailliert beschrieben.
- Kapitel 5: Herausragende Merkmale des schwedischen Wohlfahrtsstaates - Dieses Kapitel analysiert die wichtigsten Merkmale des schwedischen Wohlfahrtsstaates. Es werden Themen wie die Kontinuität durch jahrzehntelange sozialdemokratische Regierung, die starke staatliche Regulierung und der Einfluss der Gewerkschaften, die hohe Frauen-Erwerbsquote und der Universalismus der Sozialleistungen behandelt. Außerdem wird das Rhen-Meidner-Modell und seine Auswirkungen auf die schwedische Wirtschaft untersucht.
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe und Konzepte der Arbeit sind: Wohlfahrtsstaat, Schweden, sozialdemokratisches Modell, Sozialpolitik, Gleichheit, soziale Gerechtigkeit, Universalismus, Rhen-Meidner-Modell, staatliche Regulierung, Gewerkschaften, Frauen-Erwerbsquote, Arbeitsmarktpolitik, Wirtschaftspolitik, Vollbeschäftigung, Kritik.
Häufig gestellte Fragen
Was zeichnet das schwedische Wohlfahrtsmodell aus?
Es ist geprägt durch einen ausgeprägten Universalismus der Sozialleistungen, eine aktive Arbeitsmarktpolitik und eine hohe staatliche Umverteilungsquote zur Förderung von Gleichheit.
Was ist das Rehn-Meidner-Modell?
Es ist ein wirtschaftspolitisches Konzept, das Vollbeschäftigung durch eine Kombination aus restriktiver Fiskalpolitik, solidarischer Lohnpolitik und aktiver Arbeitsmarktpolitik anstrebt.
Warum hat Schweden eine so hohe Frauenerwerbsquote?
Das geschlechterneutrale Doppelversorgermodell wird durch staatliche Rahmenbedingungen wie exzellente Kinderbetreuung und Elternzeitregelungen massiv unterstützt.
Welche Rolle spielen die Gewerkschaften in Schweden?
Gewerkschaften haben in Schweden einen sehr hohen Einfluss und sind zentral an der Gestaltung der Lohnpolitik und der sozialen Sicherungssysteme beteiligt.
Mit welchen Krisen hatte der schwedische Sozialstaat zu kämpfen?
Besonders Ende der 80er und Anfang der 90er Jahre führten Finanzierungsprobleme zu Reformen und Kürzungen, um das System langfristig stabil zu halten.
- Quote paper
- Tobias Tag (Author), 2005, Der schwedische Wohlfahrtsstaat, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/39014