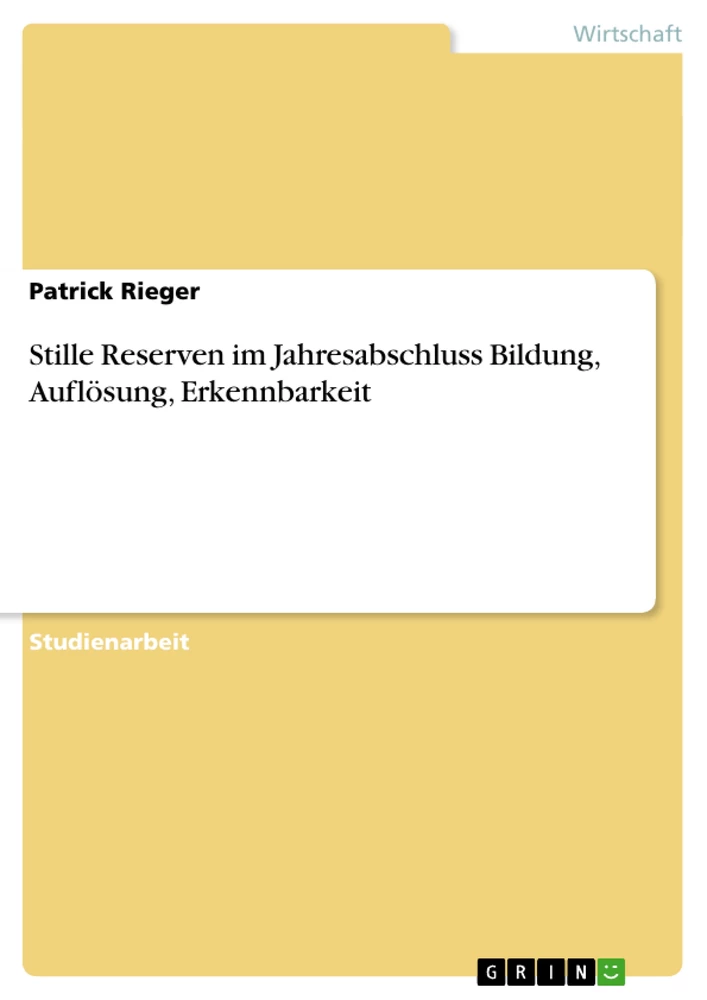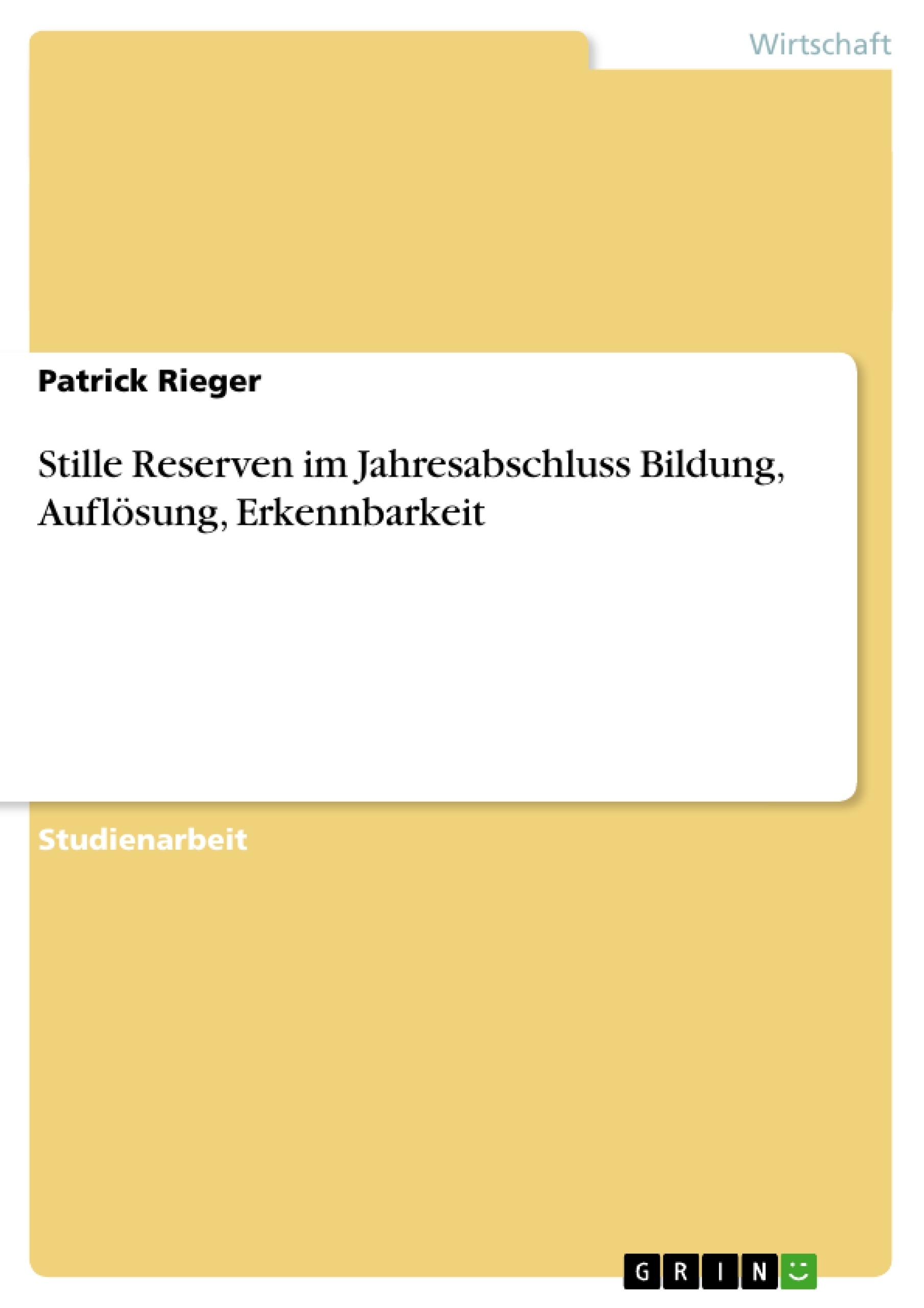INHALTSVERZEICHNIS
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 3
1 EINFÜHRUNG IN DAS THEMA 4
2 BEGRIFF DER STILLEN RESERVEN 4
2.1 Definition der stillen Reserven 4
2.2 Stille Reserven im weiteren Sinne 4
2.3 Stille Reserven im engeren Sinne 4
2.4 Abgrenzung zu offenen Rücklagen 5
3 ARTEN STILLER RESERVEN 5
3.1 Stille Zwangsreserven 5
3.2 Stille Schätzungsreserven 5
3.3 Stille Willkürreserven 6
3.4 Stille Ermessensreserven 6
4 STILLE RESERVEN IN DER HANDELSBILANZ UND STEUERBILANZ 6
4.1 Die Zulässigkeit stiller Reserven in der Handels- und Steuerbilanz 6
4.2 Die Vereinbarkeit stiller Reserven mit den Zielsetzungen von Handels- und Steuerbilanz 8
4.3 Bildung und Entstehung stiller Reserven 9
4.3.1 Entstehung durch niedrigere Bewertung von Vermögensgegenständen 9
4.3.2 Entstehung durch Nichtaktivierung aktivierungsfähiger Vermögensgegenstände 10
4.3.3 Entstehung durch Unterlassen der Zuschreibung von Wertsteigerungen 10
4.4 Die Auflösung von stillen Reserven 10
5 STILLE RESERVEN ALS INSTRUMENT DER BILANZPOLITIK 11
5.1 Kritische Betrachtung der stillen Reserven 11
5.1.1 Betriebswirtschaftliche Kritik an den stillen Reserven 11
5.1.2 Volkswirtschaftliche Kritik an den stillen Reserven 12
5.2 Vorteile der stillen Reservenpolitik 13
5.3.1 Die quantitative Erfolgskorrekturrechnung 14
5.3.2 Die qualitative Erfolgskorrekturrechnung 15
5.3.3 Die Auswertung der Börsenkursentwicklung 16
6 VERGLEICH DER BEHANDLUNG STILLER RESERVEN NACH INTERNATIONALEN ABSCHLÜSSEN 16
6.1 Stille Reserven im IAS-Abschluss 16
6.2 Stille Reserven im US-GAAP-Abschluss 17
ZUSAMMENFASSUNG 19
LITERATURVERZEICHNIS 20
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einführung in das Thema
- 2 Begriff der stillen Reserven
- 2.1 Definition der stillen Reserven
- 2.2 Stille Reserven im weiteren Sinne
- 2.3 Stille Reserven im engeren Sinne
- 2.4 Abgrenzung zu offenen Rücklagen
- 3 Arten stiller Reserven
- 3.1 Stille Zwangsreserven
- 3.2 Stille Schätzungsreserven
- 3.3 Stille Willkürreserven
- 3.4 Stille Ermessensreserven
- 4 Stille Reserven in der Handelsbilanz und Steuerbilanz
- 4.1 Die Zulässigkeit stiller Reserven in der Handels- und Steuerbilanz
- 4.2 Die Vereinbarkeit stiller Reserven mit den Zielsetzungen von Handels- und Steuerbilanz
- 4.3 Bildung und Entstehung stiller Reserven
- 4.3.1 Entstehung durch niedrigere Bewertung von Vermögensgegenständen
- 4.3.2 Entstehung durch Nichtaktivierung aktivierungsfähiger Vermögensgegenstände
- 4.3.3 Entstehung durch Unterlassen der Zuschreibung von Wertsteigerungen
- 4.4 Die Auflösung von stillen Reserven
- 5 Stille Reserven als Instrument der Bilanzpolitik
- 5.1 Kritische Betrachtung der stillen Reserven
- 5.1.1 Betriebswirtschaftliche Kritik an den stillen Reserven
- 5.1.2 Volkswirtschaftliche Kritik an den stillen Reserven
- 5.2 Vorteile der stillen Reservenpolitik
- 5.3 (Further subchapters omitted for brevity)
- 5.1 Kritische Betrachtung der stillen Reserven
- 6 Vergleich der Behandlung stiller Reserven nach internationalen Abschlüssen
- 6.1 Stille Reserven im IAS-Abschluss
- 6.2 Stille Reserven im US-GAAP-Abschluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht stille Reserven im Jahresabschluss, beleuchtet deren Bedeutung in der nationalen und internationalen Rechnungslegung und analysiert kritisch deren Legitimität. Die Arbeit gibt einen umfassenden Überblick über den Begriff, die Arten und die Entstehung sowie Auflösung stiller Reserven.
- Definition und Abgrenzung stiller Reserven
- Arten stiller Reserven und deren Entstehung
- Stille Reserven in der Handels- und Steuerbilanz
- Stille Reserven als Instrument der Bilanzpolitik
- Internationaler Vergleich der Behandlung stiller Reserven (IAS, US-GAAP)
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einführung in das Thema: Diese Einführung beschreibt den Fokus der Arbeit: stille Reserven im Jahresabschluss. Sie hebt die unterschiedliche Bedeutung stiller Reserven in der nationalen und internationalen Rechnungslegung hervor und kündigt die kritische Auseinandersetzung mit deren Legitimität an. Die Arbeit verspricht einen Überblick über den Begriff, die Arten, die Bildung, die Auflösung und die Bedeutung im Kontext internationaler Rechnungslegung.
2 Begriff der stillen Reserven: Dieses Kapitel definiert stille Reserven im Gegensatz zu offenen Rücklagen als im Jahresabschluss nicht erkennbare, durch Unterbewertung von Vermögensgegenständen oder Überbewertung von Schulden entstehende Beträge. Es differenziert zwischen stillen Reserven im weiteren und engeren Sinne, wobei erstere durch handelsrechtliche Bewertungsvorschriften entstehen (Zwangsreserven), während letztere durch bewusste Handlungen des Bilanzierenden gebildet werden, z.B. durch überhöhte Abschreibungen. Die Abgrenzung zu offenen Rücklagen wird anhand von Steuer- und Bilanzierungseffekten erläutert.
3 Arten stiller Reserven: Dieses Kapitel kategorisiert stille Reserven in beeinflussbare und nicht beeinflussbare Reserven. Nicht beeinflussbare Reserven sind Zwangsreserven, die aufgrund der gesetzlichen Vorschriften entstehen. Beeinflussbare Reserven umfassen Schätzungs-, Ermessens- und Willkürreserven, die durch die Bewertungsspielräume des Bilanzierenden entstehen. Die Kapitel beschreibt die Bewertungsschätzungen und deren Auswirkungen auf stille Reserven.
4 Stille Reserven in der Handelsbilanz und Steuerbilanz: Dieses Kapitel befasst sich mit der Zulässigkeit und Vereinbarkeit stiller Reserven mit den Zielen der Handels- und Steuerbilanz. Es beschreibt die Entstehung stiller Reserven durch niedrigere Bewertung von Vermögensgegenständen, Nichtaktivierung aktivierungsfähiger Vermögensgegenstände und Unterlassen der Zuschreibung von Wertsteigerungen. Die Auflösung von stillen Reserven wird ebenfalls erläutert.
5 Stille Reserven als Instrument der Bilanzpolitik: Dieses Kapitel analysiert kritisch die Verwendung stiller Reserven als Instrument der Bilanzpolitik, sowohl betriebswirtschaftlich als auch volkswirtschaftlich. Es beleuchtet die Vorteile der stillen Reservenpolitik, wie z.B. die Gewinnglättung, und diskutiert die damit verbundenen Probleme. Methoden zur Aufdeckung stiller Reserven werden kurz angerissen, wie die quantitative und qualitative Erfolgskorrekturrechnung sowie die Auswertung der Börsenkursentwicklung.
6 Vergleich der Behandlung stiller Reserven nach internationalen Abschlüssen: Dieses Kapitel vergleicht die Behandlung stiller Reserven nach HGB, IAS und US-GAAP. Es beleuchtet die Unterschiede in der Bilanzierung und Bewertung und die daraus resultierenden Konsequenzen für die Transparenz und Vergleichbarkeit von Jahresabschlüssen.
Schlüsselwörter
Stille Reserven, Jahresabschluss, Handelsbilanz, Steuerbilanz, Bilanzpolitik, Bewertung, Abschreibungen, Gewinnglättung, HGB, IAS, US-GAAP, Zwangsreserven, Schätzungsreserven, offene Rücklagen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Stille Reserven im Jahresabschluss"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit befasst sich umfassend mit dem Thema der stillen Reserven im Jahresabschluss. Sie untersucht deren Bedeutung in der nationalen und internationalen Rechnungslegung und analysiert kritisch deren Legitimität. Die Arbeit bietet einen Überblick über Begriff, Arten, Entstehung und Auflösung stiller Reserven.
Was sind stille Reserven?
Stille Reserven sind im Jahresabschluss nicht erkennbare Beträge, die durch die Unterbewertung von Vermögensgegenständen oder die Überbewertung von Schulden entstehen. Sie werden unterschieden in stille Reserven im weiteren Sinne (z.B. durch handelsrechtliche Bewertungsvorschriften entstehende Zwangsreserven) und im engeren Sinne (durch bewusste Handlungen des Bilanzierenden gebildete Reserven, z.B. durch überhöhte Abschreibungen). Die Abgrenzung zu offenen Rücklagen wird anhand von Steuer- und Bilanzierungseffekten erläutert.
Welche Arten stiller Reserven gibt es?
Die Arbeit kategorisiert stille Reserven in beeinflussbare und nicht beeinflussbare Reserven. Nicht beeinflussbare Reserven sind Zwangsreserven aufgrund gesetzlicher Vorschriften. Beeinflussbare Reserven umfassen Schätzungs-, Ermessens- und Willkürreserven, die durch Bewertungsspielräume des Bilanzierenden entstehen. Die Kapitel beschreibt die Bewertungsschätzungen und deren Auswirkungen auf stille Reserven.
Wie entstehen stille Reserven?
Stille Reserven entstehen durch niedrigere Bewertung von Vermögensgegenständen, Nichtaktivierung aktivierungsfähiger Vermögensgegenstände und Unterlassen der Zuschreibung von Wertsteigerungen. Die Arbeit erläutert diese Entstehungsprozesse im Detail.
Welche Rolle spielen stille Reserven in der Handels- und Steuerbilanz?
Die Arbeit untersucht die Zulässigkeit und Vereinbarkeit stiller Reserven mit den Zielen der Handels- und Steuerbilanz. Sie analysiert die Entstehung und Auflösung stiller Reserven in diesen beiden Bilanzformen.
Wie werden stille Reserven als Instrument der Bilanzpolitik eingesetzt?
Dieses Kapitel analysiert kritisch den Einsatz stiller Reserven als Instrument der Bilanzpolitik, sowohl betriebswirtschaftlich als auch volkswirtschaftlich. Es beleuchtet Vorteile wie die Gewinnglättung und diskutiert die damit verbundenen Probleme. Methoden zur Aufdeckung stiller Reserven werden kurz angerissen.
Wie werden stille Reserven im internationalen Vergleich behandelt?
Die Arbeit vergleicht die Behandlung stiller Reserven nach HGB, IAS und US-GAAP. Sie beleuchtet Unterschiede in Bilanzierung und Bewertung und die daraus resultierenden Konsequenzen für Transparenz und Vergleichbarkeit von Jahresabschlüssen.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant für das Verständnis des Themas?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Stille Reserven, Jahresabschluss, Handelsbilanz, Steuerbilanz, Bilanzpolitik, Bewertung, Abschreibungen, Gewinnglättung, HGB, IAS, US-GAAP, Zwangsreserven, Schätzungsreserven, offene Rücklagen.
- Quote paper
- Patrick Rieger (Author), 2003, Stille Reserven im Jahresabschluss Bildung, Auflösung, Erkennbarkeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/38991