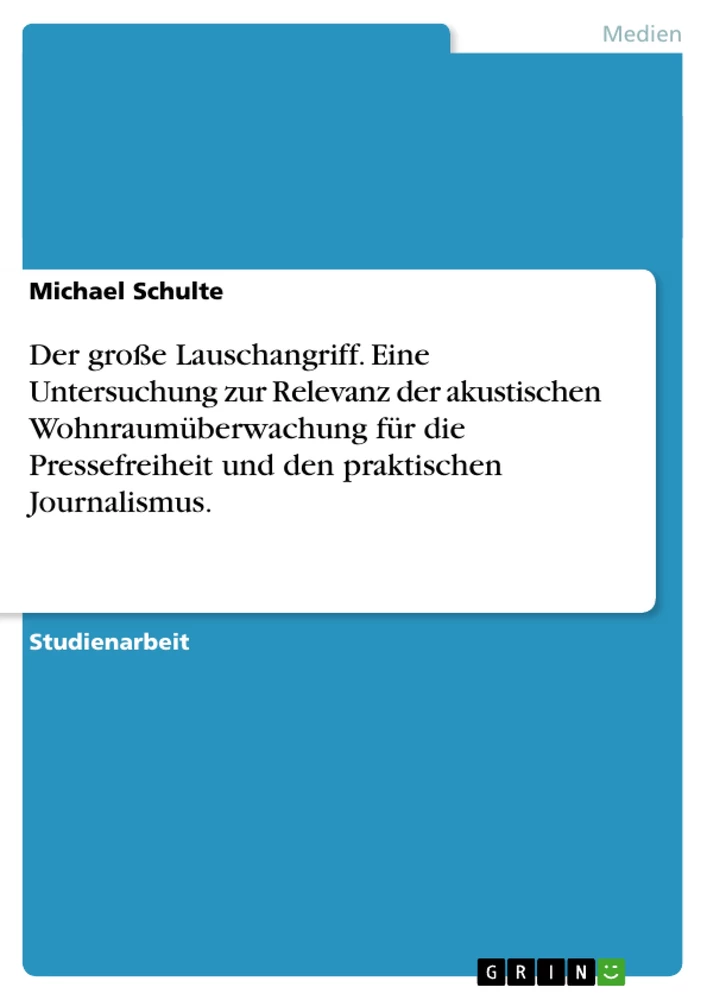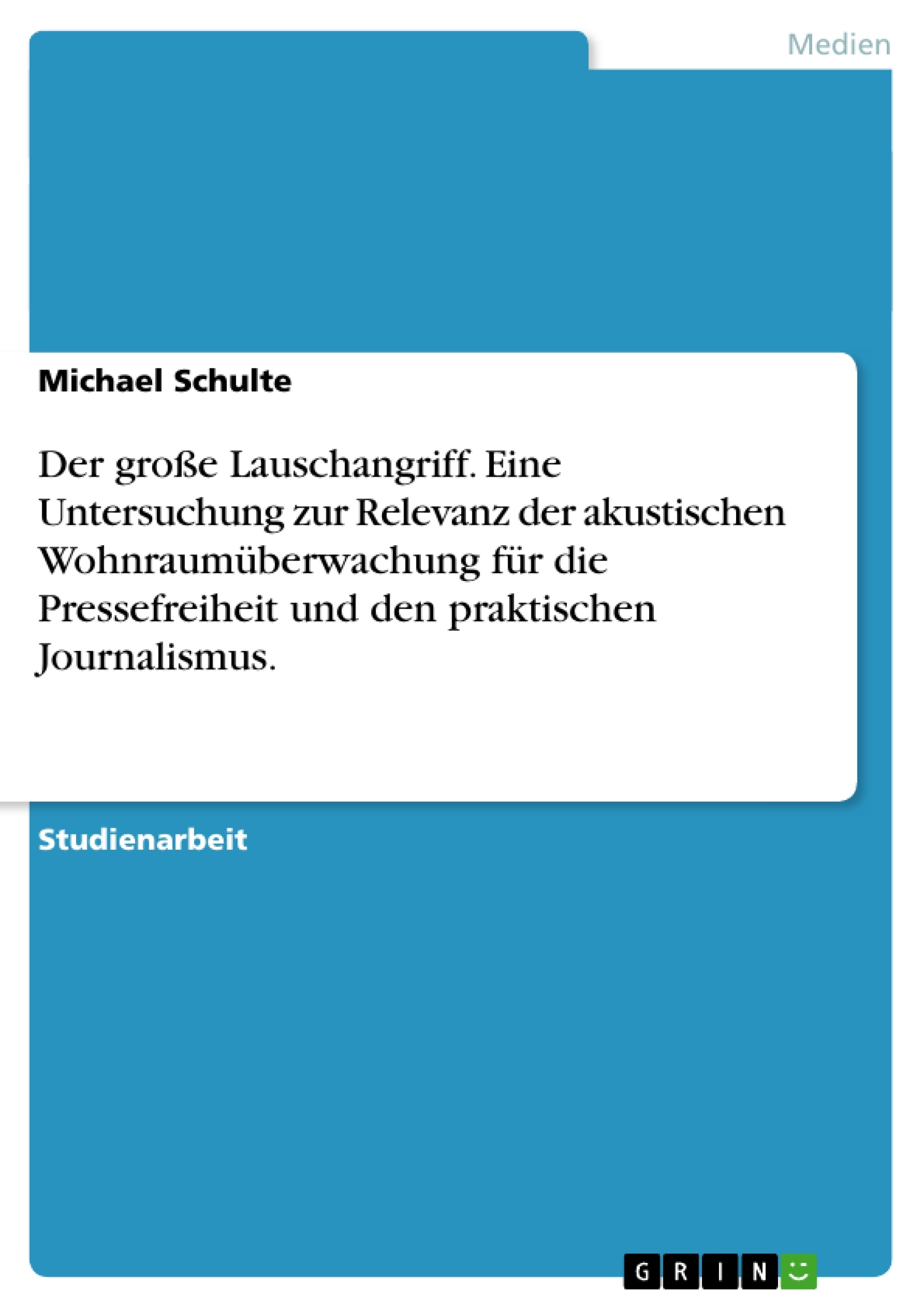Die akustische Wohnraumüberwachung zur Beweismittelgewinnung für die Strafverfolgung gehört in Deutschland zu den brisantesten innenpolitschen Themen. Schon viele Jahre vor der Einführung des so genannten großen Lauschangriffs war dessen Verträglichkeit mit den Prinzipien des deutschen Rechtsstaats zum Teil heftig diskutiert worden. Die Durchsetzung war vor allem an politische Überzeugungen und weniger an sachliche Argumente geknüpft. Das heimliche Abhören des nicht-öffenlich gesprochenen Wortes von Personen in Wohnungen nach § 100c Abs. 1 Nr. 3 StPO ist aus kriminalpolitischer Sicht eine allerletzte Möglichkeit, die bei der Aufklärung von bestimmten Verbrechen eingesetzt werden kann, wenn andere Ermittlungsmethoden keinen Erfolg versprechen. Rechtspolitisch betrachtet stellt der Lauschangriff einen besonders schweren Eingriff in den Kern- und Rückzugsbereich privater Lebensgestaltung dar, der durch die Änderung von Art. 13 GG (Unverletzlichkeit der Wohnung) legitimiert wurde und in den Paragraphen der Strafprozessordnung seine einfachgesetzliche Regelung findet. Mit der Novelle des Grundgesetzes und der Strafprozessordnung, in Kraft getreten 1998, ist allerdings nicht nur das Prinzip des geschützten häuslichen Intimbereichs berührt, sondern auch die Freiheit der Presse und damit die Tätigkeit von Journalisten. Denn trotz strafprozessualer Vorkehrungen, um Berufsgeheimnisträger wie Journalisten von staatlichen Lauschangriffen auszunehmen, besteht zumindest theoretisch dennoch die Gefahr einer Überwachung.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 1.1 Untersuchungsgegenstand und Erkenntnisinteresse
- 1.2 Forschungsfrage und Struktur der Untersuchung
- 2. Rechtsgrundlage und definitorische Abgrenzung
- 2.1 Großer Lauschangriff - rechtliche Bestimmungen
- 2.2 Technische Durchführung
- 3. Rechtsdogmatische und demokratietheoretische Erwägungen
- 3.1 Grundrecht auf Pressefreiheit und Meinungsäußerungsfreiheit
- 3.2 Funktion und Aufgabe der Massenmedien
- 3.3 Demokratische Meinungs- und Willensbildung
- 4. Formen und Entwicklungsphasen staatlicher Eingriffe in die Kommunikationsfreiheit in der BRD seit 1949
- 4.1 Eingeschränkte Befugnisse in der Adenauer-Ära
- 4.2 Trend zur Legalisierung nach Spiegel- Affäre und Pätsch-Fall
- 4.3 Ausweitung der Kompetenzen im Zuge der RAF-Terrorbekämpfung
- 4.4 Gesetzesnovellen zur Eindämmung der Organisierten Kriminalität
- 5. Der große Lauschangriff im Spannungsfeld zwischen Parteien und Journalisten
- 5.1 Standpunkte der Parteien
- 5.1.1 CDU und CSU
- 5.1.2 FDP
- 5.1.3 SPD
- 5.1.4 Bündnis 90/Die Grünen und PDS
- 5.2 Standpunkt der Journalisten- und Zeitungsverlegerverbände
- 5.3 Abstimmung in Bundestag und Bundesrat
- 6. Die Organisierte Kriminalität und die Rolle der Presse im Hinblick auf das Gesetzgebungsverfahren zum großen Lauschangriff
- 6.1 Problematik der Definition
- 6.2 Das aufgebauschte Bedrohungspotenzial
- 6.3 Straftatenkatalog
- 7. Rechtstheoretische Auswirkungen auf den Journalistenberuf
- 7.1 Unzulänglichkeiten des Abhörverbots
- 7.2 Beweiserhebungsverbot und Abhörverbot
- 7.3 Eingriff in das Vertrauensverhältnis
- 7.4 Ausklammerung von Berufshelfern
- 7.5 Beweisverwertungsverbot
- 7.6 Entprivilegierung
- 7.7 Fehlende Benachrichtigung
- 8. Der große Lauschangriff in der Praxis
- 8.1 Rechtswirklichkeit und Effizienzanalyse
- 8.1.1 Erfahrungsbericht der Bundesregierung
- 8.1.2 Berichtsjahr 1998
- 8.1.3 Berichtsjahr 1999
- 8.1.4 Berichtsjahr 2000
- 8.1.5 Berichtsjahr 2001
- 8.1.6 Berichtsjahr 2002
- 8.1.7 Berichtsjahr 2003
- 8.2 Zwischenbilanzen
- 8.2.1 Berwertung durch das Max-Planck-Institut
- 8.2.2 Einschätzung durch den Bund Deutscher Kriminalbeamter
- 8.3 Studie zur Rechtstatsächlichkeit des großen Lauschangriffs
- 9. Die Umsetzung des BVerG-Urteil vom 3. März 2004
- 9.1 Leitsätze des Urteils
- 9.2 Auswirkungen für den Grundrechtsschutz und die Praxis
- 9.3 Gesetzentwürfe des Bundesjustizministeriums
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Relevanz der akustischen Wohnraumüberwachung für die Pressefreiheit und den praktischen Journalismus in Deutschland. Sie analysiert die rechtlichen Grundlagen, die verfassungsrechtlichen Implikationen und die praktischen Auswirkungen des "großen Lauschangriffs". Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem Spannungsfeld zwischen staatlicher Sicherheitsinteressen und den Grundrechten der Bürger, insbesondere der Pressefreiheit.
- Rechtliche Rahmenbedingungen der akustischen Wohnraumüberwachung
- Verhältnis zwischen Lauschangriff und Pressefreiheit
- Demokratietheoretische Aspekte des "großen Lauschangriffs"
- Praktische Anwendung und Effizienz der Maßnahme
- Auswirkungen des BVerG-Urteils von 2004
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung: Diese Einleitung führt in das Thema der akustischen Wohnraumüberwachung ein und skizziert die Forschungsfrage sowie die methodische Vorgehensweise der Arbeit. Sie betont den brisanten Charakter des Themas und die widersprüchlichen politischen und rechtlichen Positionen, die sich im Laufe der Diskussion herausbildeten. Der Fokus liegt auf dem Spannungsfeld zwischen der kriminalpolitischen Notwendigkeit und dem Eingriff in die Privatsphäre sowie die Pressefreiheit.
2. Rechtsgrundlage und definitorische Abgrenzung: Dieses Kapitel beleuchtet die rechtlichen Grundlagen des großen Lauschangriffs, insbesondere die einschlägigen Bestimmungen der Strafprozessordnung. Es definiert den Begriff und beschreibt die technischen Möglichkeiten der akustischen Überwachung von Wohnräumen. Der Fokus liegt auf der rechtlichen Legitimation und den definitorischen Grenzen des Eingriffs in die Privatsphäre.
3. Rechtsdogmatische und demokratietheoretische Erwägungen: Hier werden die grundrechtlichen Aspekte des großen Lauschangriffs im Kontext der Pressefreiheit und der Meinungsäußerungsfreiheit diskutiert. Die Rolle der Massenmedien in einer demokratischen Gesellschaft und deren Bedeutung für die Meinungsbildung werden analysiert. Das Kapitel untersucht das Spannungsverhältnis zwischen dem Schutz individueller Grundrechte und den Interessen der Strafverfolgung.
4. Formen und Entwicklungsphasen staatlicher Eingriffe in die Kommunikationsfreiheit in der BRD seit 1949: Dieses Kapitel zeichnet die historische Entwicklung staatlicher Eingriffe in die Kommunikationsfreiheit nach, von eingeschränkten Befugnissen in der Adenauer-Ära bis hin zur Ausweitung der Kompetenzen im Kontext der RAF-Terrorbekämpfung und der organisierten Kriminalität. Es analysiert die gesetzgeberischen Anpassungen und deren Auswirkungen auf die Grundrechte.
5. Der große Lauschangriff im Spannungsfeld zwischen Parteien und Journalisten: Dieser Abschnitt untersucht die Positionen verschiedener politischer Parteien und Journalistenverbände zum Thema des großen Lauschangriffs. Die unterschiedlichen Standpunkte und Argumentationen werden analysiert, und der legislative Prozess im Bundestag und Bundesrat wird beleuchtet.
6. Die Organisierte Kriminalität und die Rolle der Presse im Hinblick auf das Gesetzgebungsverfahren zum großen Lauschangriff: Dieses Kapitel beleuchtet den Zusammenhang zwischen der Bekämpfung der organisierten Kriminalität und dem Gesetzgebungsverfahren zum großen Lauschangriff. Es analysiert die Problematik der Definition von organisierter Kriminalität, die mögliche Übertreibung des Bedrohungspotenzials und den relevanten Straftatenkatalog.
7. Rechtstheoretische Auswirkungen auf den Journalistenberuf: Dieses Kapitel analysiert die rechtlichen Auswirkungen des großen Lauschangriffs auf den Journalistenberuf, insbesondere die Problematik des Abhörverbots, des Eingriffs in das Vertrauensverhältnis zwischen Journalist und Quelle und die möglichen Folgen für die Beweismittelgewinnung.
8. Der große Lauschangriff in der Praxis: Hier wird die praktische Anwendung des großen Lauschangriffs anhand von Erfahrungsberichten der Bundesregierung und von Studien unabhängiger Institutionen untersucht. Der Fokus liegt auf der Effizienzanalyse der Maßnahme und deren Auswirkungen auf die Rechtswirklichkeit.
9. Die Umsetzung des BVerG-Urteil vom 3. März 2004: Dieses Kapitel beschreibt die Leitsätze des BVerG-Urteils vom März 2004 und analysiert deren Auswirkungen auf den Grundrechtsschutz und die praktische Anwendung des großen Lauschangriffs. Die Reaktion des Bundesjustizministeriums mit entsprechenden Gesetzesentwürfen wird ebenfalls beleuchtet.
Schlüsselwörter
Akustische Wohnraumüberwachung, Großer Lauschangriff, Pressefreiheit, Meinungsäußerungsfreiheit, Grundrechte, Strafprozessordnung, Organisierte Kriminalität, Rechtsstaat, Datenschutz, BVerfG, Demokratie, Journalismus, Überwachung, Rechtsdogmatik, Effizienzanalyse.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: "Der große Lauschangriff im Spannungsfeld zwischen Parteien und Journalisten"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Auswirkungen der akustischen Wohnraumüberwachung ("großer Lauschangriff") auf die Pressefreiheit und den Journalismus in Deutschland. Sie analysiert die rechtlichen Grundlagen, verfassungsrechtlichen Implikationen und die praktische Anwendung dieser Maßnahme.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die rechtlichen Rahmenbedingungen der akustischen Wohnraumüberwachung, das Verhältnis zwischen Lauschangriff und Pressefreiheit, demokratietheoretische Aspekte, die praktische Anwendung und Effizienz der Maßnahme sowie die Auswirkungen des BVerfG-Urteils von 2004. Sie beleuchtet auch die historischen Entwicklungen staatlicher Eingriffe in die Kommunikationsfreiheit seit 1949 und die Positionen verschiedener politischer Parteien und Journalistenverbände.
Welche Rechtsgrundlagen werden untersucht?
Die Arbeit untersucht die einschlägigen Bestimmungen der Strafprozessordnung (StPO) bezüglich des großen Lauschangriffs und beleuchtet die rechtliche Legitimation und die definitorischen Grenzen des Eingriffs in die Privatsphäre. Sie analysiert auch die grundrechtlichen Aspekte im Kontext der Pressefreiheit und der Meinungsäußerungsfreiheit.
Wie wird die historische Entwicklung dargestellt?
Die Arbeit zeichnet die historische Entwicklung staatlicher Eingriffe in die Kommunikationsfreiheit nach, beginnend mit eingeschränkten Befugnissen in der Adenauer-Ära bis hin zur Ausweitung der Kompetenzen im Kontext der RAF-Terrorbekämpfung und der organisierten Kriminalität. Sie analysiert die gesetzlichen Anpassungen und deren Auswirkungen auf die Grundrechte.
Welche Positionen der Parteien und Journalisten werden verglichen?
Die Arbeit analysiert die unterschiedlichen Standpunkte und Argumentationen von Parteien (CDU/CSU, FDP, SPD, Bündnis 90/Die Grünen und PDS) und Journalisten- und Zeitungsverlegerverbänden zum großen Lauschangriff und beleuchtet den legislativen Prozess im Bundestag und Bundesrat.
Wie wird die organisierte Kriminalität in die Analyse einbezogen?
Die Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen der Bekämpfung der organisierten Kriminalität und dem Gesetzgebungsverfahren zum großen Lauschangriff. Sie analysiert die Problematik der Definition von organisierter Kriminalität, die mögliche Übertreibung des Bedrohungspotenzials und den relevanten Straftatenkatalog.
Welche Auswirkungen auf den Journalismus werden beschrieben?
Die Arbeit analysiert die rechtlichen Auswirkungen des großen Lauschangriffs auf den Journalistenberuf, insbesondere die Problematik des Abhörverbots, des Eingriffs in das Vertrauensverhältnis zwischen Journalist und Quelle und die möglichen Folgen für die Beweismittelgewinnung.
Wie wird die praktische Anwendung des Lauschangriffs bewertet?
Die Arbeit untersucht die praktische Anwendung des großen Lauschangriffs anhand von Erfahrungsberichten der Bundesregierung und Studien unabhängiger Institutionen. Der Fokus liegt auf der Effizienzanalyse der Maßnahme und deren Auswirkungen auf die Rechtswirklichkeit. Berichte aus den Jahren 1998-2003 werden ausgewertet.
Welche Rolle spielt das BVerfG-Urteil vom 3. März 2004?
Die Arbeit beschreibt die Leitsätze des BVerfG-Urteils vom 3. März 2004 und analysiert dessen Auswirkungen auf den Grundrechtsschutz und die praktische Anwendung des großen Lauschangriffs. Die Reaktion des Bundesjustizministeriums mit entsprechenden Gesetzesentwürfen wird ebenfalls beleuchtet.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Akustische Wohnraumüberwachung, Großer Lauschangriff, Pressefreiheit, Meinungsäußerungsfreiheit, Grundrechte, Strafprozessordnung, Organisierte Kriminalität, Rechtsstaat, Datenschutz, BVerfG, Demokratie, Journalismus, Überwachung, Rechtsdogmatik, Effizienzanalyse.
- Quote paper
- Dipl.-Journ. Michael Schulte (Author), 2004, Der große Lauschangriff. Eine Untersuchung zur Relevanz der akustischen Wohnraumüberwachung für die Pressefreiheit und den praktischen Journalismus., Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/38970