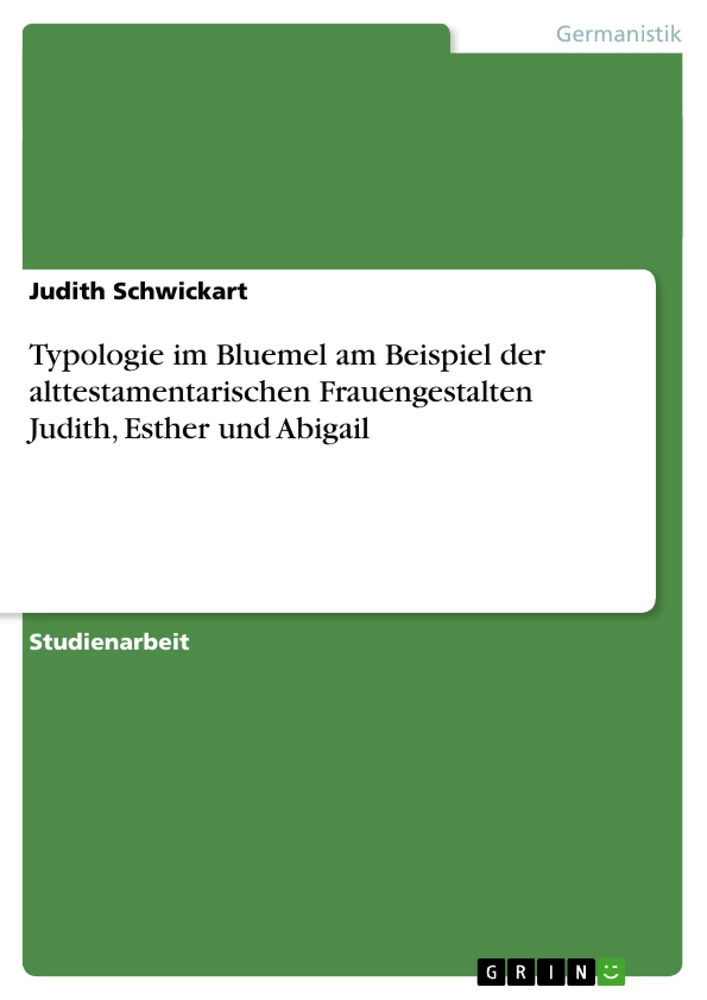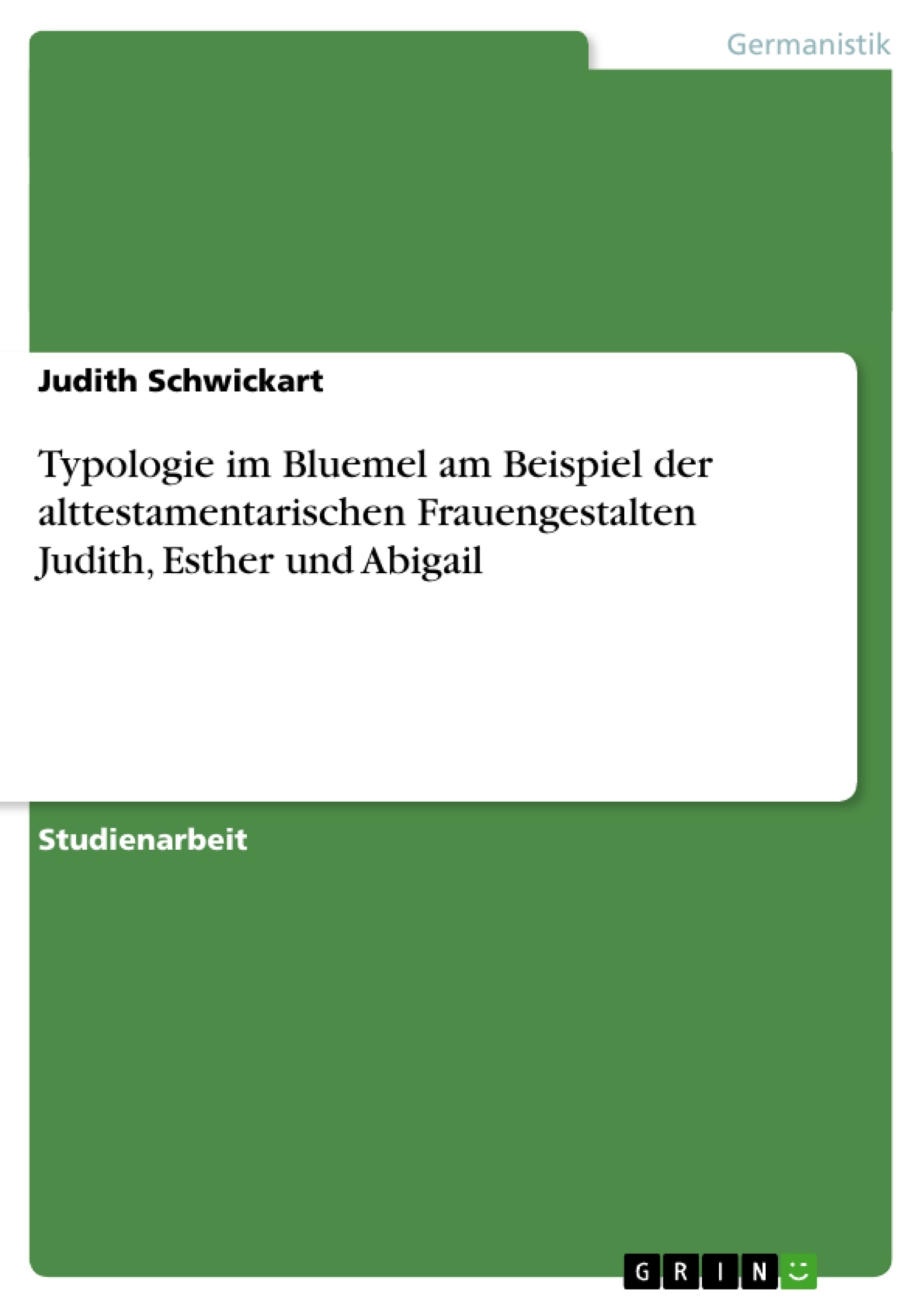Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Erklärung des Deutungsverfahrens Typologie und ihrer Anwendung am Beispiel dreier Personenmotive in dem Marienpreis.
Das Blümel. Dieser Marienpreis wurde von einem namentlich nicht bekannten Zisterziensermönch in Böhmen als Anhang einer Abschrift des Marienleben[s] von Philipp von Seitz verfasst. Das Verfassen solcher Marienpreise ist typisch für das Mittelalter, da fast ausschließlich geistliche Texte schriftlich festgehalten wurden und Maria als höchste Heilige im Zentrum der Frömmigkeit stand.
Im ersten Teil dieser Arbeit wird zunächst der Typologiebegriff erklärt und die Anwendung der Typologie als Deutungsverfahren der Bibelexegese erläutert. Zum besseren Verständnis werden anschließend Ursprung und Entwicklung der Typologie geschildert. Im Folgenden werden noch kurz die Probleme dargestellt, die sich ergeben, wenn man heute versucht, Texte typologisch zu interpretieren.
Im zweiten Teil des Hauptteils werden die drei Frauenmotive Judith, Esther und Abigail typologisch interpretiert. Dazu werden zunächst die zu bearbeitenden Textstellen aus dem Blümel zitiert. Da der heutige Leser in der Regel – und im Gegensatz zum mittelalterlichen Leser – nicht allzu gut mit den biblischen Motiven vertraut ist, werden zum besseren Verständnis die Referenzstellen aus der Bibel wiedergegeben. Daran anschließend wird die typologische Auslegung der Motive auf Maria erfolgen. Dies geschieht unter der Leitfrage, inwiefern Judith, Esther und Abigail zu Vorabbildungen Marias wurden und wieso sie als unvollkommen angesehen werden können.
Im Schlussteil werden noch einmal kurz die Ergebnisse zusammengefasst.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Vorbemerkungen
- 2. Zum Typologiebegriff
- 2.1 Ursprung und Entwicklung der Typologie
- 2.2 Problematik der typologischen Deutung aus heutiger Sicht
- 3. Beispiele im Text und ihre typologische Auslegung
- 3.1 Judith
- 3.2 Typologie Judith – Maria
- 3.3 Esther
- 3.4 Typologie Esther - Maria
- 3.5 Abigail
- 3.6 Typologie Abigail - Maria
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Anwendung des typologischen Deutungsverfahrens am Beispiel der alttestamentarischen Frauengestalten Judith, Esther und Abigail im Marienpreis "Das Blümel". Die Arbeit beleuchtet den Typologiebegriff, seine historische Entwicklung und die Herausforderungen seiner Anwendung in der modernen Interpretation. Der Fokus liegt auf der Analyse, inwiefern diese Figuren als Vorläufer Marias verstanden werden können und welche Aspekte ihrer Geschichten als "unvollkommen" im Vergleich zu Maria betrachtet werden.
- Der Typologiebegriff und seine Anwendung in der Bibelauslegung
- Die typologische Interpretation der Frauengestalten Judith, Esther und Abigail
- Der Vergleich der drei Figuren mit Maria als Antitypus
- Die Problematik der typologischen Interpretation in der heutigen Zeit
- Die Rolle der alttestamentarischen Figuren in der mittelalterlichen Marienverehrung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Vorbemerkungen: Die Einleitung beschreibt den Gegenstand der Arbeit: die Analyse der typologischen Interpretation dreier alttestamentarischer Frauengestalten (Judith, Esther, Abigail) im Marienpreis "Das Blümel". Sie skizziert den Aufbau der Arbeit, wobei der erste Teil den Typologiebegriff erklärt und der zweite Teil die typologische Interpretation der drei Figuren im Kontext des Marienpreises vornimmt. Der Schluss fasst die Ergebnisse zusammen. Die Einleitung betont die Bedeutung Marias in der mittelalterlichen Frömmigkeit und den Kontext des Marienpreises als typisches Beispiel mittelalterlicher geistlicher Texte.
2. Zum Typologiebegriff: Dieses Kapitel definiert den Begriff der Typologie als mittelalterliches Deutungsverfahren, bei dem zwei historische Ereignisse, Personen oder Dinge miteinander verbunden werden. Das frühere Ereignis (Typus) wird als unvollkommene Vorwegnahme des späteren Ereignisses (Antitypus) interpretiert. Typus und Antitypus stehen im Verhältnis von Verheißung und Erfüllung. Der Text beleuchtet den Ursprung der Typologie im frühen Christentum, verweist aber auch auf inneralttestamentarische typologische Ansätze im Judentum. Die Bedeutung der Typologie als primäres Verfahren der mittelalterlichen Bibelauslegung wird hervorgehoben, wobei das Alte Testament als Vorabbildung des Neuen Testaments verstanden wird. Das Kapitel beschreibt die Herausforderungen einer zeitgemäßen typologischen Interpretation.
2.1 Ursprung und Entwicklung der Typologie: Dieses Unterkapitel erörtert die Ursprünge der typologischen Interpretation. Obwohl die Typologie im frühen Christentum zur vollen Blüte gelangte, wird argumentiert, dass bereits im vorchristlichen Judentum Ansätze existierten, Ereignisse der Geschichte Israels als Vorläufer zukünftiger Ereignisse zu interpretieren. Die Urchristen nutzten alttestamentarische Motive bewusst, um die Kontinuität zwischen Altem und Neuem Testament und die Rolle Christi darin zu verdeutlichen. Der Abschnitt diskutiert die Sicht der Urkirche auf das Alte Testament und den jüdischen Anspruch darauf.
Schlüsselwörter
Typologie, Bibelauslegung, Mittelalter, Marienpreis, Das Blümel, Judith, Esther, Abigail, Maria, Antitypus, Typus, Altes Testament, Neues Testament, mittelalterliche Frömmigkeit, Biblische Exegese, Figuraldeutung.
Häufig gestellte Fragen zu "Das Blümel": Eine typologische Analyse von Judith, Esther und Abigail im Kontext Marias
Was ist das Thema der Seminararbeit "Das Blümel"?
Die Seminararbeit analysiert die Anwendung des typologischen Deutungsverfahrens an den alttestamentarischen Frauengestalten Judith, Esther und Abigail im Marienpreis "Das Blümel". Sie untersucht, inwiefern diese Figuren als Vorläufer Marias (Antitypus) verstanden werden können und welche Aspekte ihrer Geschichten im Vergleich zu Maria als "unvollkommen" (Typus) betrachtet werden.
Welche Aspekte des Typologiebegriffs werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet den Typologiebegriff umfassend: seinen Ursprung und seine Entwicklung im frühen Christentum und im Judentum, seine Anwendung in der mittelalterlichen Bibelauslegung und die Herausforderungen seiner Anwendung in der modernen Interpretation. Es wird das Verhältnis von Typus (altes Testament) und Antitypus (Neues Testament) im Kontext der Verheißung und Erfüllung erklärt.
Welche alttestamentarischen Figuren werden analysiert?
Die Arbeit konzentriert sich auf die typologische Interpretation der drei alttestamentarischen Frauengestalten Judith, Esther und Abigail. Für jede Figur wird untersucht, wie sie im Kontext des Marienpreises "Das Blümel" als Vorläuferin Marias gedeutet wird.
Wie wird Maria in der Arbeit betrachtet?
Maria dient als Antitypus, als diejenige, die die unvollkommenen Vorbilder der alttestamentarischen Frauen (Judith, Esther, Abigail) in ihrer Vollkommenheit erfüllt. Der Vergleich der drei Figuren mit Maria steht im Zentrum der Analyse.
Welche Herausforderungen der typologischen Interpretation werden angesprochen?
Die Arbeit thematisiert die Problematik der typologischen Interpretation in der heutigen Zeit. Sie reflektiert kritisch die Anwendung dieses mittelalterlichen Deutungsverfahrens auf moderne Bibelauslegung und berücksichtigt die Herausforderungen einer zeitgemäßen Interpretation.
Was ist der Marienpreis "Das Blümel"?
Der Marienpreis "Das Blümel" dient als Kontext für die typologische Analyse. Er ist ein typisches Beispiel mittelalterlicher geistlicher Texte und verdeutlicht die Bedeutung Marias in der mittelalterlichen Frömmigkeit.
Welche Kapitel umfasst die Seminararbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Vorbemerkungen (Einleitung), Zum Typologiebegriff (inkl. Ursprung und Entwicklung), Beispiele im Text und ihre typologische Auslegung (Judith, Esther, Abigail im Vergleich zu Maria), und Fazit. Das Kapitel "Zum Typologiebegriff" beinhaltet eine detaillierte Erörterung des Begriffs und seiner historischen Entwicklung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Typologie, Bibelauslegung, Mittelalter, Marienpreis, Das Blümel, Judith, Esther, Abigail, Maria, Antitypus, Typus, Altes Testament, Neues Testament, mittelalterliche Frömmigkeit, Biblische Exegese, Figuraldeutung.
- Quote paper
- Judith Schwickart (Author), 2004, Typologie im Bluemel am Beispiel der alttestamentarischen Frauengestalten Judith, Esther und Abigail, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/38904