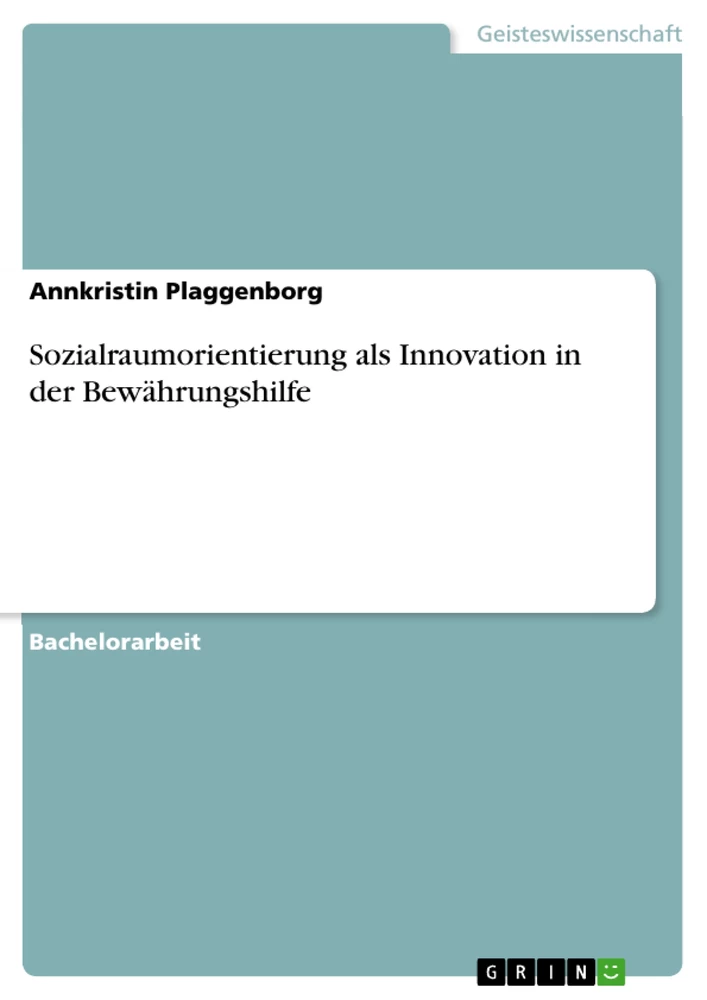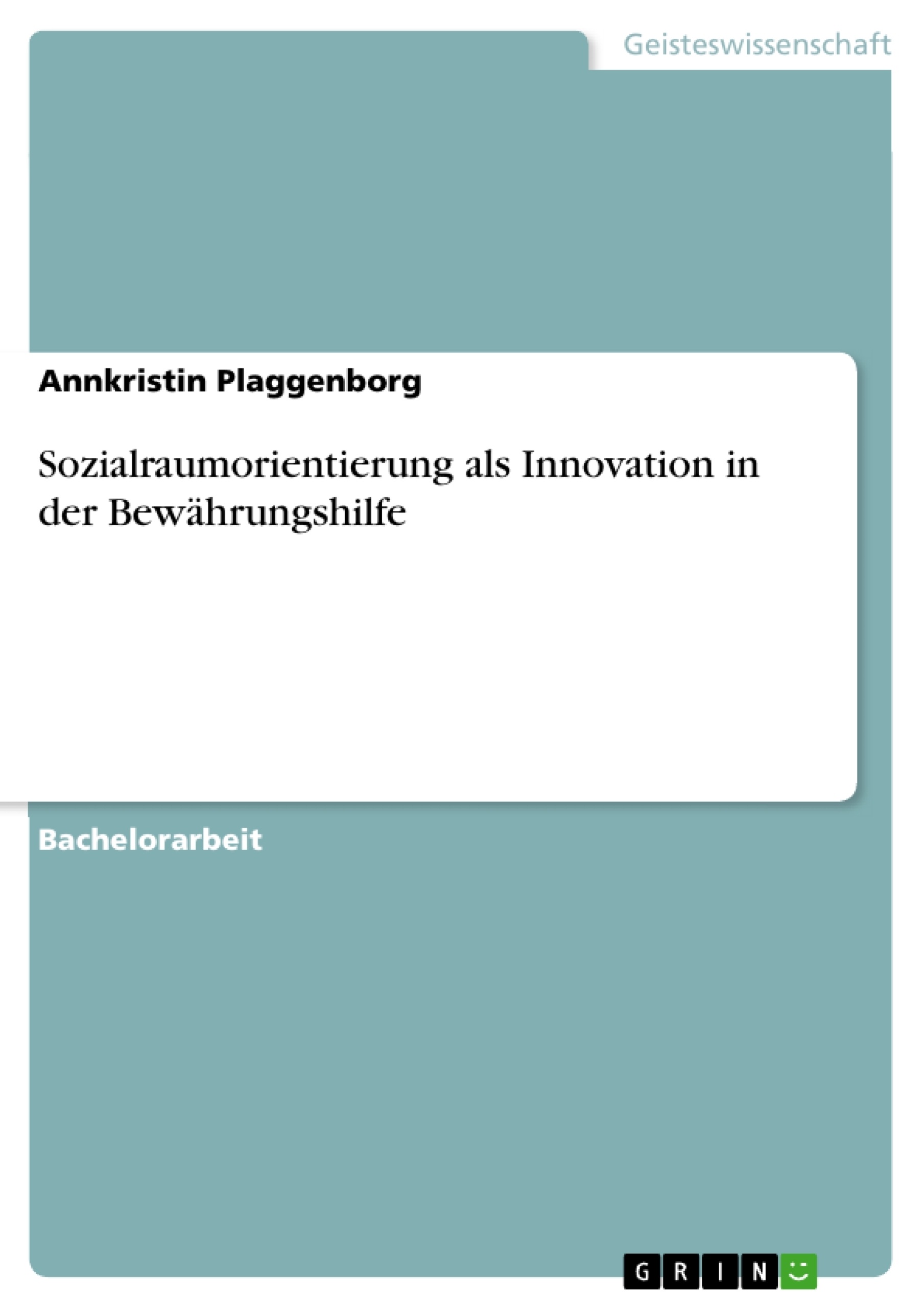Im Anbetracht immer komplexer werdender gesellschaftlicher, sozialer und infolgedessen gestiegener fachlicher Anforderungen und Entwicklungen, muss sich auch die Bewährungshilfe Änderungsprozessen stellen, die momentan für enorme Umbauprozesse in der gesamten Straffälligenhilfe sorgen.
Gegenstand der vorliegenden Ausarbeitung ist die Frage, ob das Fachkonzept der Sozialraumorientierung an genau diesem Punkt dem Anspruch einer fachlichen Innovation gerecht wird und in der Lage ist für grundlegende Verbesserung auf Seiten der Bewährungshilfe zu sorgen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Innovation: das Fachkonzept Sozialraumorientierung
- Die Entstehung des Fachkonzepts
- Sozialraumorientierung in der Tradition der Gemeinwesenarbeit (GWA)
- Institutionelle Inklusion
- Das SONI-Schema: Die vier Ebenen von Sozialraumorientierung
- Handlungsfeld Individuum
- Handlungsfeld Netzwerk
- Handlungsfeld Organisation
- Handlungsfeld Sozialstruktur
- Der Sozialraum
- Die Prinzipien des Fachkonzepts
- Konsequenter Orientierungspunkt: Wille der Betroffenen
- Unterstützung von Eigeninitiative und Selbsthilfe
- Der Fokus liegt auf den Ressourcen
- Zielgruppen- und bereichsübergreifende Sichtweisen
- Kooperation und Koordination
- Die Bewährungshilfe: ambulante Straffälligenhilfe im Zeichen sozialer Kontrolle
- Resozialisierung (Reso) und soziale Integration
- Zwischen Hilfe und Kontrolle: das doppelte Mandat
- Das Fachkonzept in Zeiten steigender Anforderungen
- Motivation im Zwangskontext
- Motivation als zu erarbeitender Prozess
- Wie Motivation entsteht
- Konsequenzen für sozialraumorientiertes Handeln
- Standardisierung von Hilfe und Kontrolle
- Case Management (CM)
- Der standardisierte Kontrollprozess nach Klug (2005/2007/2008)
- Risikoorientierte Bewährungshilfe (ROB)
- Übergangsmanagement
- Integrierte Resozialisierung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelorarbeit befasst sich mit der Sozialraumorientierung als fachliche Innovation in der Bewährungshilfe. Das Ziel der Arbeit ist es, die Entstehung und Entwicklung des Fachkonzepts Sozialraumorientierung zu analysieren, seine Prinzipien und Anwendungsmöglichkeiten in der Praxis zu beleuchten und schließlich seine Relevanz im Kontext der Bewährungshilfe zu diskutieren.
- Die Entstehung und Entwicklung des Fachkonzepts Sozialraumorientierung
- Die Prinzipien und Anwendungsmöglichkeiten der Sozialraumorientierung
- Die Herausforderungen der Bewährungshilfe im Kontext steigender Anforderungen
- Die Relevanz der Sozialraumorientierung für die Bewährungshilfe
- Die Integration der Sozialraumorientierung in bestehende Praxisansätze
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Bachelorarbeit ein und erläutert die Relevanz der Sozialraumorientierung in der Bewährungshilfe. Das zweite Kapitel behandelt die Entstehung und die Prinzipien des Fachkonzepts Sozialraumorientierung. Hierbei wird insbesondere auf die vier Ebenen des SONI-Schemas eingegangen, die die verschiedenen Handlungsfelder der Sozialraumorientierung beschreiben. Im dritten Kapitel wird die Bewährungshilfe als Feld der ambulanten Straffälligenhilfe vorgestellt, wobei die Herausforderungen des doppelten Mandats zwischen Hilfe und Kontrolle im Vordergrund stehen. Das vierte Kapitel widmet sich den Herausforderungen der Bewährungshilfe in Zeiten steigender Anforderungen. Hier werden Themen wie Motivation im Zwangskontext, Standardisierung von Hilfe und Kontrolle sowie Übergangsmanagement behandelt.
Schlüsselwörter
Sozialraumorientierung, Bewährungshilfe, Straffälligenhilfe, Gemeinwesenarbeit, Resozialisierung, soziale Integration, Motivation, Standardisierung, Übergangsmanagement, Case Management, Risikoorientierte Bewährungshilfe, SONI-Schema.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Fachkonzept der Sozialraumorientierung?
Die Sozialraumorientierung ist ein Ansatz in der sozialen Arbeit, der nicht nur das Individuum betrachtet, sondern dessen gesamtes Lebensumfeld (Netzwerk, Sozialstruktur) einbezieht, um Ressourcen zu aktivieren.
Was beschreibt das SONI-Schema?
Das SONI-Schema unterteilt die Sozialraumorientierung in vier Handlungsfelder: Sozialstruktur, Organisation, Netzwerk und Individuum. Es dient als Strukturmodell für die praktische Arbeit.
Welche Rolle spielt die Sozialraumorientierung in der Bewährungshilfe?
Sie fungiert als fachliche Innovation, um die Resozialisierung zu verbessern, indem sie über die reine Kontrolle hinausgeht und die soziale Integration im direkten Umfeld des Straffälligen fördert.
Was ist das „doppelte Mandat“ der Bewährungshilfe?
Bewährungshilfe steht stets im Spannungsfeld zwischen Hilfe (Unterstützung bei der Resozialisierung) und Kontrolle (Überwachung der gerichtlichen Auflagen).
Wie entsteht Motivation im Zwangskontext?
Motivation wird als Prozess verstanden, der durch die Ausrichtung am Willen der Betroffenen und die Konzentration auf vorhandene Ressourcen auch unter gerichtlichem Zwang gefördert werden kann.
- Quote paper
- Annkristin Plaggenborg (Author), 2015, Sozialraumorientierung als Innovation in der Bewährungshilfe, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/389040