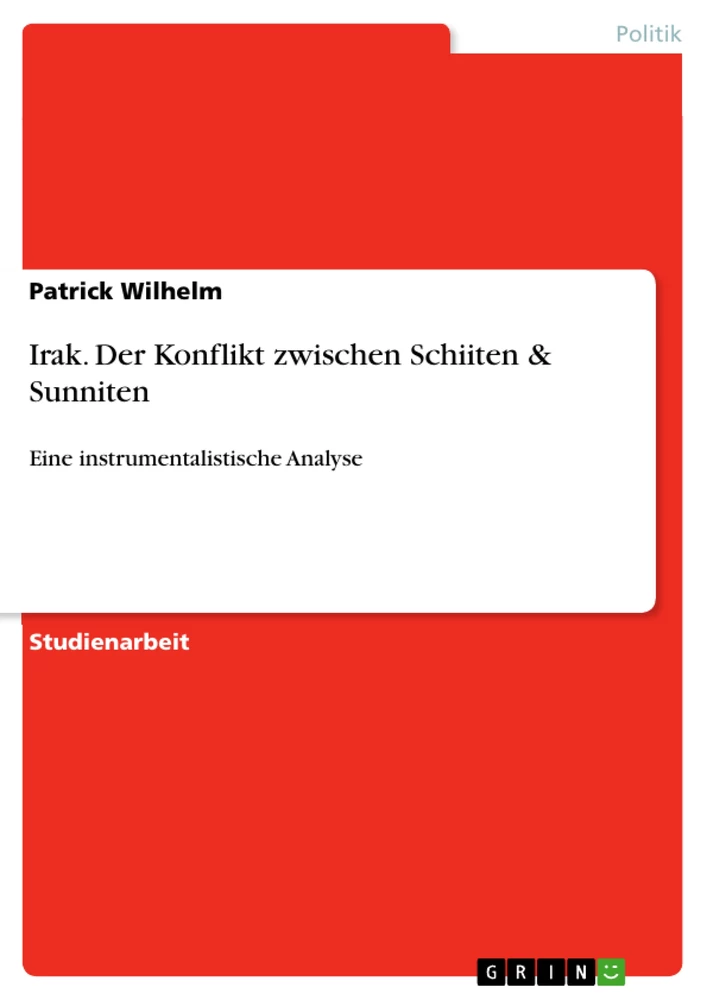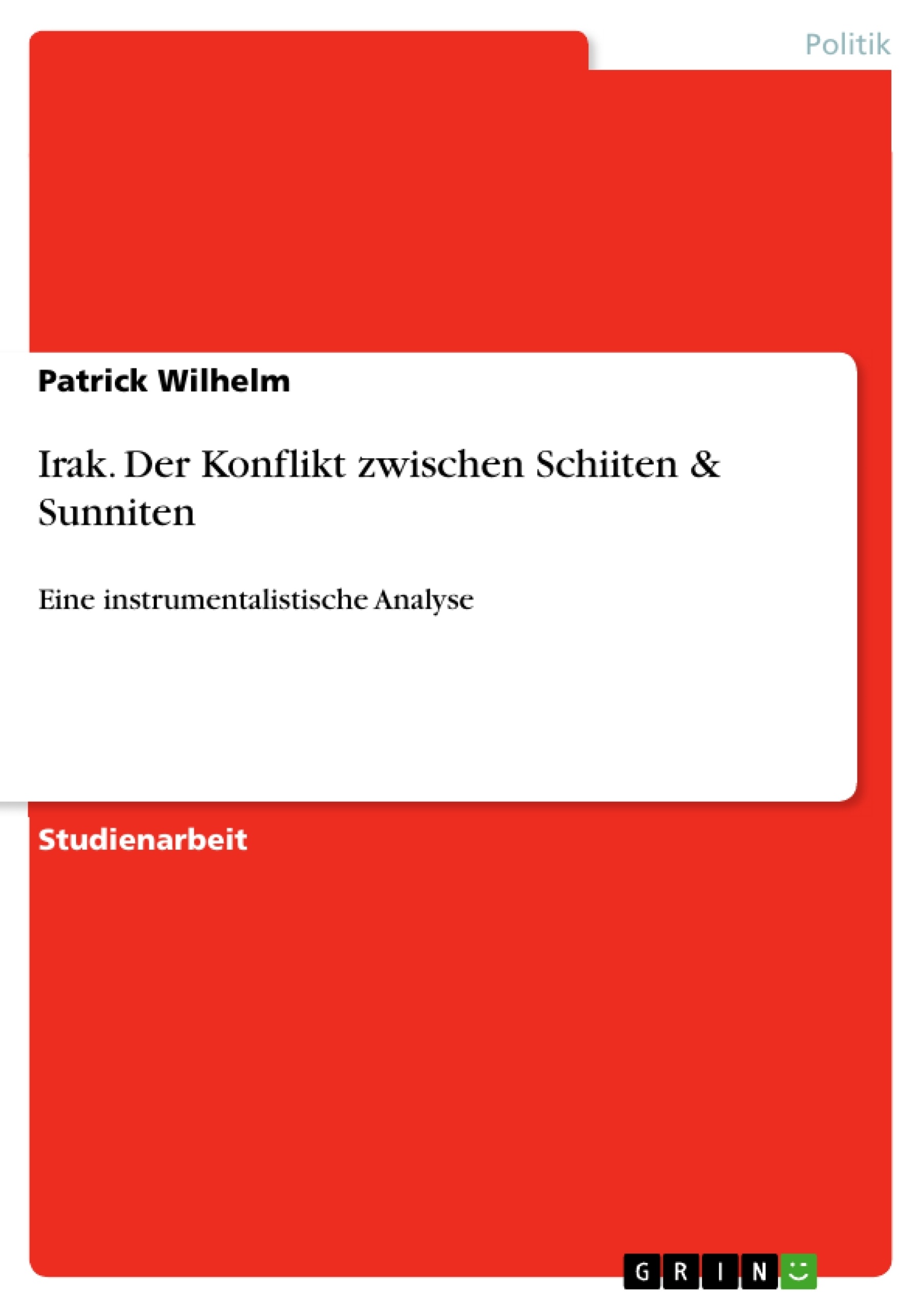Vorliegende wissenschaftliche Arbeit befasst sich mit der möglichen Konfessionalisierung von bereits vorhandenen gesellschaftlichen Konflikten. Ziel ist es, die Rolle und Wirkungskraft von Religion als Streitobjekt in einem Konflikt zu erfassen. Aktuell ist sowohl im Nahen als auch Mittleren Osten eine Renaissance von Konflikten zu beobachten, in denen religiöse Symbolik wieder verstärkt eine Rolle spielt. Es handelt sich hierbei um einen Typus von Konflikten, bei dem Religion beziehungsweise die verschiedenen Standpunkte von religiösen Glaubensgemeinschaften erst im Verlauf eines Konfliktes als Streitobjekt heranreifen. Religiöse Inhalte werden somit in vorhandene Auseinandersetzungen sozio-ökonomischer Natur implementiert. Es ist zu verzeichnen, dass konfessionalisierte Konflikte höheres Gewaltpotenzial als sozio-ökonomische Konflikte aufweisen. In der Fachliteratur sind die Bezeichnungen Fundamentalismus und religiöser Nationalismus für dieses Phänomen gängig (...)
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung und Fallauswahl
- 1. Theoretischer Teil:
- 2.1. Theorie und Hypothesen:
- 2.2. Das Instrumentalistische Konfliktmodell:
- 2.3. Operationalisierung:
- 2.4. Methodischer Zugang
- 3. Empirie:
- 3.1. Das Spannungsverhältnis der irakischen Gesellschaft während der Baath Epoche:
- 3.2. Irakkrieg 2003:
- 3.3. Konkurrenzkampf um die politische Führung der Nachkriegszeit
- 3.4. Die irakische Übergangsregierung und die Regierung Maliki
- 4. Analyseteil
- 5. Zusammenfassung und Fazit:
- 5.1 Ausblick:
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende wissenschaftliche Arbeit untersucht die mögliche Konfessionalisierung von bereits bestehenden gesellschaftlichen Konflikten. Das Ziel ist es, die Rolle und Wirkungskraft von Religion als Streitobjekt in einem Konflikt zu erfassen. Die Arbeit konzentriert sich auf die Renaissance von Konflikten im Nahen und Mittleren Osten, in denen religiöse Symbolik wieder zunehmend eine Rolle spielt, und analysiert, wie religiöse Inhalte in sozio-ökonomische Auseinandersetzungen integriert werden.
- Die Rolle und Wirkungskraft von Religion als Streitobjekt in Konflikten
- Die Konfessionalisierung von sozio-ökonomischen Konflikten
- Der Einfluss von Religion auf die Eskalation von Konflikten
- Die Instrumentalisierung von Religion durch politische Eliten
- Die Rolle der irakischen Regierung Nuri al-Maliki im Konflikt zwischen Sunniten und Schiiten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und die Zeitperiode des Konflikts im Irak vor. Der theoretische Teil analysiert das instrumentalistische Konfliktmodell, das Religion als abhängige Variable in bestehenden Konflikten betrachtet. Die Empirie beleuchtet das Spannungsverhältnis der irakischen Gesellschaft unter der Baath-Epoche, den Irakkrieg 2003, den Kampf um die politische Führung nach dem Krieg und die Rolle der irakischen Übergangsregierung und der Regierung Maliki. Der Analyseteil untersucht den Konflikt zwischen Sunniten und Schiiten im Irak unter der Herrschaft Nuri al-Maliki.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen Konfessionalisierung, Instrumentalisierung von Religion, sozio-ökonomische Konflikte, politische Eliten, irakischer Konflikt, Sunniten, Schiiten, Regierung Nuri al-Maliki. Der Fokus liegt auf der Analyse der Rolle von Religion im Konflikt und der Frage, ob Religion als Konfliktursache oder als Instrument zur Durchsetzung politischer Interessen fungiert.
- Quote paper
- Patrick Wilhelm (Author), 2017, Irak. Der Konflikt zwischen Schiiten & Sunniten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/388892