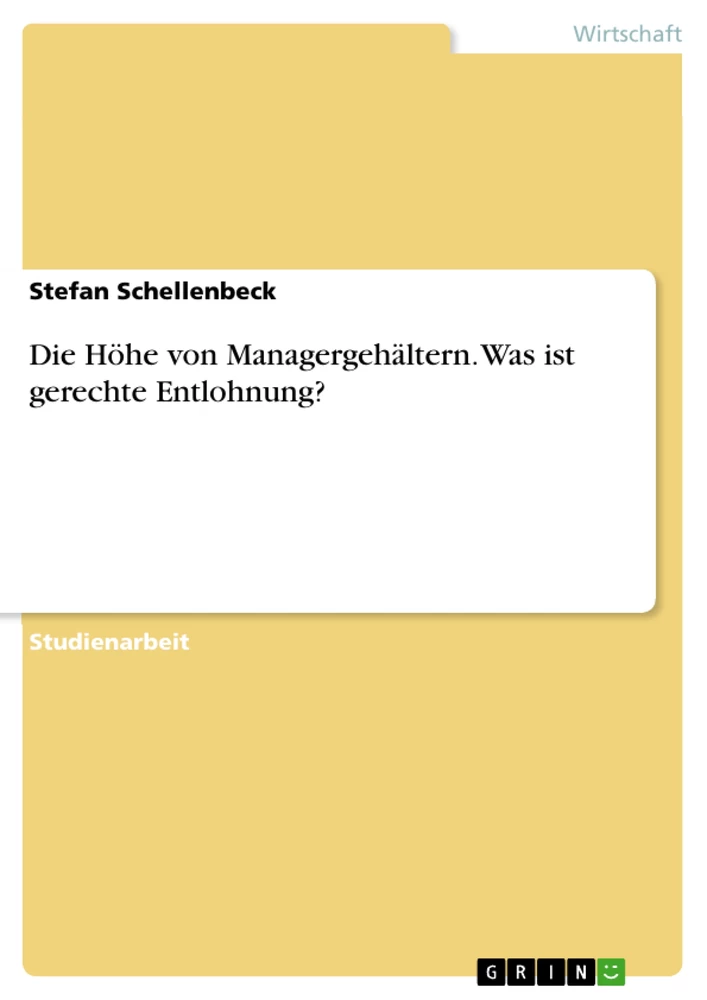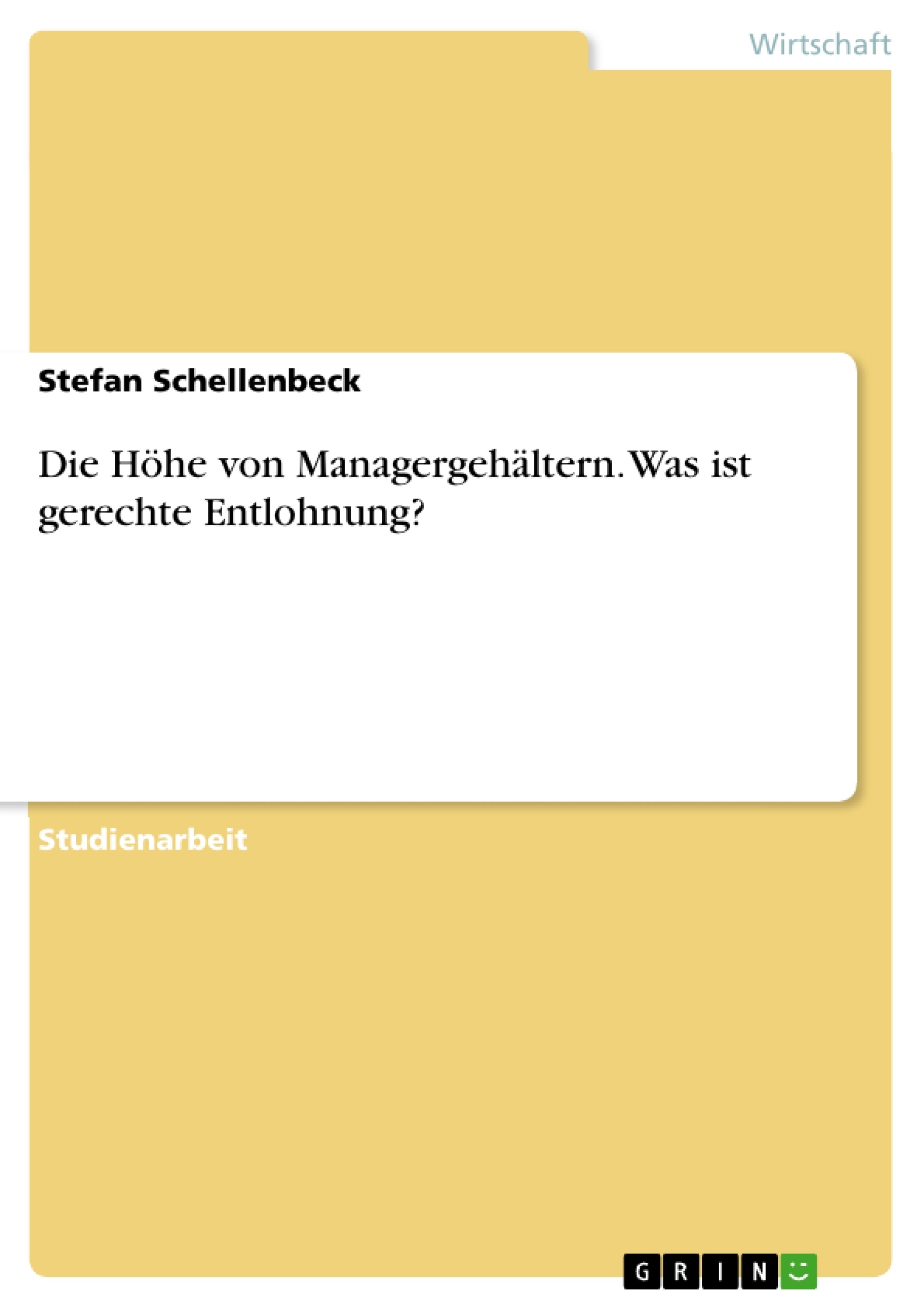Die derzeitige Debatte um eine gerechte Entlohnung von Top-Managern steht seit den Neunzigerjahren immer wieder in der Öffentlichkeit unter Kritik. Dabei wird vor allem die Vergütung von DAX-Vorständen kontrovers diskutiert. Wie lässt sich das Gehalt von Herr Winterkorn legitimieren, der zeitweise bis zu 17 Millionen Euro jährlich und damit mehr als 140mal so viel eingenommen hat, wie ein durchschnittlicher Arbeitnehmer?
"Wer mehr Verantwortung trage, solle auch mehr verdienen als andere. Aber wenn Vergütungen und Boni in Millionenhöhe gezahlt werden, obwohl Gewinne sinken oder Beschäftigte entlassen werden müssen, haben die Menschen zu Recht das Gefühl, dass dort jedes Maß verloren gegangen ist.", entgegnet Bundesjustizminister Maas dem Spiegel im Februar 2017. Kurze Zeit zuvor legte SPD-Fraktionschef Oppermann ein Gesetzentwurf zur Mäßigung von Managergehältern vor, mit dem er den stetigen Anstieg der empfundenen Einkommensungerechtigkeit der Gesellschaft bezüglich der Mangerentlohnung entgegenwirken möchte.
Die Wichtigkeit dieser Thematik zeigt sich vor allem darin, dass ein gesellschaftlich gestörtes Gerechtigkeitsempfinden negativen Einfluss auf Moral und Verhalten haben kann, welches der Volkswirtschaft immens schadet.
Aber was ist überhaupt eine gerechte Entlohnung? Welche Argumente sprechen für und welche gegen die Legitimität hoher Managergehälter? Welche Änderungen können zu einer höheren Lohngerechtigkeit führen? Die Seminararbeit hat sich den Anspruch gesetzt, diese Forschungsfragen zu untersuchen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Grundlagen zum Managergehalt
- 2.1 Zusammensetzung des Managerlohns
- 2.2 Lohnentwicklung
- 3. Begriffsbestimmung Gerechtigkeit
- 3.1 Prinzipien der distributiven Gerechtigkeit
- 3.2 Typen der Lohngerechtigkeit
- 4. Analyse der Legitimität hoher Managergehälter
- 4.1 Pay for performance
- 4.2 Marktthese
- 4.3 Anforderungs- & Qualifikationsgerechtigkeit
- 4.4 Pay without performance
- 5. Resümee
- 6. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Legitimität hoher Managergehälter. Die Arbeit analysiert die Zusammensetzung und Entwicklung von Managergehältern, beleuchtet verschiedene Gerechtigkeitsprinzipien und -typen und bewertet die Legitimität hoher Gehälter im Kontext dieser Prinzipien. Die zentrale Frage ist, was eine gerechte Entlohnung für Manager darstellt.
- Zusammensetzung und Entwicklung von Managergehältern
- Verschiedene Theorien und Prinzipien der Gerechtigkeit
- Bewertung der Legitimität hoher Managergehälter anhand von Gerechtigkeitsprinzipien
- Diskussion von "Pay for Performance" und "Pay without Performance"
- Mögliche Änderungen zur Steigerung der Lohngerechtigkeit
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die aktuelle Debatte um die Höhe von Managergehältern in den Mittelpunkt und verweist auf die kontroverse Diskussion, insbesondere im Kontext der Vergütungen von DAX-Vorständen. Sie hebt die Diskrepanz zwischen den Gehältern von Top-Managern und Durchschnittsarbeitnehmern hervor und zitiert kritische Stimmen aus der Politik, die auf die empfundene Einkommensungerechtigkeit hinweisen und die negativen gesellschaftlichen Folgen betonen. Die Arbeit formuliert die zentralen Forschungsfragen, die im weiteren Verlauf beantwortet werden sollen.
2. Grundlagen zum Managergehalt: Dieses Kapitel beleuchtet die Grundlagen der Managerentlohnung. Es analysiert die Zusammensetzung des Managerlohns, unterscheidet zwischen fixen und variablen Lohnkomponenten und berücksichtigt Nebenleistungen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Lohnentwicklung, sowohl absolut als auch im Verhältnis zu den Gehältern von Arbeitnehmern (Manager-to-Worker Pay Ratio). Das Kapitel liefert die notwendigen Fakten und Daten, um die spätere Diskussion um die Gerechtigkeit der Managergehälter fundiert zu führen.
3. Begriffsbestimmung Gerechtigkeit: Das Kapitel widmet sich einer wissenschaftlichen Untersuchung des Begriffs "Gerechtigkeit". Es differenziert zwischen verschiedenen Prinzipien der distributiven Gerechtigkeit (Beitragsprinzip, Bedarfs- und Sozialprinzip, Gleichheitsprinzip) und analysiert verschiedene Typen der Lohngerechtigkeit (Leistungsgerechtigkeit, Marktgerechtigkeit, Anforderungs-, Qualifikations- und Erfolgsgerechtigkeit). Diese differenzierte Betrachtung bildet die Grundlage für die spätere Bewertung der Legitimität hoher Managergehälter.
4. Analyse der Legitimität hoher Managergehälter: Aufbauend auf den vorherigen Kapiteln analysiert dieses Kapitel die Legitimität hoher Managergehälter. Es untersucht verschiedene Erklärungsansätze, wie "Pay for Performance" und die "Marktthese", und bewertet die Anforderungs- und Qualifikationsgerechtigkeit. Zudem wird der Fall von "Pay without Performance" betrachtet, der die Kritik an überhöhten Managergehältern stützt. Diese Analyse verbindet die empirischen Befunde mit den theoretischen Gerechtigkeitsprinzipien aus Kapitel 3.
Schlüsselwörter
Managergehälter, Lohngerechtigkeit, distributive Gerechtigkeit, Leistungsgerechtigkeit, Marktgerechtigkeit, Anforderungs- und Qualifikationsgerechtigkeit, Pay for Performance, Pay without Performance, Manager-to-Worker Pay Ratio, DAX-Vorstände, Einkommensungleichheit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Legitimität hoher Managergehälter
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die Legitimität hoher Managergehälter. Sie analysiert die Zusammensetzung und Entwicklung von Managergehältern, verschiedene Gerechtigkeitsprinzipien und -typen und bewertet die Legitimität hoher Gehälter im Kontext dieser Prinzipien. Die zentrale Frage ist, was eine gerechte Entlohnung für Manager darstellt.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Zusammensetzung und Entwicklung von Managergehältern, verschiedene Theorien und Prinzipien der Gerechtigkeit (distributive Gerechtigkeit, Leistungsgerechtigkeit, Marktgerechtigkeit, Anforderungs-, Qualifikations- und Erfolgsgerechtigkeit), die Bewertung der Legitimität hoher Managergehälter anhand von Gerechtigkeitsprinzipien, "Pay for Performance" und "Pay without Performance" sowie mögliche Änderungen zur Steigerung der Lohngerechtigkeit.
Wie ist die Seminararbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung, Grundlagen zum Managergehalt (Zusammensetzung und Lohnentwicklung), Begriffsbestimmung Gerechtigkeit (Prinzipien der distributiven Gerechtigkeit und Typen der Lohngerechtigkeit), Analyse der Legitimität hoher Managergehälter ("Pay for Performance", Marktthese, Anforderungs- & Qualifikationsgerechtigkeit, "Pay without Performance"), Resümee und Schlussbetrachtung. Zusätzlich beinhaltet sie ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und Schlüsselwörter.
Was wird unter "Pay for Performance" und "Pay without Performance" verstanden?
Die Arbeit untersucht diese beiden Konzepte im Kontext der Legitimität hoher Managergehälter. "Pay for Performance" beschreibt eine Vergütung, die an die erbrachte Leistung gekoppelt ist. "Pay without Performance" hingegen bezeichnet Situationen, in denen hohe Gehälter unabhängig von der tatsächlichen Leistung gezahlt werden.
Welche Gerechtigkeitsprinzipien werden betrachtet?
Die Arbeit analysiert verschiedene Prinzipien der distributiven Gerechtigkeit, darunter das Beitragsprinzip, das Bedarfs- und Sozialprinzip und das Gleichheitsprinzip. Des Weiteren werden verschiedene Typen der Lohngerechtigkeit wie Leistungsgerechtigkeit, Marktgerechtigkeit, Anforderungs-, Qualifikations- und Erfolgsgerechtigkeit untersucht.
Welche Daten und Fakten werden verwendet?
Das Kapitel zu den Grundlagen des Managergehalts liefert Fakten und Daten zur Zusammensetzung des Managerlohns (fixe und variable Komponenten, Nebenleistungen) und zur Lohnentwicklung (absolut und im Verhältnis zu den Gehältern von Arbeitnehmern – Manager-to-Worker Pay Ratio).
Welche Schlussfolgerungen zieht die Seminararbeit?
Die Schlussfolgerungen der Seminararbeit werden im Resümee und der Schlussbetrachtung zusammengefasst. Die Arbeit bewertet die Legitimität hoher Managergehälter im Kontext der analysierten Gerechtigkeitsprinzipien und diskutiert mögliche Ansätze zur Verbesserung der Lohngerechtigkeit.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Managergehälter, Lohngerechtigkeit, distributive Gerechtigkeit, Leistungsgerechtigkeit, Marktgerechtigkeit, Anforderungs- und Qualifikationsgerechtigkeit, Pay for Performance, Pay without Performance, Manager-to-Worker Pay Ratio, DAX-Vorstände, Einkommensungleichheit.
- Quote paper
- Stefan Schellenbeck (Author), 2018, Die Höhe von Managergehältern. Was ist gerechte Entlohnung?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/388820