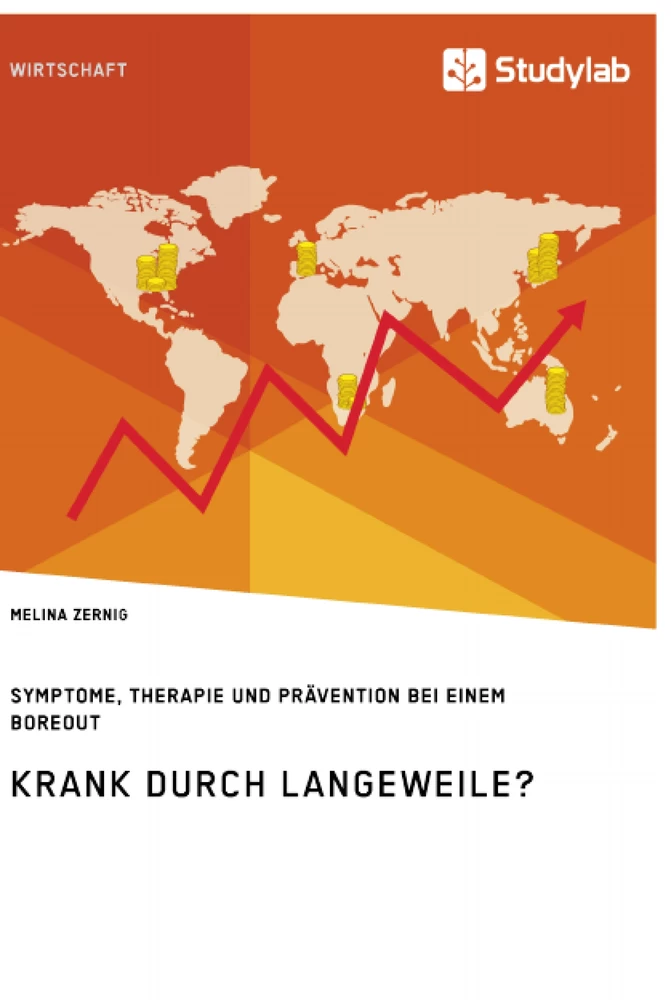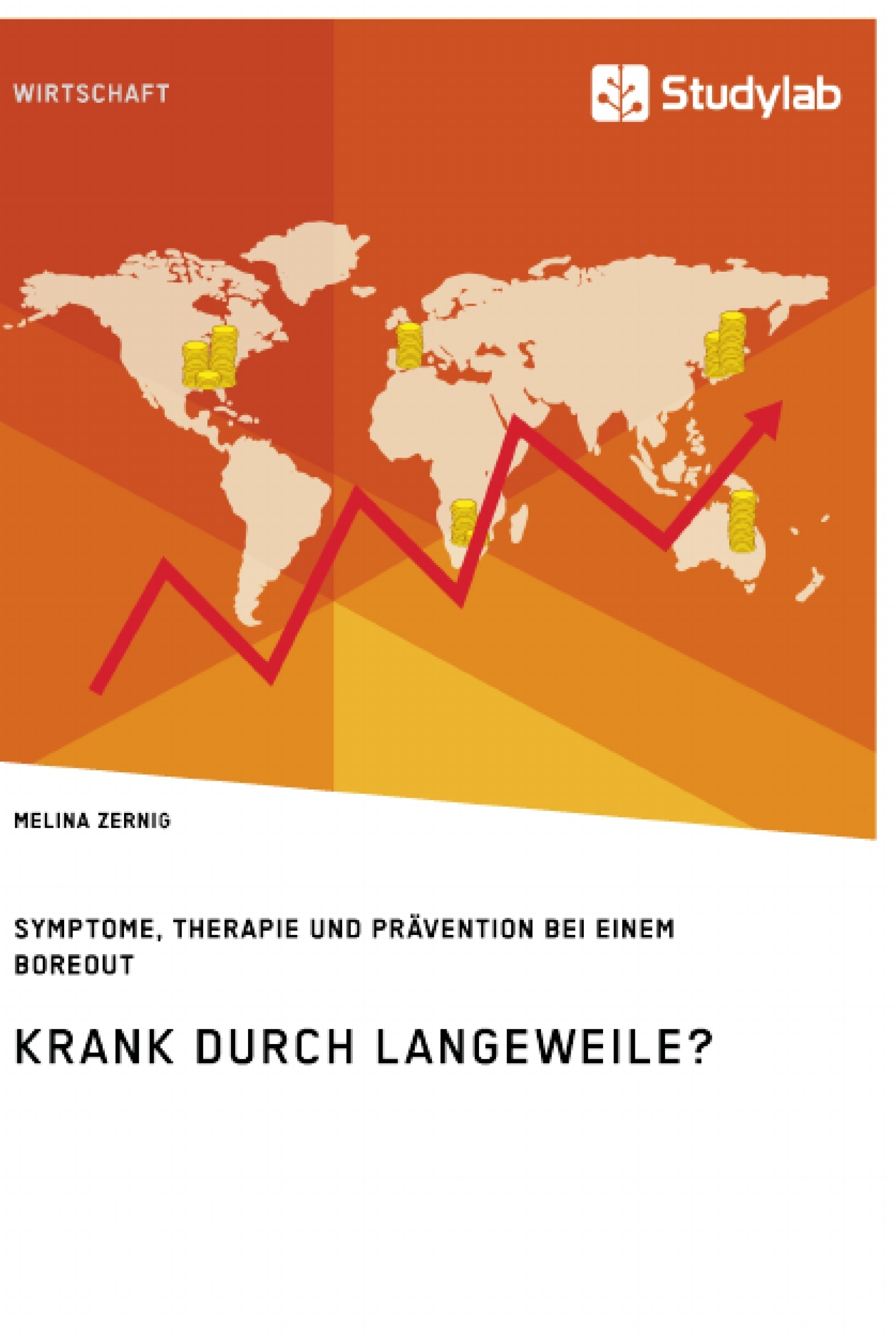Langeweile macht krank. Der sogenannte Boreout ist eine psychische Berufskrankheit, die schwere Folgen für Unternehmen und betroffene Mitarbeiter hat. Doch bisher ist er trotzdem kaum bekannt und wird häufig mit dem in den Medien präsenteren Burnout verwechselt. Beim Boreout entsteht aus einer langfristigen Unterforderung ein Syndrom aus Langeweile, Desinteresse und Gefühl der Sinnlosigkeit. Es gibt jedoch Mittel und Wege, um dieser Erkrankung vorzubeugen.
Die Autorin Melina Zernig beschreibt in ihrer Publikation deshalb nicht nur die Erscheinungsformen, sondern auch Ansätze für die Prävention im Unternehmen. Sie erklärt, wie man einen Boreout bei sich selbst oder seinen Mitarbeitern erkennt und wie man ihn heilt. Denn dazu ist es in erster Linie notwendig, dass Betroffene ihre eigene Verantwortung wahrnehmen. Das Buch richtet sich an Arbeitgeber und Arbeitnehmer, die sich über die Prävention eines Boreouts und den Umgang mit der Erkrankung informieren möchten.
Aus dem Inhalt:
- Boreout;
- Burnout;
- Berufskrankheit;
- Prävention;
- Mitarbeitergesundheit
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Begriffsklärung
- 3 Abgrenzung Boreout / Burnout
- 4 Symptomatik
- 5 Coping - Strategien
- 6 Zeit
- 7 Bewältigung
- 8 Innere Kündigung
- 8.1 Kommunikation negativer Inhalte
- 8.2 Sinnfrage
- 8.3 Hierarchische Strukturen
- 8.4 Missachtung stiller Verträge
- 8.5 Wertschätzungsmangel
- 8.6 Bürokratie
- 8.7 Sozialer Status
- 9 Boreout-Paradox
- 10 Betriebe als mittelbar Betroffene
- 11 Ansätze für eine persönliche Boreout-Prävention
- 11.1 Eigenverantwortung
- 11.2 Qualitativer Lohn
- 11.3 Element Sinn
- 11.4 Element Zeit
- 11.5 Element Geld
- 11.6 Coaching für Betroffene
- 12 Ansätze für eine betriebliche Boreout-Prävention
- 12.1 Vertrauen ist gut... Ist Kontrolle besser?
- 12.2 Unternehmenskultur
- 12.3 Betriebliche Gesundheitsförderung
- 12.4 Betriebliche Gesundheitsförderung in Klein- und Kleinstbetrieben
- 13 Kurzer Blick auf die Kritik am Boreout
- 14 Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit beschreibt das Phänomen Boreout ausgehend von dem Standardwerk von Rothlin & Werder, „Unterfordert, Diagnose Boreout Wenn Langeweile krank macht“. Ziel ist es, die individuellen und betrieblichen Auswirkungen von Boreout zu beleuchten und Ansätze für die Prävention sowohl auf persönlicher als auch auf betrieblicher Ebene aufzuzeigen. Scheinlösungen werden kritisch hinterfragt und die Eigenverantwortung der Betroffenen betont.
- Definition und Abgrenzung von Boreout und Burnout
- Symptome und Bewältigungsstrategien von Boreout
- Auswirkungen von Boreout auf den Einzelnen und den Betrieb
- Ansätze zur persönlichen Boreout-Prävention
- Ansätze zur betrieblichen Boreout-Prävention
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Dieses Kapitel führt in das Thema Boreout ein und gibt einen Überblick über die Struktur und den Inhalt der Arbeit. Es skizziert die Bedeutung des Themas und die Notwendigkeit der Auseinandersetzung mit den Ursachen und Folgen von Langeweile am Arbeitsplatz.
2 Begriffsklärung: Hier wird der Begriff Boreout präzise definiert und von verwandten Konzepten wie Burnout abgegrenzt. Die Kapitel erläutert die zentralen Merkmale und die diagnostischen Kriterien des Boreout-Syndroms. Eine klare Definition ist essentiell, um Boreout von anderen stressbezogenen Phänomenen zu unterscheiden und angemessene Interventionsstrategien zu entwickeln.
3 Abgrenzung Boreout / Burnout: Dieser Abschnitt vergleicht und kontrastiert Boreout und Burnout, um die spezifischen Unterschiede und Überschneidungen dieser beiden Phänomene zu beleuchten. Die Unterscheidung ist wichtig, um jeweils passende Präventions- und Interventionsmaßnahmen zu entwickeln. Der Fokus liegt auf der Analyse der unterschiedlichen Ursachen, Symptome und Folgen beider Zustände.
4 Symptomatik: Dieses Kapitel beschreibt detailliert die vielfältigen Symptome eines Boreouts. Es werden sowohl körperliche als auch psychische Symptome behandelt, um ein umfassendes Bild der Auswirkungen von chronischer Unterforderung zu liefern. Die Beschreibung der Symptome dient als Grundlage für die spätere Diskussion von Präventions- und Interventionsmöglichkeiten.
5 Coping - Strategien: Der Abschnitt analysiert verschiedene Bewältigungsstrategien, die Betroffene einsetzen, um mit den Herausforderungen eines Boreouts umzugehen. Es wird untersucht, welche Strategien effektiv sind und welche möglicherweise kontraproduktiv wirken. Die Analyse dient dazu, Betroffene bei der Entwicklung gesundheitsfördernder Bewältigungsmechanismen zu unterstützen.
6 Zeit: Das Kapitel beleuchtet die Rolle der Zeit und der Zeiteinteilung im Kontext von Boreout. Es wird untersucht, wie eine ungünstige Zeiteinteilung oder ein Mangel an Gestaltungsspielraum zu Boreout beitragen kann. Die Bedeutung von Zeitmanagement und die Gestaltung von Arbeitsabläufen werden erörtert.
7 Bewältigung: Dieses Kapitel befasst sich mit verschiedenen Ansätzen zur Bewältigung eines Boreouts. Es werden sowohl individuelle als auch betriebliche Strategien zur Verbesserung der Arbeitssituation und des Wohlbefindens der Betroffenen vorgestellt und diskutiert. Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung von Lösungsansätzen.
8 Innere Kündigung: Hier wird das Phänomen der inneren Kündigung im Zusammenhang mit Boreout analysiert. Die verschiedenen Ursachen und Auswirkungen der inneren Kündigung werden beleuchtet und Strategien zur Vermeidung bzw. Bewältigung dieses Problems werden diskutiert. Der Abschnitt unterstreicht die Wichtigkeit der frühzeitigen Erkennung und Intervention.
9 Boreout-Paradox: In diesem Kapitel wird das Paradoxon des Boreouts thematisiert – die scheinbare Unvereinbarkeit von Langeweile und den negativen Folgen für die Gesundheit. Es werden die Mechanismen erörtert, die dazu führen, dass chronische Unterforderung negative Auswirkungen hat, obwohl sie auf den ersten Blick weniger belastend erscheint als Überforderung.
10 Betriebe als mittelbar Betroffene: Dieser Abschnitt zeigt auf, welche Auswirkungen Boreout auf Unternehmen hat. Es werden die wirtschaftlichen und sozialen Folgen von Boreout für Betriebe betrachtet und Strategien zur Vermeidung bzw. Minderung dieser Folgen diskutiert.
11 Ansätze für eine persönliche Boreout-Prävention: Das Kapitel widmet sich individuellen Strategien zur Prävention von Boreout. Es werden verschiedene Ansätze vorgestellt, die Betroffenen helfen sollen, sich vor Boreout zu schützen und ihre Arbeitszufriedenheit zu steigern. Der Schwerpunkt liegt auf der Eigenverantwortung und der aktiven Gestaltung der eigenen Arbeitswelt.
12 Ansätze für eine betriebliche Boreout-Prävention: Hier werden betriebliche Maßnahmen zur Prävention von Boreout vorgestellt und diskutiert. Es werden Strategien zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen, der Unternehmenskultur und der betrieblichen Gesundheitsförderung erörtert. Der Fokus liegt auf der Schaffung eines Arbeitsumfelds, das Boreout vorbeugt.
13 Kurzer Blick auf die Kritik am Boreout: Dieses Kapitel setzt sich kritisch mit dem Konzept des Boreouts auseinander und beleuchtet mögliche Einwände und Kritikpunkte an der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit diesem Phänomen. Eine kritische Auseinandersetzung ist wichtig, um die Grenzen des Konzepts zu erkennen und die Forschungsarbeit weiterzuentwickeln.
Schlüsselwörter
Boreout, Burnout, Langeweile, Unterforderung, Sinnlosigkeit, Desinteresse, Prävention, Gesundheitsförderung, Unternehmenskultur, Eigenverantwortung, betriebliche Maßnahmen, individuelle Strategien, Coping, innere Kündigung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Unterfordert, Diagnose Boreout: Wenn Langeweile krank macht"
Was ist das Thema des Dokuments?
Das Dokument behandelt das Phänomen Boreout, seine Ursachen, Symptome, Auswirkungen und Präventionsmöglichkeiten auf individueller und betrieblicher Ebene. Es vergleicht Boreout mit Burnout und analysiert kritisch das Konzept des Boreout.
Welche Kapitel umfasst das Dokument?
Das Dokument gliedert sich in 14 Kapitel: Einleitung, Begriffsklärung, Abgrenzung Boreout/Burnout, Symptomatik, Coping-Strategien, Zeit, Bewältigung, Innere Kündigung (inkl. Unterkapitel zu Kommunikation, Sinnfrage, Hierarchien etc.), Boreout-Paradox, Betriebe als mittelbar Betroffene, Ansätze zur persönlichen Boreout-Prävention, Ansätze zur betrieblichen Boreout-Prävention, Kurzer Blick auf die Kritik am Boreout und Ausblick.
Wie wird Boreout definiert und von Burnout abgegrenzt?
Das Dokument bietet eine präzise Definition von Boreout und grenzt es klar von Burnout ab. Es werden die zentralen Merkmale und diagnostischen Kriterien des Boreout-Syndroms erläutert, um es von anderen stressbezogenen Phänomenen zu unterscheiden.
Welche Symptome werden bei Boreout beschrieben?
Das Dokument beschreibt detailliert die vielfältigen körperlichen und psychischen Symptome eines Boreouts, um ein umfassendes Bild der Auswirkungen chronischer Unterforderung zu liefern.
Welche Coping-Strategien werden behandelt?
Der Text analysiert verschiedene Bewältigungsstrategien von Betroffenen, untersucht deren Effektivität und gibt Hinweise auf gesundheitsfördernde Mechanismen.
Welche Rolle spielt die Zeit beim Boreout?
Das Kapitel "Zeit" beleuchtet den Einfluss von Zeiteinteilung und Gestaltungsspielraum auf die Entstehung von Boreout und betont die Bedeutung von Zeitmanagement.
Wie wird das Phänomen der "Inneren Kündigung" im Kontext von Boreout behandelt?
Das Dokument analysiert die innere Kündigung als Folge von Boreout, beleuchtet die Ursachen und Auswirkungen und diskutiert Strategien zur Vermeidung und Bewältigung.
Was ist das Boreout-Paradox?
Der Text beschreibt das Paradox, dass Langeweile trotz des scheinbar geringeren Stresses negative gesundheitliche Folgen haben kann.
Welche Auswirkungen hat Boreout auf Betriebe?
Das Dokument untersucht die wirtschaftlichen und sozialen Folgen von Boreout für Unternehmen und diskutiert Strategien zur Minderung dieser Folgen.
Welche Ansätze zur persönlichen und betrieblichen Boreout-Prävention werden vorgestellt?
Der Text präsentiert individuelle Strategien zur Prävention (Eigenverantwortung, qualitativer Lohn, Sinnfindung etc.) und betriebliche Maßnahmen (Vertrauen, Unternehmenskultur, Betriebliche Gesundheitsförderung).
Wie wird die Kritik am Boreout-Konzept behandelt?
Das Dokument setzt sich kritisch mit dem Konzept auseinander und beleuchtet Einwände und Kritikpunkte.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter sind: Boreout, Burnout, Langeweile, Unterforderung, Sinnlosigkeit, Desinteresse, Prävention, Gesundheitsförderung, Unternehmenskultur, Eigenverantwortung, betriebliche Maßnahmen, individuelle Strategien, Coping, innere Kündigung.
Welche Zielsetzung verfolgt der Text?
Ziel ist es, die individuellen und betrieblichen Auswirkungen von Boreout zu beleuchten und Ansätze für die Prävention auf persönlicher und betrieblicher Ebene aufzuzeigen. Scheinlösungen werden kritisch hinterfragt, die Eigenverantwortung der Betroffenen betont.
- Quote paper
- Melina Zernig (Author), 2017, Krank durch Langeweile? Symptome, Therapie und Prävention bei einem Boreout, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/388785