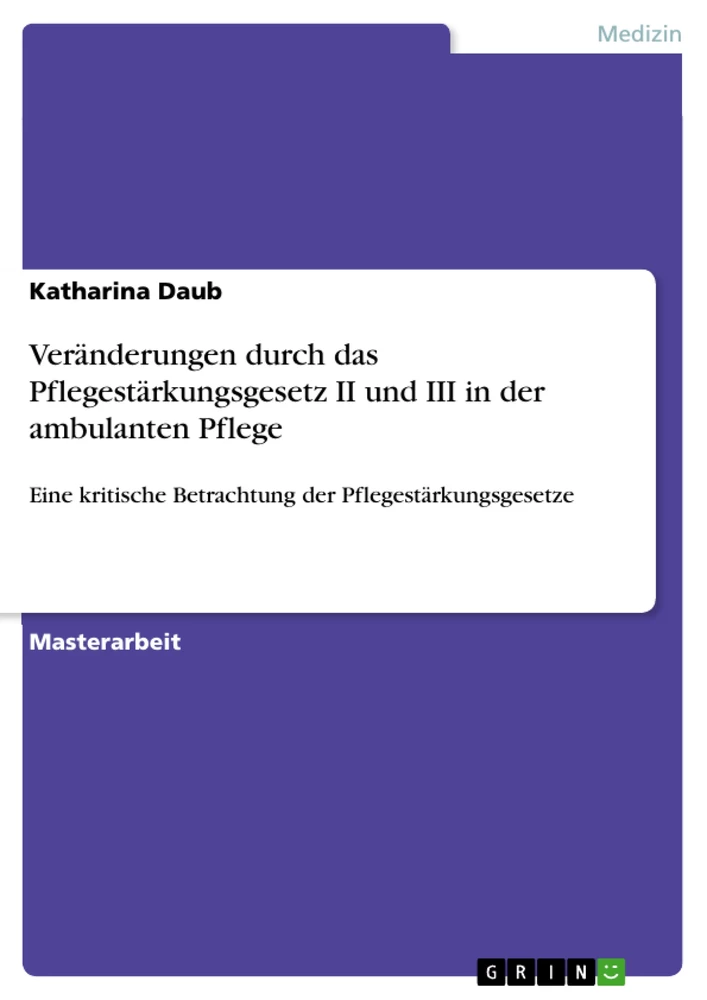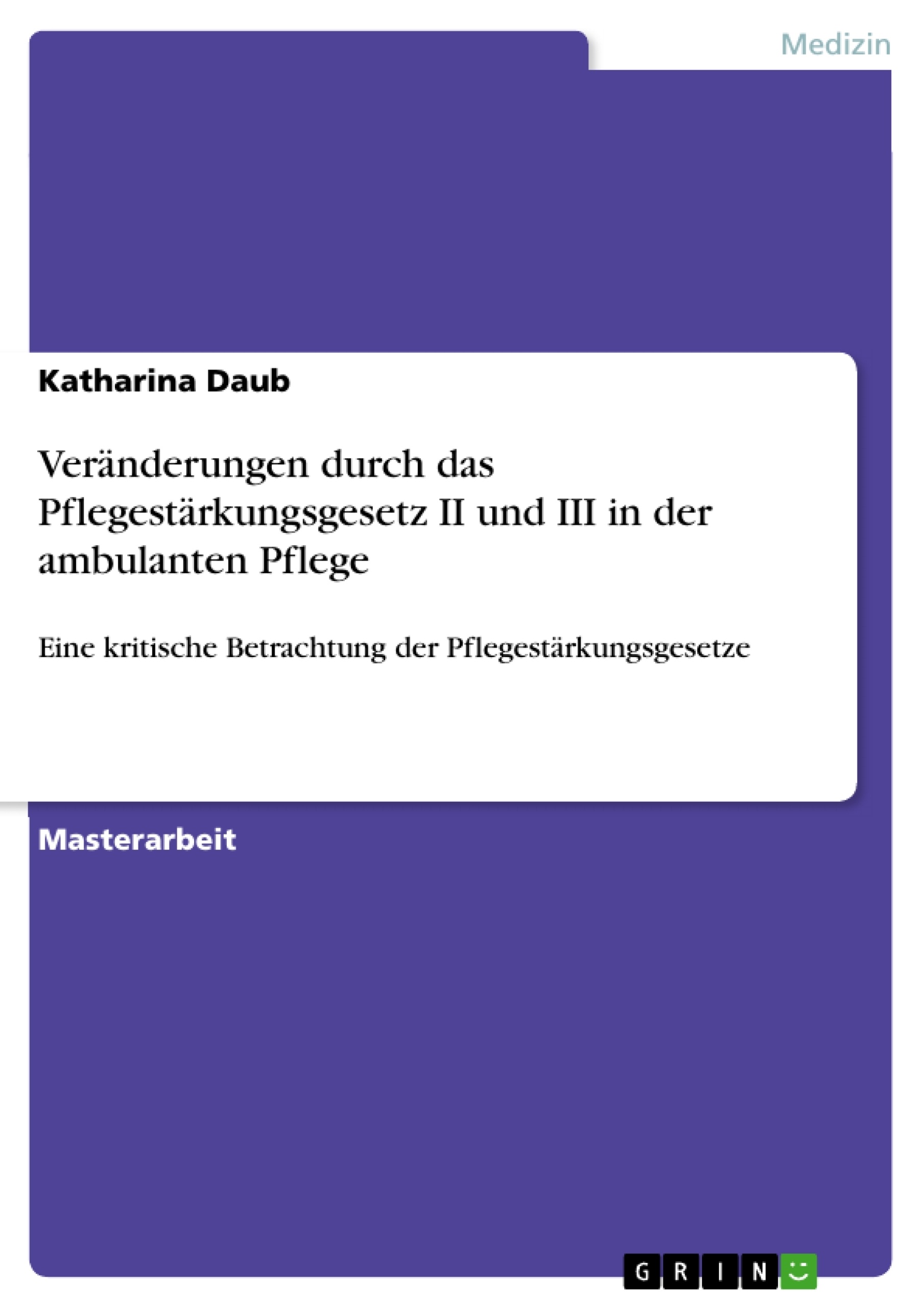Die Pflegestärkungsgesetze II und III wurden im Jahr 2016 und 2017 in Deutschland eingeführt. Im Jahr 2017 kam es zu grundlegenden Veränderungen in der Pflegeversicherung. Es wurde ein neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff eingeführt. Dieser brachte außerdem ein neues Begutachtungsassessment mit, nach dem die Einstufungen vorgenommen werden. Die bisherigen drei Pflegestufen wurden in fünf Pflegegrade überführt. Dadurch kam es zu Anpassungen in den Leistungsbezügen und den Leistungsansprüchen. Die §§ 45 a - d SGB XI wurden deutlich verändert.
Der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff, mit den dazugehörigen sechs Modulen, muss in der ambulanten Pflege Anwendung finden. Der Pflegebedürftigkeitsbegriff geht weg vom bisherigen Verrichtungsbezug. Außerdem kam es zu Veränderungen in der Qualitätsprüfung. Hier wird nun auch die Abrechnung durch den MDK überprüft. Ebenfalls kam es zu Anpassungen in der Pflegeberatung. Für ambulante Pflegedienste kam eine positive Veränderung, die arbeitstariflichen Steigerungen, dürfen durch die Kassen, nicht mehr als unwirtschaftlich betrachtete werden. Hier gilt es in Einzelverhandlungen diesen Vorteil zu nutzen. Um die relevanten Anpassungen für die ambulante Pflege herauszuarbeiten wurde eine Literaturrecherche durchgeführt.
Bearbeitet werden in dieser Arbeit folgende Fragestellungen: Mit welchen Auswirkungen können die Pflegestärkungsgesetze für die ambulante Pflege verbunden sein? An welchen Stellen kann die Reform - aus Sicht der ambulanten Pflege - kritisch gesehen werden? Die Fragen können nicht immer eindeutig beantwortet werden. So ist bspw. der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff gut erarbeitet worden. Insgesamt scheint die Pflegeversicherung durch das hohe Maß an Flexibilität jedoch sehr unübersichtlich geworden zu sein. Für die Leistungsempfänger wird es schwer, diese vollständig zu durchblicken. Hier bedarf es einer guten fachlichen Beratung.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Themenbegründung
- Aufbau der Arbeit
- Methode
- Die Veränderungen durch das Pflegestärkungsgesetz II
- Der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff
- Ermittlung der Pflegebedürftigkeit
- Modul 1: Mobilität
- Modul 2: Kognitive und Kommunikative Fähigkeiten
- Modul 3: Verhaltensweisen und psychische Problemlagen
- Modul 4: Selbstversorgung
- Modul 5: Bewältigung von und selbstständiger Umgang mit krankheits- und therapiebedingten Anforderungen
- Modul 6: Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte
- Umstellung von Pflegestufen in Pflegegrade
- Leistungen der Pflegeversicherung im Überblick
- Pflegesachleistung
- Pflegegeld für selbst beschaffte Pflegehilfen
- Kombination von Geldleistung und Sachleistung
- Häusliche Pflege bei Verhinderung der Pflegeperson
- Umstrukturierung der Paragraphen 45 a - d SGB XI
- § 45a
- § 45b
- § 45c
- § 45d
- Die Veränderungen durch das Pflegestärkungsgesetz III
- Abrechnungsprüfung im Rahmen der Qualitätsprüfungen
- Vergütung in der ambulanten Pflege
- Entwicklung der Pflegeberatung
- Auswirkung des Pflegestärkungsgesetz II und III auf die ambulante Pflege
- Von der Feststellung der Pflegebedürftigkeit bis zur Einstufung in einen Pflegegrad
- Leistungen der Pflegeversicherung nach der Pflegereform
- Die Umstrukturierung der Paragraphen 45 a – d SGB XI
- Bedeutung der Abrechnungsprüfung
- Die Vergütungsvereinbarungen
- Die Veränderung in der Pflegeberatung
- Diskussion der Pflegestärkungsgesetze
- Die Begutachtung: Fähigkeit statt Zeitaufwand
- Pflegestufen versus Pflegegrade
- Die Paragraphen 45 a - b SGB XI
- Richtige Abrechnung wichtig für Pflegenote
- Vergütung der Tarifverträge in der Pflege
- Fazit
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Auswirkungen der Pflegestärkungsgesetze II und III auf die ambulante Pflege. Ziel ist es, die wichtigsten Veränderungen im System der Pflegebedürftigkeitsermittlung, der Leistungsabrechnung und der Vergütung darzustellen und zu analysieren.
- Der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff und die Einstufung in Pflegegrade
- Die Veränderungen in der Leistungsabrechnung und -prüfung
- Die Auswirkungen auf die Vergütung in der ambulanten Pflege
- Die Rolle der Pflegeberatung
- Die Umstrukturierung der Paragraphen 45a-d SGB XI
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Pflegestärkungsgesetze II und III ein und begründet die Relevanz der Arbeit. Sie beschreibt den Aufbau und die Methode der Untersuchung.
Die Veränderungen durch das Pflegestärkungsgesetz II: Dieses Kapitel beschreibt detailliert die Neuerungen des Pflegestärkungsgesetzes II, insbesondere den neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff, die Einführung der Pflegegrade und die damit verbundenen Änderungen bei der Leistungsabrechnung und -gewährung. Es analysiert die einzelnen Module zur Ermittlung der Pflegebedürftigkeit und die Umstellung von Pflegestufen auf Pflegegrade. Die Änderungen der Paragraphen 45a-d SGB XI werden ebenfalls ausführlich behandelt.
Die Veränderungen durch das Pflegestärkungsgesetz III: Das Kapitel widmet sich den Auswirkungen des Pflegestärkungsgesetzes III, insbesondere den Änderungen im Bereich der Abrechnungsprüfung, der Vergütung in der ambulanten Pflege und der Entwicklung der Pflegeberatung. Es beleuchtet die Auswirkungen der neuen Regelungen auf die Qualitätssicherung und die finanzielle Situation der ambulanten Pflegedienste.
Auswirkung des Pflegestärkungsgesetz II und III auf die ambulante Pflege: Dieses Kapitel synthetisiert die Ergebnisse der vorherigen Kapitel und analysiert die gesamtheitlichen Auswirkungen der beiden Pflegestärkungsgesetze auf die ambulante Pflege. Es beleuchtet den Prozess von der Feststellung der Pflegebedürftigkeit bis zur Einstufung in einen Pflegegrad, die Leistungen der Pflegeversicherung, die Bedeutung der Abrechnungsprüfung, die Vergütungsvereinbarungen und die veränderte Rolle der Pflegeberatung.
Diskussion der Pflegestärkungsgesetze: In diesem Kapitel werden die zentralen Punkte der Pflegestärkungsgesetze kritisch diskutiert. Es werden die Veränderungen in der Begutachtung, der Unterschied zwischen Pflegestufen und Pflegegraden sowie die Bedeutung der korrekten Abrechnung für die Pflegenote beleuchtet. Die Auswirkungen auf die Vergütung der Tarifverträge in der Pflege werden ebenfalls analysiert.
Schlüsselwörter
Pflegestärkungsgesetze II und III, Pflegebedürftigkeit, Pflegegrade, Pflegestufen, ambulante Pflege, Leistungsabrechnung, Vergütung, Qualitätsprüfung, Pflegeberatung, SGB XI, Begutachtung, § 45a-d SGB XI.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu den Auswirkungen der Pflegestärkungsgesetze II und III auf die ambulante Pflege
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet eine umfassende Übersicht über die Auswirkungen der Pflegestärkungsgesetze II und III auf die ambulante Pflege. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der Analyse der Veränderungen in der Pflegebedürftigkeitsermittlung, der Leistungsabrechnung und der Vergütung.
Welche Themen werden in diesem Dokument behandelt?
Das Dokument behandelt folgende Kernthemen: den neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff und die Einstufung in Pflegegrade, die Veränderungen in der Leistungsabrechnung und -prüfung, die Auswirkungen auf die Vergütung in der ambulanten Pflege, die Rolle der Pflegeberatung und die Umstrukturierung der Paragraphen 45a-d SGB XI. Es vergleicht auch die Unterschiede zwischen Pflegestufen und Pflegegraden.
Was sind die wichtigsten Veränderungen durch das Pflegestärkungsgesetz II?
Das Pflegestärkungsgesetz II führte einen neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff ein, etablierte die Pflegegrade anstelle der Pflegestufen und veränderte die Leistungsabrechnung und -gewährung. Die Ermittlung der Pflegebedürftigkeit erfolgt nun über sechs Module, die verschiedene Fähigkeiten und Bedürfnisse berücksichtigen. Auch die Paragraphen 45a-d SGB XI wurden umstrukturiert.
Welche Neuerungen brachte das Pflegestärkungsgesetz III?
Das Pflegestärkungsgesetz III fokussiert auf die Abrechnungsprüfung im Rahmen der Qualitätsprüfungen, die Vergütung in der ambulanten Pflege und die Weiterentwicklung der Pflegeberatung. Es zielt auf eine Verbesserung der Qualitätssicherung und der finanziellen Situation der ambulanten Pflegedienste ab.
Wie wirkt sich die Kombination der Pflegestärkungsgesetze II und III auf die ambulante Pflege aus?
Die Kombination beider Gesetze führte zu umfassenden Veränderungen im gesamten System der ambulanten Pflege. Von der Feststellung der Pflegebedürftigkeit bis zur Einstufung in einen Pflegegrad, den Leistungen der Pflegeversicherung, der Abrechnungsprüfung, den Vergütungsvereinbarungen und der Rolle der Pflegeberatung – alle Bereiche wurden beeinflusst. Der Prozess ist komplexer und erfordert ein tiefergehendes Verständnis der neuen Regelungen.
Welche Kritikpunkte werden an den Pflegestärkungsgesetzen geäußert?
Das Dokument diskutiert kritische Punkte wie die Veränderungen in der Begutachtung (Fähigkeit statt Zeitaufwand), den Unterschied zwischen Pflegestufen und Pflegegraden, die Bedeutung der korrekten Abrechnung für die Pflegenote und die Auswirkungen auf die Vergütung der Tarifverträge in der Pflege.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt des Dokuments?
Schlüsselwörter sind: Pflegestärkungsgesetze II und III, Pflegebedürftigkeit, Pflegegrade, Pflegestufen, ambulante Pflege, Leistungsabrechnung, Vergütung, Qualitätsprüfung, Pflegeberatung, SGB XI, Begutachtung, § 45a-d SGB XI.
Wie ist das Dokument aufgebaut?
Das Dokument beginnt mit einer Einleitung, gefolgt von Kapiteln, die die Veränderungen durch das Pflegestärkungsgesetz II und III detailliert beschreiben. Ein Kapitel fasst die Auswirkungen beider Gesetze zusammen, und ein abschließendes Kapitel diskutiert die zentralen Punkte kritisch. Ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter erleichtern die Orientierung.
- Arbeit zitieren
- Katharina Daub (Autor:in), 2017, Veränderungen durch das Pflegestärkungsgesetz II und III in der ambulanten Pflege, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/388780