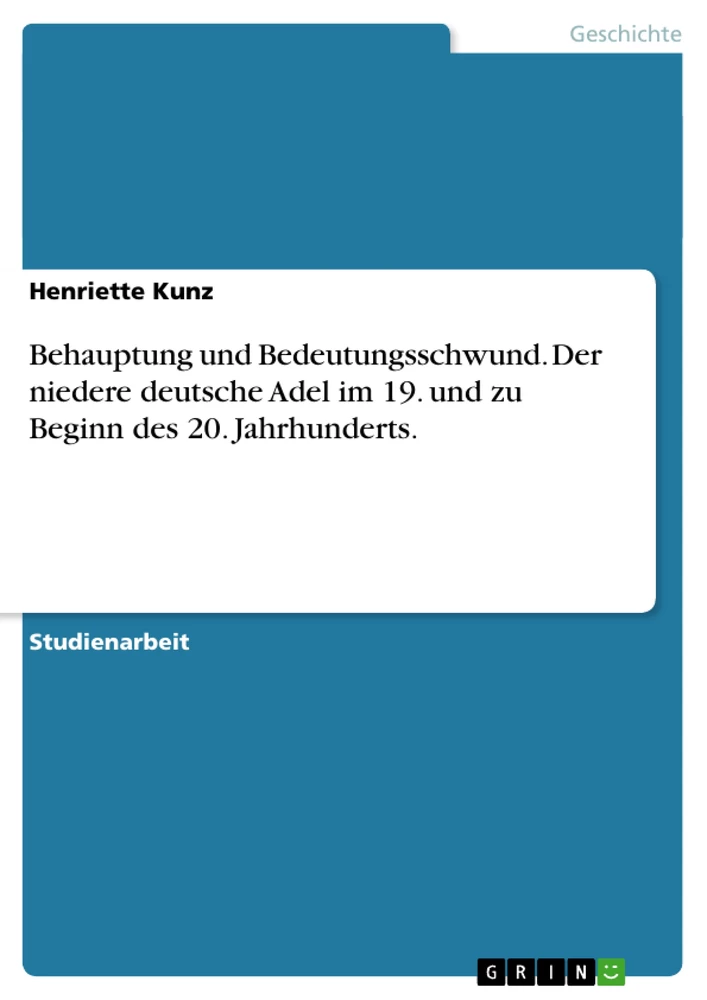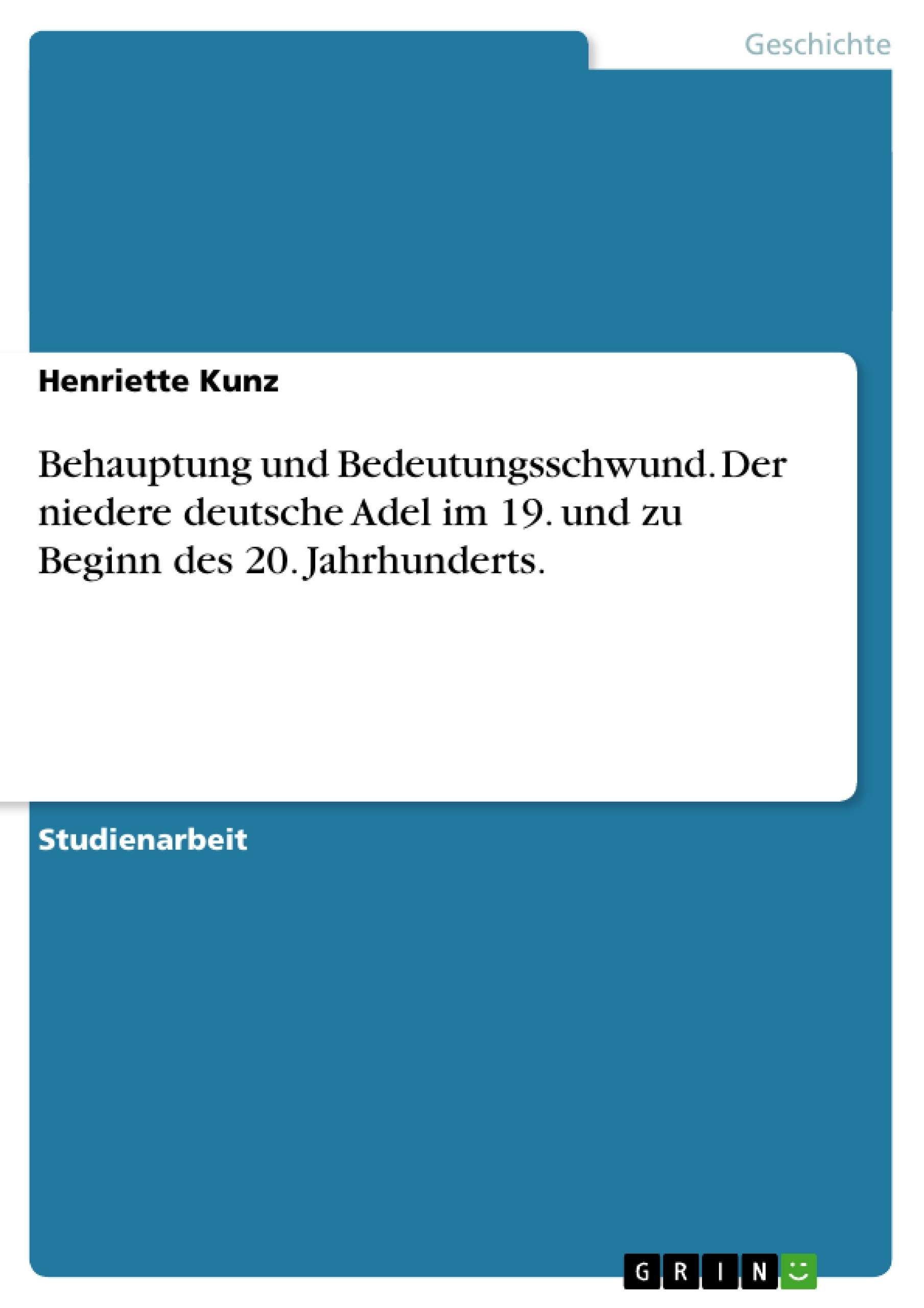Tiefgreifende Veränderungen im Zuge der Pluralisierung der Gesellschaft nach dem Ende des Heiligen Römischen Reiches im beginnenden 19. Jahrhundert brachten die fortschreitende Nivellierung des Adels als Stand. Trotz dieser Einschränkung seiner Rechte und bisherigen Privilegien gelang es dem Adel mindestens bis 1918, seine gesellschaftlich und politisch führende Rolle weiterhin zu behaupten.
Ausgehend von den Kennzeichen des Adels als Stand vor 1800 im Vergleich zu den Änderungen des 19. Jahrhunderts sollen infolgedessen die Strategien und Faktoren skizziert werden, die jenes „Obenbleiben“ ermöglichten und bedingten, wobei zwischen Taktiken innerhalb des Adels, die explizit die Kohäsionskraft der Gruppe stärken sollten, und dem Wesen sowie den Inhalten des sozialen und symbolischen Kapitals, die beide zudem legitimierend wirken mussten, unterschieden wird.
Gleichwohl der Generierung von Adeligkeit - bezogen auf den gesamten deutschen Adel - durchaus eine gemeinsame Technik zugrunde lag, waren jene kulturellen Inhalte keineswegs überregional stets in gleicher Form zu finden. Adeligkeit und deren Entstehung kann ausschließlich regional betrachtet werden, weshalb sich diese Arbeit verstärkt sächsischen Beispielen bedient.
Trotz aller Erfolge im Beharren auf einer gesellschaftlichen Führungsebene sind jedoch ebenfalls Niederlagen des Adels im Zuge der Moderne zu verzeichnen. Die Gründe für diesen Bedeutungsschwund bilden den vierten Teil dieser Arbeit.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Adelsstand vor 1800 im Vergleich zum 19. Jahrhundert
- „Obenbleiben“ – Strategien und Faktoren
- Das symbolische Kapital
- Das soziale Kapital
- Die Erzeugung von Adeligkeit
- Der Bedeutungsverlust am Ende des 19. Jahrhunderts und nach der Zäsur von 1918
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Behauptung und den Bedeutungsschwund des niederen deutschen Adels im 19. und frühen 20. Jahrhundert. Sie analysiert die Strategien und Faktoren, die zum "Obenbleiben" des Adels beitrugen, und beleuchtet den Bedeutungsverlust im Zuge der Modernisierung.
- Der Wandel des Adelsstandes vom Ancien Régime zur Moderne
- Strategien des niederen Adels zur Aufrechterhaltung seines Status
- Die Rolle von sozialem und symbolischem Kapital
- Der Einfluss von Nobilitierungen auf die gesellschaftliche Wahrnehmung des Adels
- Der Bedeutungsschwund des Adels im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und erläutert die Bedeutung der Adelsforschung im 19. und 20. Jahrhundert. Sie betont die Komplexität des deutschen Adels und kündigt die sozialgeschichtliche Betrachtung des niederen deutschen Adels an. Das Zitat von Eckart Conze unterstreicht die Eignung des Adels als Fallbeispiel für die Untersuchung von Inklusion und Exklusion. Die Arbeit konzentriert sich auf die Strategien des Adels, seinen gesellschaftlichen Status trotz tiefgreifender gesellschaftlicher Veränderungen zu erhalten, und auf die Gründe für seinen späteren Bedeutungsschwund.
Der Adelsstand vor 1800 im Vergleich zum 19. Jahrhundert: Dieses Kapitel vergleicht den Adelsstand vor 1800 mit seiner Situation im 19. Jahrhundert. Vor 1800 bildete der Adel eine hierarchisch gegliederte Herrschaftsschicht mit Sonderrechten und Privilegien. Der niedere Adel, zahlenmäßig größer als der Hochadel, besaß, sofern er Grundbesitz verfügte, ständische Mitherrschaftsrechte. Das Einkommen aus Grundbesitz war oft unzureichend, was viele Mitglieder des niederen Adels in den Dienst von Landesherren zwang. Die persönlichen Vorrechte betrafen Gerichtsbarkeit, Kriminalprozesse, Nachlassregelungen und Jagd-, Zoll- und Steuerwesen. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts führten die Französische Revolution, die Säkularisierung und Mediatisierungen zu einem Verlust adeliger Privilegien. Die zunehmende Nobilitierung ab 1815 führte zu einer Abwertung des Adelstitels und Protesten. Der Verlust an Landbesitz stellte eine große Herausforderung dar, und ständische Qualitäten verloren an Bedeutung. Der niedere Adel verlor seine Vorzugsstellung schneller als der Hochadel.
Schlüsselwörter
Niederadel, Deutschland, 19. Jahrhundert, 20. Jahrhundert, Sozialgeschichte, Soziales Kapital, Symbolisches Kapital, Nobilitierung, Bedeutungsschwund, Modernisierung, Ständegesellschaft, Privilegien, Strategien des "Obenbleibens", Gesellschaftliche Inklusion und Exklusion.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Die Strategien des niederen deutschen Adels zum "Obenbleiben" im 19. und frühen 20. Jahrhundert
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Wandel des niederen deutschen Adels vom Ancien Régime bis ins frühe 20. Jahrhundert. Der Fokus liegt auf den Strategien, die der Adel zur Bewahrung seines Status einsetzte, und den Gründen für seinen Bedeutungsverlust im Zuge der Modernisierung.
Welche Zeiträume werden betrachtet?
Die Arbeit betrachtet primär das 19. und das frühe 20. Jahrhundert, mit Vergleichen zum Adelsstand vor 1800. Es wird der Einfluss der Französischen Revolution, der Säkularisierung und der Mediatisierungen auf den Adel beleuchtet.
Welche Aspekte des Adels werden analysiert?
Die Analyse umfasst den Vergleich des Adelsstandes vor und nach 1800, die Strategien des "Obenbleibens" (unter Einbezug von sozialem und symbolischem Kapital), die Rolle der Nobilitierungen, den Bedeutungsverlust des Adels und den Einfluss der Modernisierung auf den Adel.
Welche Konzepte werden verwendet?
Wichtige Konzepte sind soziales und symbolisches Kapital, Nobilitierung, Modernisierung, Inklusion und Exklusion, sowie die Betrachtung des Adels im Kontext der Ständegesellschaft und des Verlusts von Privilegien.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zum Vergleich des Adelsstandes vor und nach 1800, ein Kapitel zu den Strategien des "Obenbleibens" (mit Unterkapiteln zu sozialem und symbolischem Kapital und der Erzeugung von Adeligkeit), ein Kapitel zum Bedeutungsverlust und eine Zusammenfassung. Ein Inhaltsverzeichnis und Schlüsselbegriffe sind ebenfalls enthalten.
Welche Kapitelzusammenfassung wird gegeben?
Die Zusammenfassung der Kapitel bietet einen Überblick über die Einleitung (mit Betonung der Komplexität des deutschen Adels und der sozialgeschichtlichen Perspektive), den Vergleich des Adels vor und nach 1800 (mit Fokus auf den Verlust von Privilegien und Landbesitz), und den Bedeutungsverlust des Adels im Kontext der gesellschaftlichen Veränderungen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter umfassen Niederadel, Deutschland, 19. Jahrhundert, 20. Jahrhundert, Sozialgeschichte, Soziales Kapital, Symbolisches Kapital, Nobilitierung, Bedeutungsschwund, Modernisierung, Ständegesellschaft, Privilegien, Strategien des "Obenbleibens", Gesellschaftliche Inklusion und Exklusion.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit untersucht den Behauptung und den Bedeutungsschwund des niederen deutschen Adels im 19. und frühen 20. Jahrhundert und analysiert die Strategien und Faktoren, die zum "Obenbleiben" beitrugen. Sie beleuchtet den Bedeutungsverlust im Zuge der Modernisierung und den Wandel des Adelsstandes vom Ancien Régime zur Moderne.
- Quote paper
- Henriette Kunz (Author), 2005, Behauptung und Bedeutungsschwund. Der niedere deutsche Adel im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts., Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/38846