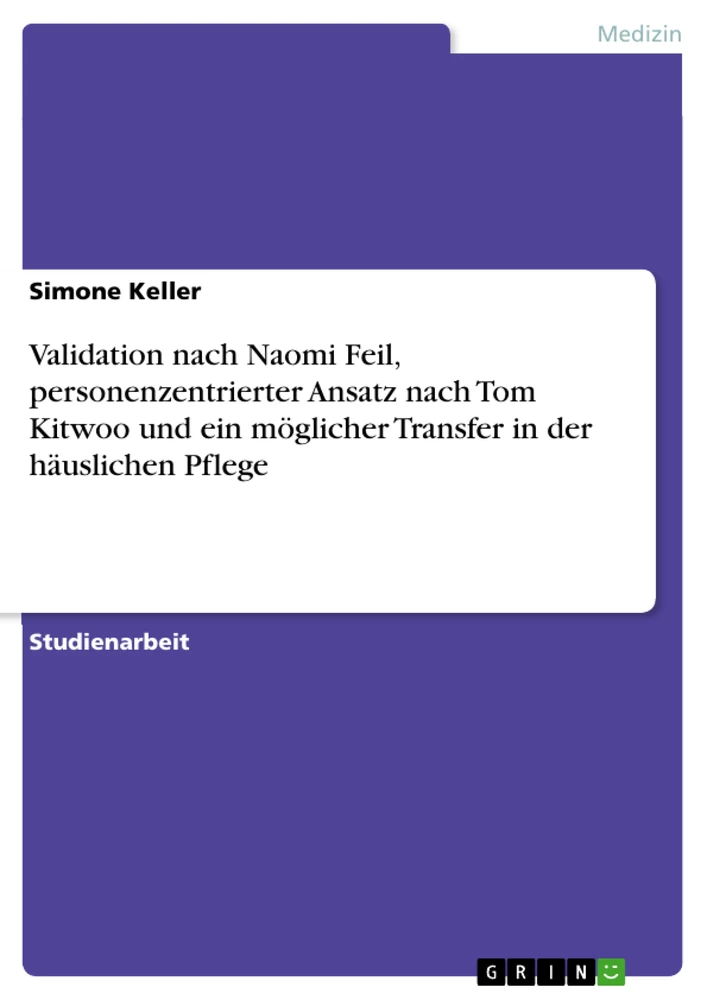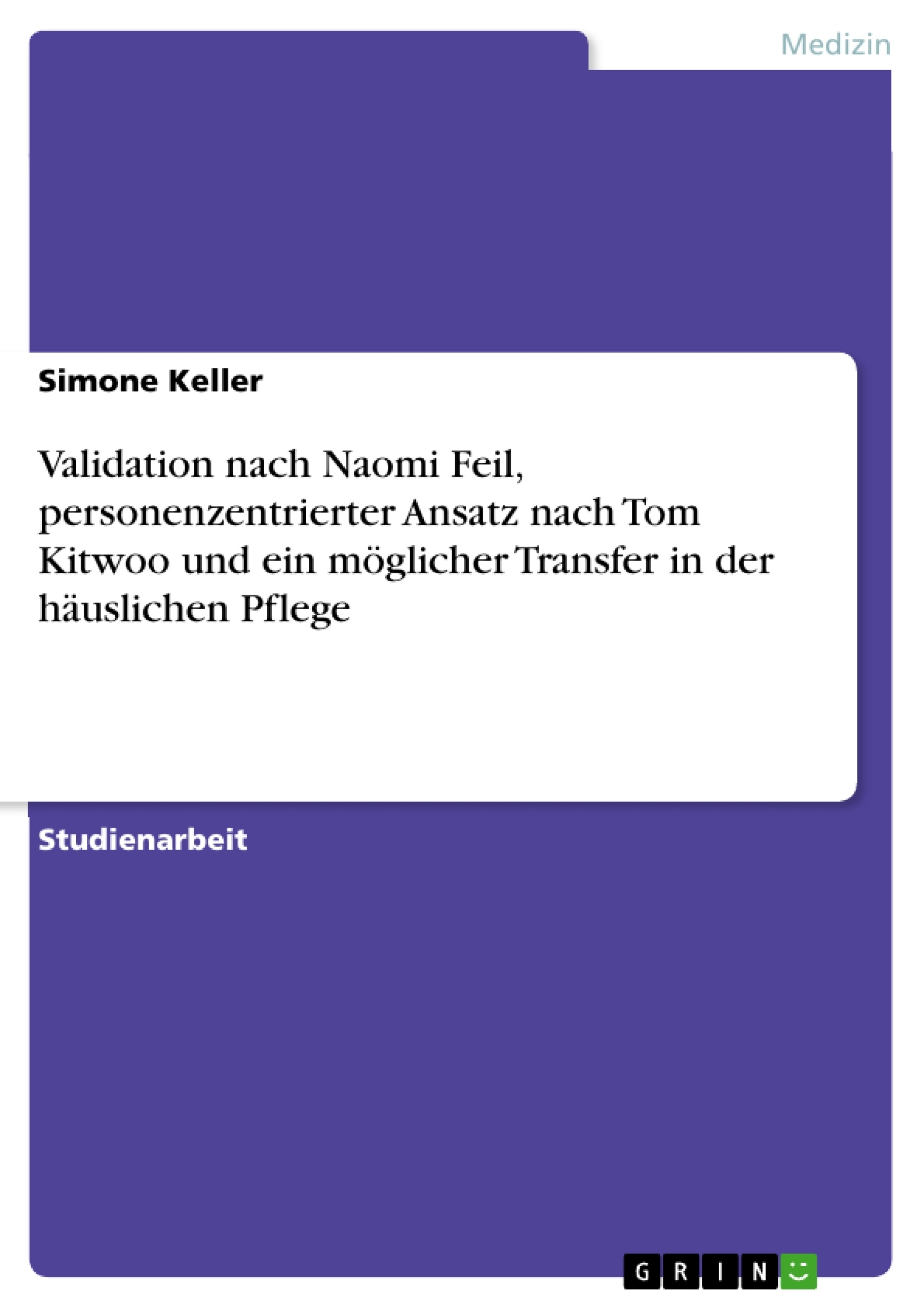Diese Arbeit beleuchtet Validation nach Naomi Feil und den personenzentrierten Ansatz nach Tom Kitwood. Im Anschluss folgen Überlegungen, welche Konditionen förderlich sind, um diese Ansätze in den häuslichen Bereich zu übertragen.
Das Wort Demenz stammt aus dem Lateinischen „de-mens“ und bedeutet so viel wie „ohne Geist“. In der Öffentlichkeit wahrgenommene Bilder lassen sich in Äußerungen zusammenfassen wie „Abschied vom Ich“, „Tod im Leben“ oder „menschenunwürdiges Siechtum“. Das Thema ist zugleich sehr emotional besetzt. Betroffene und Angehörige sehen sich einer persönlichen Tragödie gegenüber, stellen doch Autonomie und Selbstbestimmung ein hohes anzustrebendes Gut unserer Gesellschaft dar.
Zurzeit leben in Deutschland etwa 1,3 Millionen Menschen, die an einer Demenz leiden. Prognosen zufolge verdoppelt sich diese Zahl bis zum Jahr 2050. Gleichzeitig steht der steigenden Anzahl der Erkrankten eine immer geringere Zahl an Betreuenden und Pflegenden gegenüber. Der Ausbau von immer mehr stationären Pflegeplätzen mit immer weniger qualifiziertem Personal, welches zur Verfügung steht, bietet keine zufriedenstellende Perspektive. Familien und die Gesellschaft als Ganzes werden mit einer sich verschärfenden Problemlage konfrontiert. Es gilt, die zur Verfügung stehenden Ressourcen, auch unter dem Gesichtspunkt der Kosteneffizienz, optimal zu nutzen. Der Einzug in ein Pflegeheim wird mit fortschreitender Demenz immer wahrscheinlicher. Umso mehr gilt es Bedingungen und Betreuungskonzepte zu entwickeln, die eine menschenwürdige Versorgung der Betroffenen in ihrer häuslichen Umgebung ermöglichen. Dies entspricht sowohl dem im Gesetz eingeräumten Vorrang der ambulanten Versorgung als auch dem persönlichen Wunsch der meisten Menschen.
In den letzten Jahren wurden mehrere Ansätze zur Betreuung und Pflege von Menschen mit Demenz entwickelt. Die Umsetzung erfolgt jedoch vorwiegend im stationären Bereich.
Inhaltsverzeichnis
- Eigenständigkeitserklärung
- Erklärung zur Archivierung der Studienarbeit
- Vorwort
- Inhaltsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
- Abkürzungen
- Einleitung
- Pathologisierung der Demenz
- Was ist Demenz?
- Umgangsformen mit Personen mit Demenz
- Validation nach Naomi Feil
- Carl Rogers und sein Therapiemodell
- Erik Eriksons Theorie der Lebensstadien
- Weitere Theorien, die die Validation beeinflusst haben
- Gründe zur Desorientiertheit
- Feils distanzierte Perspektive zur Pathologisierung der Demenz
- Zielgruppe der Validation
- Die vier Phasen der Aufarbeitung
- Eigenschaften des Validationsanwenders
- Anwendung
- Der personenzentrierte Ansatz nach Tom Kitwood
- Der Begriff des "Personseins"
- Maligne Sozialpsychologie
- Bedürfnisse von Personen mit Demenz
- Positive Arbeit an der Person
- Grundsätze des personenzentrierten Ansatzes
- Dementia Care Mapping (DCM)
- Übertragbarkeit in das häusliche Pflegesetting
- Resümee
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Studienarbeit untersucht nicht-medikamentöse Interventionsmöglichkeiten im Umgang mit Demenzkranken in der häuslichen Pflege. Ziel ist es, zwei verschiedene Ansätze – die Validation nach Naomi Feil und den personenzentrierten Ansatz nach Tom Kitwood – vorzustellen und ihre Übertragbarkeit auf die häusliche Pflege zu diskutieren.
- Validation als Methode zur Bearbeitung emotionaler Bedürfnisse von Demenzkranken
- Der personenzentrierte Ansatz und seine Betonung der Person hinter der Erkrankung
- Die Herausforderungen der Umsetzung dieser Ansätze in der häuslichen Pflege
- Vergleich der beiden Ansätze und ihre jeweiligen Stärken und Schwächen
- Entwicklung eines möglichen Transfermodells für die häusliche Pflege
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung liefert einen kurzen Überblick über den Wandel des Umgangs mit Demenz im Laufe der Jahre und die zunehmende Bedeutung nicht-medikamentöser Interventionen. Sie begründet die Notwendigkeit der Auseinandersetzung mit alternativen Perspektiven, um eine humanere Pflege von Demenzkranken zu ermöglichen. Der Fokus auf zwei spezifische Ansätze wird hier begründet und die Struktur der Arbeit skizziert.
Pathologisierung der Demenz: Dieses Kapitel liefert grundlegende Informationen über Demenz, differenziert zwischen verschiedenen Umgangsformen mit Demenzkranken und legt die Basis für das Verständnis der nachfolgenden Kapitel. Es beleuchtet die kritische Perspektive auf die Pathologisierung von Demenz und bereitet den Boden für die Diskussion der beiden vorgestellten Interventionen, welche der Pathologisierung entgegenwirken.
Validation nach Naomi Feil: Dieses Kapitel präsentiert detailliert die Validation-Methode nach Naomi Feil. Es beschreibt die theoretischen Grundlagen, die auf den Arbeiten von Carl Rogers und Erik Erikson basieren, und erklärt die vier Phasen der Aufarbeitung, die ein Validationsanwender durchläuft. Die Bedeutung der distanzierten Perspektive Feils zur Pathologisierung der Demenz wird herausgestellt, ebenso wie die Eigenschaften, die ein Validationsanwender mitbringen sollte, und konkrete Anwendungsbeispiele werden angedeutet. Der Schwerpunkt liegt auf dem Verständnis der emotionalen Bedürfnisse von Menschen mit Demenz und deren adäquater Bewältigung.
Der personenzentrierte Ansatz nach Tom Kitwood: Dieses Kapitel beschreibt den personenzentrierten Ansatz nach Tom Kitwood. Es definiert den Begriff des "Personseins" und analysiert die "maligne Sozialpsychologie", die sich negativ auf den Umgang mit Demenzkranken auswirken kann. Die Bedeutung der positiven Arbeit an der Person und die zentralen Bedürfnisse von Menschen mit Demenz werden ausführlich erläutert. Der Fokus liegt auf der Erhaltung der Person und ihres Selbstwertgefühls trotz fortschreitender Erkrankung. Die Anwendung des Dementia Care Mapping (DCM) als Instrument der personenzentrierten Pflege wird ebenfalls angeschnitten.
Übertragbarkeit in das häusliche Pflegesetting: Dieses Kapitel diskutiert die Herausforderungen und Möglichkeiten der Übertragung der beiden vorgestellten Ansätze in die Praxis der häuslichen Pflege. Es werden potentielle Schwierigkeiten, wie z.B. der Zeitaufwand und die Notwendigkeit einer umfassenden Schulung der Pflegenden, thematisiert. Gleichzeitig werden die Vorteile und der positive Einfluss auf die Lebensqualität der Betroffenen hervorgehoben. Das Kapitel legt einen Schwerpunkt auf die praktische Umsetzbarkeit und die notwendigen Anpassungen der Konzepte an die häusliche Umgebung.
Schlüsselwörter
Demenz, Validation, personenzentrierter Ansatz, Naomi Feil, Tom Kitwood, häusliche Pflege, nicht-medikamentöse Interventionen, emotionale Bedürfnisse, Personsein, Dementia Care Mapping (DCM), maligne Sozialpsychologie, Lebensqualität.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Studienarbeit: Nicht-medikamentöse Interventionen im Umgang mit Demenzkranken in der häuslichen Pflege
Was ist der Gegenstand der Studienarbeit?
Die Studienarbeit untersucht nicht-medikamentöse Interventionsmöglichkeiten im Umgang mit Demenzkranken in der häuslichen Pflege. Sie fokussiert sich auf zwei Ansätze: die Validation nach Naomi Feil und den personenzentrierten Ansatz nach Tom Kitwood, und deren Übertragbarkeit in die häusliche Pflege.
Welche Ansätze werden in der Arbeit vorgestellt?
Die Arbeit stellt detailliert die Validation nach Naomi Feil und den personenzentrierten Ansatz nach Tom Kitwood vor. Beide Ansätze bieten alternative Perspektiven zur traditionellen, oft pathologisierenden Betrachtung von Demenz.
Was ist Validation nach Naomi Feil?
Die Validation ist eine Methode zur Bearbeitung der emotionalen Bedürfnisse von Demenzkranken. Sie basiert auf den Theorien von Carl Rogers und Erik Erikson und beinhaltet vier Phasen der Aufarbeitung. Der Fokus liegt auf dem Verständnis und der adäquaten Bewältigung der emotionalen Bedürfnisse der Betroffenen.
Was ist der personenzentrierte Ansatz nach Tom Kitwood?
Der personenzentrierte Ansatz betont die Person hinter der Erkrankung. Er analysiert die "maligne Sozialpsychologie", die den Umgang mit Demenzkranken negativ beeinflussen kann, und konzentriert sich auf die Erhaltung des Personseins und des Selbstwertgefühls. Dementia Care Mapping (DCM) wird als Instrument der personenzentrierten Pflege vorgestellt.
Wie werden die Ansätze in die häusliche Pflege übertragen?
Die Arbeit diskutiert die Herausforderungen und Möglichkeiten der Übertragung beider Ansätze in die häusliche Pflege. Sie thematisiert Schwierigkeiten wie den Zeitaufwand und die Schulungsnotwendigkeiten für Pflegende, und hebt gleichzeitig die Vorteile und den positiven Einfluss auf die Lebensqualität der Betroffenen hervor.
Welche Themen werden in der Einleitung behandelt?
Die Einleitung gibt einen Überblick über den Wandel im Umgang mit Demenz, die Bedeutung nicht-medikamentöser Interventionen und begründet die Auswahl der beiden vorgestellten Ansätze. Sie skizziert die Struktur der gesamten Arbeit.
Was wird im Kapitel "Pathologisierung der Demenz" behandelt?
Dieses Kapitel liefert grundlegende Informationen über Demenz, differenziert zwischen verschiedenen Umgangsformen und legt die Basis für das Verständnis der folgenden Kapitel. Es beleuchtet die kritische Perspektive auf die Pathologisierung von Demenz.
Welche Kapitelzusammenfassungen werden angeboten?
Die Arbeit bietet Kapitelzusammenfassungen für die Einleitung, die Pathologisierung der Demenz, die Validation nach Naomi Feil, den personenzentrierten Ansatz nach Tom Kitwood und die Übertragbarkeit in das häusliche Pflegesetting.
Welche Schlüsselwörter werden verwendet?
Schlüsselwörter umfassen Demenz, Validation, personenzentrierter Ansatz, Naomi Feil, Tom Kitwood, häusliche Pflege, nicht-medikamentöse Interventionen, emotionale Bedürfnisse, Personsein, Dementia Care Mapping (DCM), maligne Sozialpsychologie und Lebensqualität.
Welche weiteren Informationen enthält die HTML-Datei?
Zusätzlich zu den beschriebenen Inhalten enthält die HTML-Datei ein detailliertes Inhaltsverzeichnis mit allen Kapiteln und Unterkapiteln, sowie eine Zielsetzung und Themenschwerpunkte der Arbeit.
- Quote paper
- Simone Keller (Author), 2016, Validation nach Naomi Feil, personenzentrierter Ansatz nach Tom Kitwoo und ein möglicher Transfer in der häuslichen Pflege, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/387964