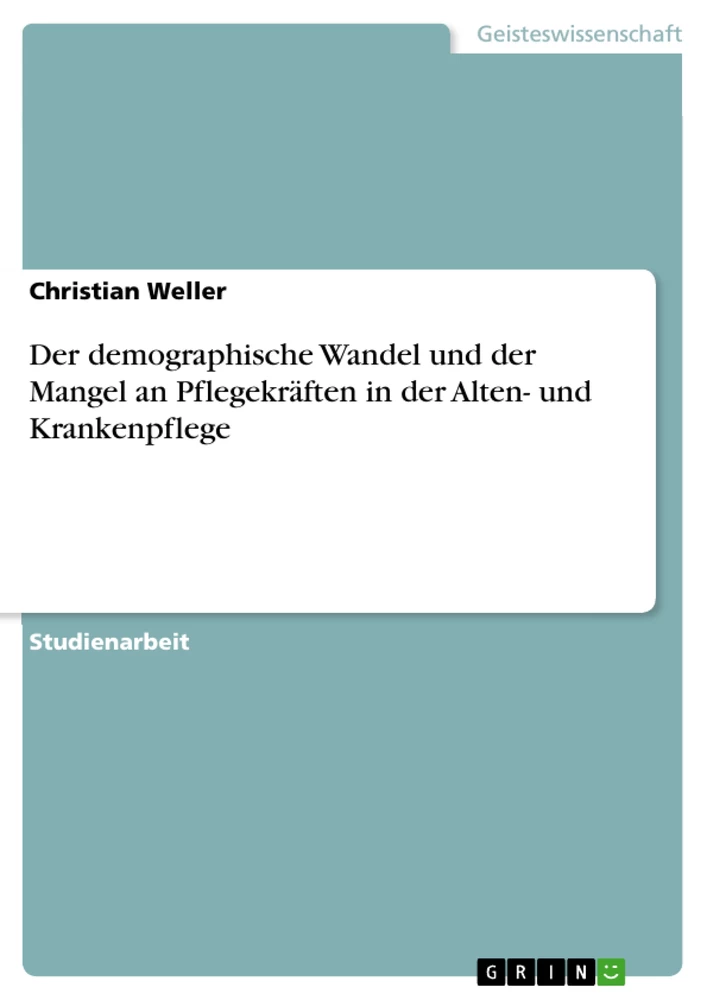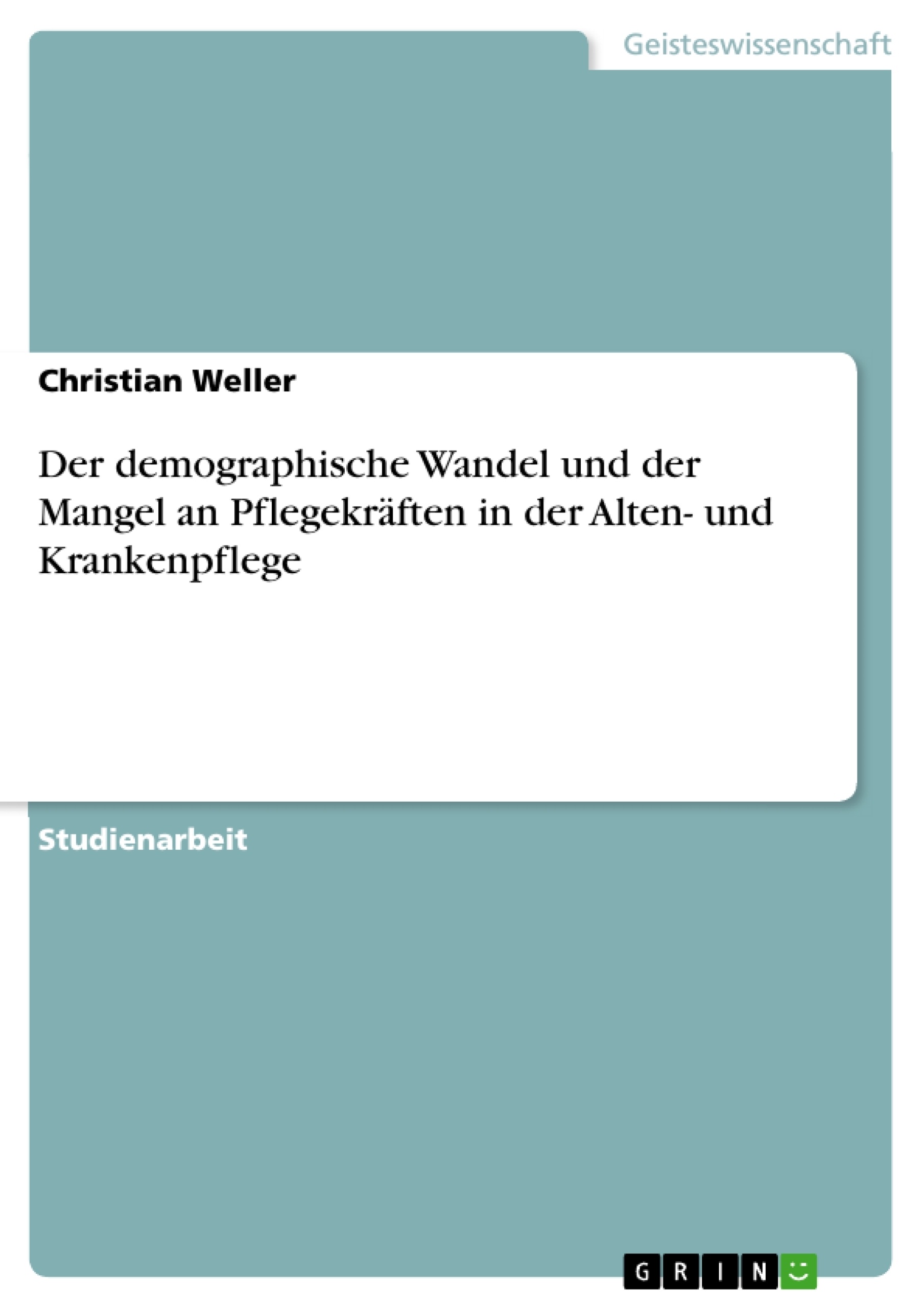Der demographische Wandel besitzt einen immensen Einfluss auf die Funktionsfähigkeit des bestehenden Sozialversicherungssystem Deutschlands. Immer weniger jüngere Menschen zahlen die Pensionen für eine immer älter werdende und anteilmäßig erstarkende Gruppe alter Menschen.
Fraglich ist dementsprechend die Finanzierbarkeit des sozialen Sicherungssystems in seiner jetzigen Form. Der Generationenvertrag gerät demnach aus den Fugen: Zwar wird die mittlere Generation durch die niedrigen Geburtenraten durch Leistungen an die heranwachsende Generation niedriger, jedoch fällt die Leistungsbelastung durch die Älteren für diese umso höher aus. Als Ergebnis unterhält die mittlere Generation fortlaufend weniger Mitglieder.
Große Auswirkungen besitzt dieser zusätzlich auf den in dieser Seminararbeit zusätzlich thematisierten Pflegesektor. So werden für stetig ansteigende Zahlen von pflegebedürftig werdender Menschen folglich auch mehr Menschen für deren Pflege benötigt. Dies belegen Zahlen der jährlich publizierten Studie der Barmer GEK: 1999 wurden lediglich 2,016 Millionen pflegebedürftiger Menschen gezählt, wobei die Anzahl der privatversicherten Menschen nicht miteinbezogen wurde.
2015 hat sich diese Zahl bereits um fast 34 % (eigene Berechnung) erhöht, was eine Anzahl von 2,7 Millionen Pflegebedürftiger ergibt. Rechnet man zudem noch die etwa 200.000 Menschen aus den privaten Pflegeversicherungen dazu, so ergibt sich eine Anzahl von 2,9 Millionen Pflegebedürftiger. Errechnete Zahlen weisen auf, dass der Pflegebedarf von 2015 bis 2060 um etwa 65% ansteigen wird. Im Umkehrschluss müsste sich der Anteil der jungen Menschen, welcher sich für eine Ausbildung oder allenfalls eine Anlernung in der Pflege entscheiden, um ein vielfaches erhöhen. Positiv zu bewerten sind die zuletzt steigenden Geburtenraten, sowie die geringfügig steigende Anzahl von Auszubildenden in der Alten- und Krankenpflege. In jetziger Form würden diese aber nicht reichen, um einen künftigen Pflegemangel entgegen zu wirken.
Die Bundesregierung hat zudem Pläne, die Ausbildungen der Kranken- und Altenpflege zusammenzulegen. So würde sich das Gehaltsgefüge angleichen (Altenpfleger verdienen durchschnittlich weniger Geld) und der Pflegeberuf ließe sich zusätzlich vielschichtiger und damit attraktiver machen. Ob diese Maßnahme erfolgreich ist, wird sich erst in einigen Jahren zeigen. Festzuhalten ist jedoch, dass das Problem des Pflegemangels im Fokus der Politik steht.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Problemstellung und Zielsetzung
- 1.2 Vorgehensweise
- 2 Begriffsdefinitionen
- 2.1 Demographie
- 2.2 Demographischer Wandel
- 3 Die weltweite, demographische Entwicklung
- 3.1 Geschichtlicher Rückblick zur Demographie
- 3.2 Demographie in Deutschland
- 3.3 Die fünf Phasen des demographischen Übergangs
- 3.4 Ursachen für den zweiten demographischen Übergang
- 4 Die aktuelle Lage im Pflegesektor
- 4.1 Pflegebedürftige in der ambulanten und stationären Versorgung
- 4.2 Die Beschäftigten in der Alten- und Krankenpflege
- 4.3 Der Mangel an Fachkräften in Alten- und Krankenpflege
- 5 Mögliche Handlungsempfehlungen zu Aufrechterhaltung einer versorgungsfähigen Pflege
- 5.1 Die Studie Pflegelandschaft 2030
- 5.2 Beschäftigungschancen verbessern
- 5.3 Erwerbsbeteiligung erhöhen
- 5.4 Arbeitszeiten verlängern
- 5.5 Breite Bildungsoffensive
- 5.6 Integration von Flüchtlingen
- 6 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht den demografischen Wandel in Deutschland und seine Auswirkungen auf den Pflegesektor, insbesondere den Mangel an Pflegekräften. Ziel ist es, die aktuelle Situation zu beleuchten und mögliche Lösungsansätze aufzuzeigen.
- Der demografische Wandel in Deutschland und seine Ursachen
- Die aktuelle Situation im Pflegesektor: steigender Bedarf und Fachkräftemangel
- Analyse der Auswirkungen des demografischen Wandels auf die Alten- und Krankenpflege
- Mögliche Handlungsempfehlungen zur Verbesserung der Pflegesituation
- Bewertung von Strategien zur Fachkräftegewinnung und -bindung
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung beschreibt den demografischen Wandel als ein zentrales Problem für das deutsche Sozialversicherungssystem und den Pflegesektor. Der Generationenvertrag gerät aufgrund sinkender Geburtenraten und steigender Lebenserwartung ins Ungleichgewicht. Der steigende Bedarf an Pflegekräften wird anhand von Zahlen der Barmer GEK veranschaulicht, die einen deutlichen Anstieg pflegebedürftiger Menschen aufzeigen. Die Arbeit beleuchtet die Problematik des steigenden Pflegebedarfs und den damit verbundenen Mangel an Fachkräften, wobei auf mögliche Lösungsansätze hingewiesen wird. Die Zusammenlegung der Ausbildungen in der Kranken- und Altenpflege wird als ein möglicher Ansatz zur Verbesserung der Situation erwähnt.
2 Begriffsdefinitionen: Dieses Kapitel legt die zentralen Begriffe „Demographie“ und „demographischer Wandel“ prägnant dar. Es bildet die Grundlage für das Verständnis der folgenden Kapitel und bietet eine klare Definition der verwendeten Fachtermini.
3 Die weltweite, demographische Entwicklung: Dieses Kapitel beschreibt die weltweite und speziell die deutsche demographische Entwicklung. Es beleuchtet historische Aspekte, die aktuelle Situation in Deutschland und die Phasen des demografischen Übergangs. Die Ursachen für den zweiten demografischen Übergang werden analysiert. Das Kapitel liefert eine umfassende Darstellung der demografischen Entwicklung, die für das Verständnis des Problems des Pflegemangels unerlässlich ist.
4 Die aktuelle Lage im Pflegesektor: Dieses Kapitel analysiert die aktuelle Situation im Pflegesektor in Deutschland, fokussiert auf den Mangel an Pflegekräften. Es werden Zahlen zu den Pflegebedürftigen in ambulanter und stationärer Versorgung präsentiert, die Zahl der Beschäftigten wird erörtert, und der Mangel an Fachkräften wird detailliert beschrieben. Der zunehmende Anteil multimorbider älterer Menschen wird als zusätzliche Herausforderung thematisiert. Das Kapitel verbindet die demografische Entwicklung mit der konkreten Situation im Pflegesektor.
5 Mögliche Handlungsempfehlungen zu Aufrechterhaltung einer versorgungsfähigen Pflege: Dieses Kapitel präsentiert verschiedene Handlungsempfehlungen zur Bewältigung des Pflegemangels. Es analysiert die Studie "Pflegelandschaft 2030" und diskutiert weitere Ansätze zur Verbesserung der Beschäftigungschancen, Steigerung der Erwerbsbeteiligung, Anpassung der Arbeitszeiten, Umsetzung einer breiten Bildungsoffensive und Integration von Flüchtlingen in den Pflegesektor. Das Kapitel bietet einen pragmatischen Ansatz zur Lösung des Problems.
Schlüsselwörter
Demographischer Wandel, Altenpflege, Krankenpflege, Pflegemangel, Fachkräftemangel, Sozialversicherungssystem, Handlungsempfehlungen, Pflegelandschaft 2030, Geburtenrate, Sterberate, Integration von Flüchtlingen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Demographischer Wandel und seine Auswirkungen auf den Pflegesektor
Was ist der Hauptfokus dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht den demografischen Wandel in Deutschland und dessen Auswirkungen auf den Pflegesektor, insbesondere den Mangel an Pflegekräften. Sie beleuchtet die aktuelle Situation und präsentiert mögliche Lösungsansätze.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt den demografischen Wandel in Deutschland und weltweit, die aktuelle Lage im Pflegesektor (insbesondere den Fachkräftemangel), die Analyse der Auswirkungen des demografischen Wandels auf die Alten- und Krankenpflege und mögliche Handlungsempfehlungen zur Verbesserung der Pflegesituation.
Welche Kapitel umfasst die Seminararbeit?
Die Seminararbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung, Begriffsdefinitionen, Die weltweite, demographische Entwicklung, Die aktuelle Lage im Pflegesektor, Mögliche Handlungsempfehlungen zu Aufrechterhaltung einer versorgungsfähigen Pflege und Fazit. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt des Themas.
Wie wird der demografische Wandel definiert?
Die Arbeit definiert prägnant die Begriffe "Demographie" und "demographischer Wandel". Diese Definitionen bilden die Grundlage für das Verständnis der weiteren Ausführungen.
Welche Aspekte der weltweiten und deutschen demografischen Entwicklung werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet historische Aspekte der demografischen Entwicklung, die aktuelle Situation in Deutschland, die Phasen des demografischen Übergangs und analysiert die Ursachen des zweiten demografischen Übergangs.
Wie wird die aktuelle Lage im Pflegesektor beschrieben?
Das Kapitel zur aktuellen Lage im Pflegesektor analysiert den Mangel an Pflegekräften anhand von Zahlen zu Pflegebedürftigen in ambulanter und stationärer Versorgung, der Anzahl der Beschäftigten und den Herausforderungen durch den zunehmenden Anteil multimorbider älterer Menschen.
Welche Handlungsempfehlungen werden zur Verbesserung der Pflegesituation vorgeschlagen?
Die Arbeit schlägt verschiedene Handlungsempfehlungen vor, darunter die Analyse der Studie "Pflegelandschaft 2030", Verbesserung der Beschäftigungschancen, Steigerung der Erwerbsbeteiligung, Anpassung der Arbeitszeiten, eine breite Bildungsoffensive und die Integration von Flüchtlingen in den Pflegesektor.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Seminararbeit?
Schlüsselwörter sind: Demographischer Wandel, Altenpflege, Krankenpflege, Pflegemangel, Fachkräftemangel, Sozialversicherungssystem, Handlungsempfehlungen, Pflegelandschaft 2030, Geburtenrate, Sterberate und Integration von Flüchtlingen.
Welche Studie wird in der Seminararbeit erwähnt?
Die Studie "Pflegelandschaft 2030" wird analysiert und ihre Ergebnisse in die Handlungsempfehlungen eingebunden.
Welche Ursachen für den zweiten demografischen Übergang werden analysiert?
Die Arbeit analysiert die Ursachen des zweiten demografischen Übergangs, jedoch sind die spezifischen Ursachen im FAQ nicht detailliert aufgeführt. Diese Informationen sind im entsprechenden Kapitel der Seminararbeit selbst nachzulesen.
- Quote paper
- Christian Weller (Author), 2017, Der demographische Wandel und der Mangel an Pflegekräften in der Alten- und Krankenpflege, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/387349