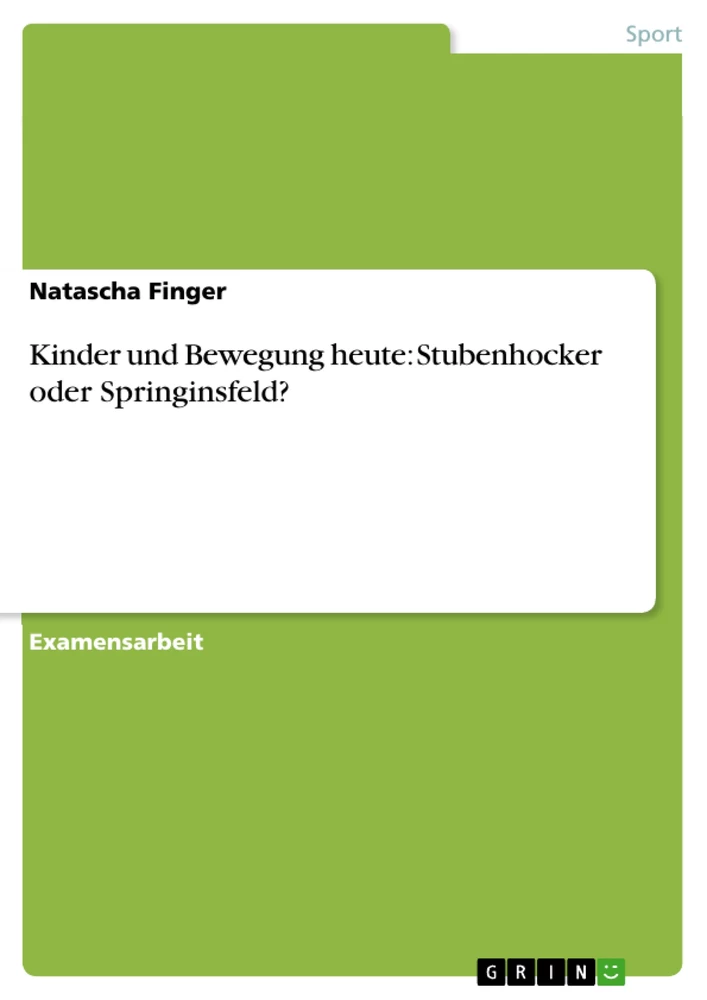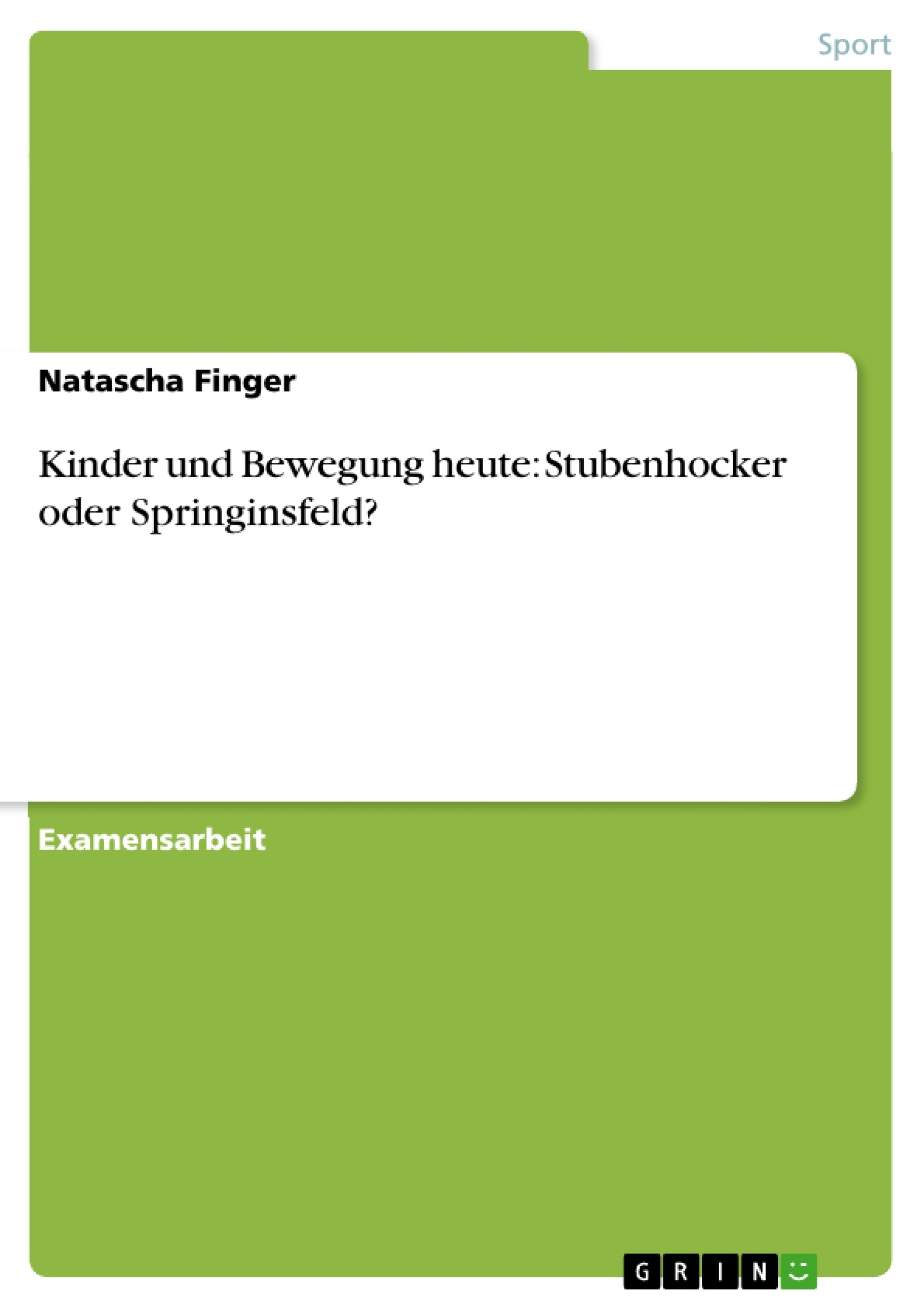Die vorliegende Arbeit befasst sich, wie der Titel bereits verrät, mit der Thematik des gegenwärtigen Bewegungsverhaltens von Kindern.
Die Situationsanalyse der kindlichen Bewegungswelt fällt in hohem Maße widersprüchlich und wenig eindeutig aus, weil sie doppelwertige und polare Tendenzen in ihrer Gestaltung aufzeigt. So stehen bewegungseinschränkenden Bedingungen und bewegungsvermeidenden Einstellungen ein noch nie da gewesenes Angebot an Sportmöglichkeiten gegenüber (vgl. GRÖßING 1993, 121).
Bewegungseinschränkende Bedingungen sind durch unsere Gesellschaft in der Umwelt der Kinder zu finden. Sie gilt als bewegungs- und sinnenfeindlich (KIPHARD 1997, ZIMMER 1999), da sie kindliche Bewegungshandlungen immer mehr erschwert. Dies gilt für die Verkehrssituation, die auf Straßen und Plätzen kaum noch ein Spielen und Bewegen im Freien zulässt; für Spielplätze, die oft wenig bewegungsanregend und langweilig sind. Dies gilt aber auch für die Schule, in der vielfach Bewegungszeiten eher verkürzt als erweitert werden und für die häusliche Situation, in der Video, Fernseher und Computerspiele mit möglichen Bewegungsaktivitäten konkurrieren (vgl. BÖS/ SCHOTT 1999, 9). Gleichzeitig erfolgt eine Rückeroberung der Außen-Räume mit Hilfe vieler neuer Spielgeräte, meist Fortbewegungsmittel wie Skateboards oder Inlineskates, mit denen neue Geschicklichkeitsanforderungen oft unter hoher Geschwindigkeit gemeistert werden. Bezüglich der Nutzung neuer Bewegungsräume, die nicht primär für Bewegungsaktivitäten vorgesehen sind, wird von "Asphaltbewegungsszenen" gesprochen (vgl. BRASS/ HARTMANN 1994, SCHWIER 1996, WOPP 1999).
Hinzukommend steht heute eine weitaus größere Palette möglicher Sportspiele zu Verfügung (vgl. HAUPT 2000). Der Anteil der Kinder, die während ihrer Grundschulzeit Vereinsmitglied geworden sind, liegt derzeit bei ca. 80% (vgl. SCHMIDT 1996, 20). "Es wurde noch nie so langfristig (ab 6 Jahre) und intensiv (3-4 x die Woche) in einem Verein trainiert, wie in den 90er Jahren" (SCHMIDT 1996, 21).
Mein Forschungsinteresse gilt der Ermittlung der gegenwärtigen kindlichen Bewegungsaktivität in dieser ambivalenten Bewegungswelt. Das Bewegungsverhalten von Kindern ist derzeit ein hoch brisantes Thema, das auch von den Medien aufgegriffen und präsentiert wird. Schlagzeilen wie "Deutsche Kinder sind Bewegungsmuffel" (MD-VERLAG, 2.8.2001), "Computer statt Sport, Fernsehen statt Bewegung" (LANDESSPORTBUND-HESSEN) oder "Schulkinder kaum fit“ sind allerorts zu lesen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Das Menschenbild
- 2.1 Humanistisches Menschenbild
- 2.2 Das Bild des Kindes
- 3. Bewegung
- 3.1 Grundsätzliches zur Bewegung
- 3.2 Bewegung als anthropologisches Grundbedürfnis von Kindern
- 3.2.1 Der kindliche Bewegungsdrang
- 3.2.2 Anthropologische Annahmen bezüglich Kinder und Bewegung
- 3.3 Faktoren und Voraussetzungen für die Bewegungsentwicklung
- 4. Kindheit heute
- 4.1 Zum Verständnis von Kindheit
- 4.2 Kindliche Lebens- und Bewegungswelt im Wandel
- 4.2.1 Veränderte Lebenswelt
- 4.2.2 Veränderte Bewegungsumwelt
- 4.2.2.1 Zum Begriff „Bewegungsumwelt“
- 4.2.2.2 Bewegungsumwelt im historischen Wandel
- 5. Das Bewegungsverhalten von Kindern heute
- 5.1 Gesellschaftlich vorherrschender Tenor
- 5.2 Anmerkungen zur „Defizithypothese“ in aktuellen Diskursen über Kinder und Bewegung
- 5.2.1 Kinder als aktive Gestalter ihrer Umwelt
- 5.3 Wie bewegen sich Kinder heute?
- 5.3.1 Informelle Bewegungsaktivität
- 5.3.1.1 Neue Bewegungsszenen
- 5.3.2 Formelle Vereinsaktivität
- 5.3.3 Kindersportkultur
- 5.3.1 Informelle Bewegungsaktivität
- 6. Zusammenfassende Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Bewegungsverhalten von Kindern im Kontext der heutigen Gesellschaft. Sie analysiert die widersprüchlichen Tendenzen zwischen Bewegungseinschränkungen und dem breiten Angebot an Sportmöglichkeiten. Die Arbeit beleuchtet die Veränderungen der kindlichen Lebens- und Bewegungswelt und hinterfragt gängige Defizithypothesen.
- Veränderung der kindlichen Lebenswelt und Bewegungsumwelt
- Analyse des gegenwärtigen Bewegungsverhaltens von Kindern
- Bewertung der „Defizithypothese“ bezüglich Bewegungsarmut bei Kindern
- Einfluss von gesellschaftlichen Faktoren auf die Bewegungsaktivitäten von Kindern
- Untersuchung formeller und informeller Bewegungsaktivitäten
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt die widersprüchliche Situation der kindlichen Bewegungswelt: Bewegungseinschränkungen durch die Umwelt stehen einem breiten Angebot an Sportmöglichkeiten gegenüber. Sie stellt die Forschungsfrage nach dem gegenwärtigen Bewegungsverhalten von Kindern und den damit verbundenen kontroversen Auffassungen in der Forschung dar. Die Einleitung skizziert die zentralen Fragen der Arbeit und die Ambivalenz der bestehenden Literatur zum Thema.
2. Das Menschenbild: Dieses Kapitel beleuchtet verschiedene Menschenbilder und deren Einfluss auf das Verständnis von kindlicher Bewegung. Es analysiert sowohl humanistische Menschenbilder als auch spezifische Auffassungen vom Kind und dessen angeborenen Bedürfnissen nach Bewegung. Der Abschnitt legt die Grundlage für die spätere Betrachtung der Bewegungsentwicklung und des Bewegungsverhaltens.
3. Bewegung: Das Kapitel widmet sich dem grundsätzlichen Verständnis von Bewegung, insbesondere im Hinblick auf Kinder. Es untersucht Bewegung als anthropologisches Grundbedürfnis, analysiert den kindlichen Bewegungsdrang und die anthropologischen Annahmen über Bewegung im Kindesalter. Zudem werden Faktoren und Voraussetzungen für die Bewegungsentwicklung detailliert erläutert.
4. Kindheit heute: Hier wird die veränderte Lebens- und Bewegungswelt von Kindern im Vergleich zu früheren Generationen analysiert. Der Wandel der Umwelt, einschließlich der Bewegungsumwelt, wird im Detail untersucht, und es werden die Konsequenzen für die Bewegungsentwicklung von Kindern diskutiert. Der Begriff "Bewegungsumwelt" wird definiert und historisch eingeordnet.
5. Das Bewegungsverhalten von Kindern heute: Dieses Kapitel präsentiert eine detaillierte Analyse des aktuellen Bewegungsverhaltens von Kindern. Es untersucht den gesellschaftlichen Tenor, kritisch die „Defizithypothese“ und die Argumente dagegen, und beschreibt verschiedene Arten von Bewegungsaktivitäten (informell, formell im Verein, Kindersport). Der Fokus liegt auf der Vielfalt des Bewegungsverhaltens und der Komplexität der Einflussfaktoren.
Schlüsselwörter
Bewegungsverhalten, Kinder, Bewegungsumwelt, Kindheit, Sport, Defizithypothese, Bewegungsentwicklung, anthropologisches Grundbedürfnis, informell, formell, Vereinsaktivität, Gesellschaft.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Bewegungsverhalten von Kindern in der heutigen Gesellschaft
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht das Bewegungsverhalten von Kindern im Kontext der heutigen Gesellschaft. Sie analysiert die widersprüchlichen Tendenzen zwischen Bewegungseinschränkungen und dem breiten Angebot an Sportmöglichkeiten und hinterfragt gängige Defizithypothesen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Veränderung der kindlichen Lebens- und Bewegungswelt, analysiert das gegenwärtige Bewegungsverhalten von Kindern, bewertet die „Defizithypothese“ bezüglich Bewegungsarmut, untersucht den Einfluss gesellschaftlicher Faktoren auf die Bewegungsaktivitäten von Kindern und untersucht formell und informell stattfindende Bewegungsaktivitäten.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung, Das Menschenbild, Bewegung, Kindheit heute, Das Bewegungsverhalten von Kindern heute und eine zusammenfassende Schlussbetrachtung. Jedes Kapitel befasst sich mit spezifischen Aspekten des Bewegungsverhaltens von Kindern, von anthropologischen Grundlagen bis hin zu aktuellen gesellschaftlichen Einflüssen.
Was wird unter „Bewegungsumwelt“ verstanden?
Der Begriff „Bewegungsumwelt“ wird im Kapitel 4 definiert und historisch eingeordnet. Er beschreibt den Einfluss der räumlichen Gegebenheiten und der gesellschaftlichen Strukturen auf die Bewegungsmöglichkeiten von Kindern.
Was ist die „Defizithypothese“ und wie wird sie in der Arbeit behandelt?
Die „Defizithypothese“ behauptet eine Bewegungsarmut bei Kindern. Die Arbeit analysiert kritisch diese Hypothese und die Argumente dagegen, betont die aktive Gestaltung der Umwelt durch Kinder und präsentiert verschiedene Arten von Bewegungsaktivitäten (informell, formell im Verein, Kindersport).
Welche Arten von Bewegungsaktivitäten werden untersucht?
Die Arbeit unterscheidet zwischen informellen Bewegungsaktivitäten (z.B. freies Spielen) und formellen Bewegungsaktivitäten (z.B. Vereins- und Kindersport). Sie analysiert die verschiedenen Szenarien und deren Bedeutung für die kindliche Entwicklung.
Welches Menschenbild liegt der Arbeit zugrunde?
Kapitel 2 beleuchtet verschiedene Menschenbilder und deren Einfluss auf das Verständnis von kindlicher Bewegung. Es analysiert humanistische Menschenbilder und spezifische Auffassungen vom Kind und dessen angeborenen Bedürfnissen nach Bewegung.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die zusammenfassende Schlussbetrachtung fasst die Ergebnisse der Analyse zusammen und bietet eine umfassende Bewertung des Bewegungsverhaltens von Kindern in der heutigen Gesellschaft. Die genauen Schlussfolgerungen sind im letzten Kapitel der Arbeit detailliert beschrieben.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Bewegungsverhalten, Kinder, Bewegungsumwelt, Kindheit, Sport, Defizithypothese, Bewegungsentwicklung, anthropologisches Grundbedürfnis, informell, formell, Vereinsaktivität, Gesellschaft.
- Quote paper
- Natascha Finger (Author), 2001, Kinder und Bewegung heute: Stubenhocker oder Springinsfeld?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/3871