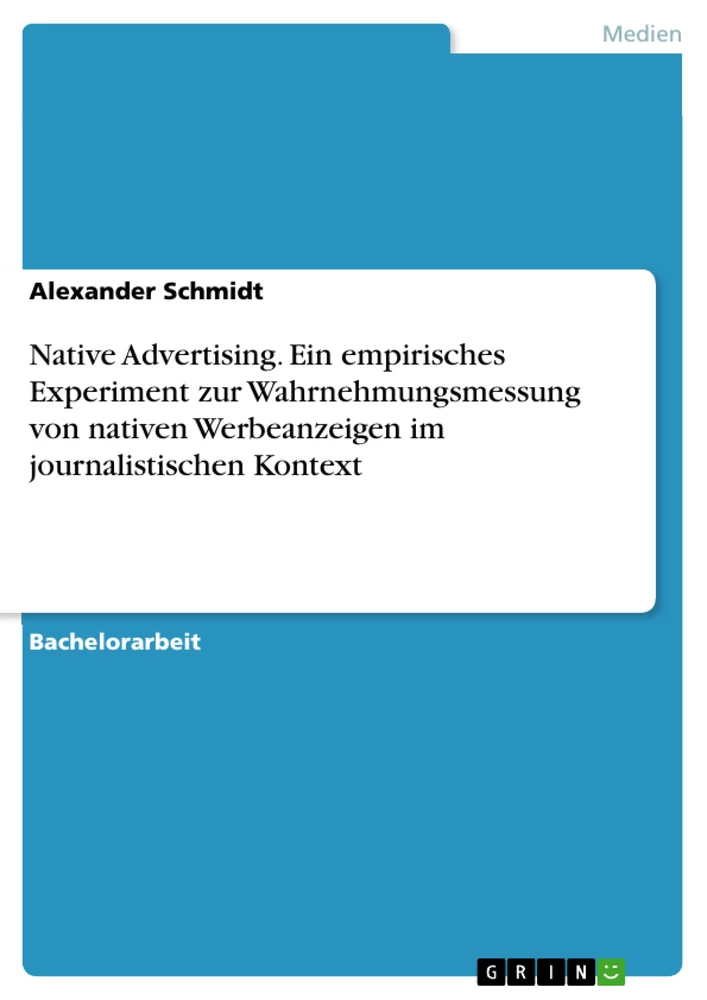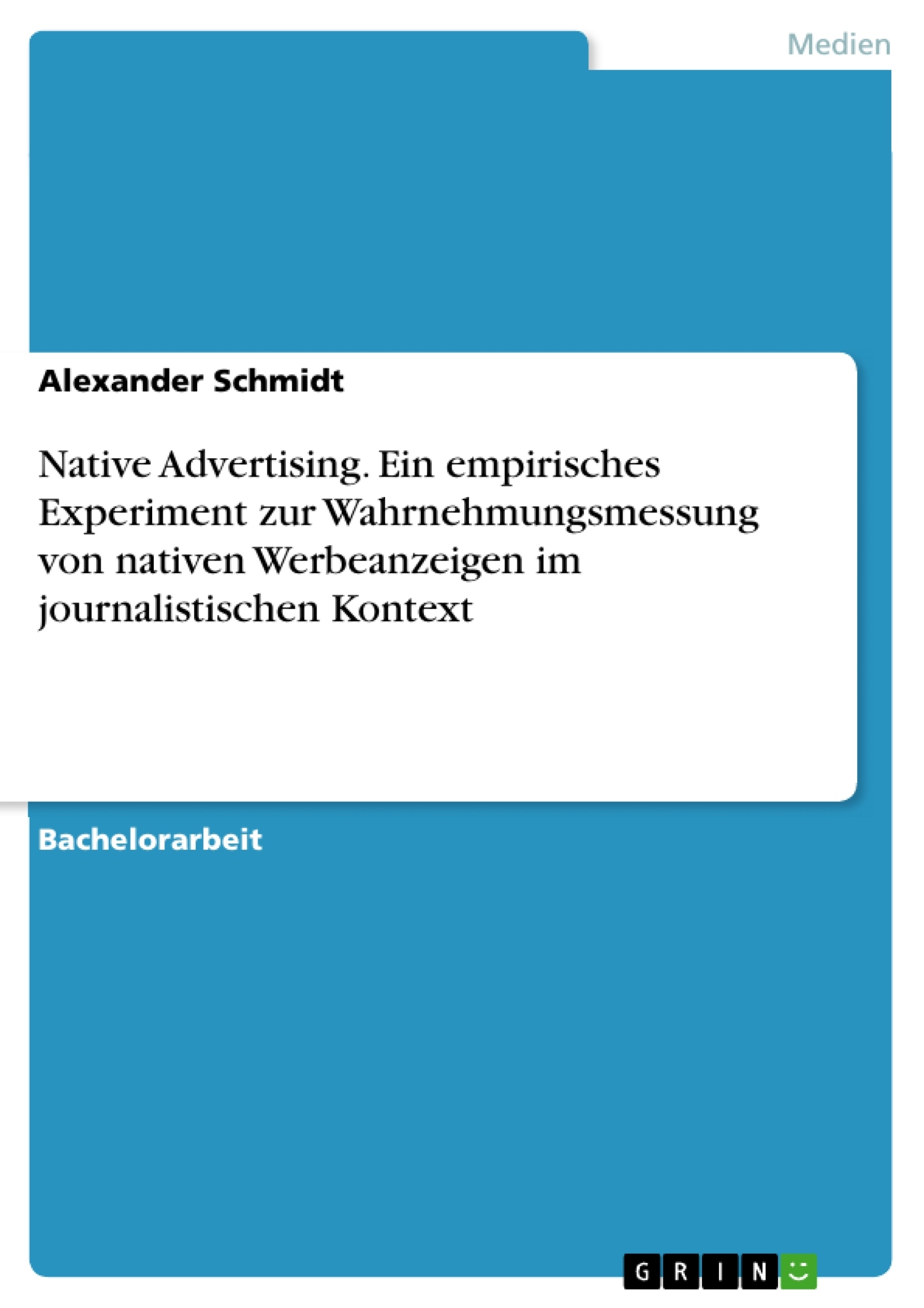Statistisch gesehen ist es um einen neunzigfachen Faktor wahrscheinlicher, an der Elite-Universität Harvard angenommen zu werden, als auf eine Online-Werbeanzeige zu klicken. Werbebanner und vor allem Pop-Ups werden von Nutzern als 'störend' bewertet, weshalb immer mehr User auf Adblocker setzen.
Das zeigt die fatale Situation der klassischen Online-Werbung. Daher sind werbetreibende Unternehmen an einem Werbeformat interessiert, welches sich dem Umfeld der Plattform anpasst und von Adblockern nicht erfasst wird. Webseitenbetreiber sind hierbei in einer misslichen Lage, da sie sowohl auf die Werbeeinnahmen der Unternehmen als auch auf das Vertrauen der Rezipienten in die journalistische Authentizität angewiesen sind. Deshalb sollten sie ebenfalls an Lösungen interessiert sein, die beide Parteien zufrieden stellen.
Einen Lösungsansatz bietet das Native Advertising. Dies bezeichnet eine Werbeform, die sich chamäleonartig an das Umfeld der journalistischen Plattform anpasst. Der Inhalt einer solchen Werbung ist nur schwierig von einem redaktionellen Artikel zu unterscheiden. Die Werbetreibenden gestalten die Werbung kontextuell, sodass diese als solche nicht sofort erkennbar ist und so die Aufmerksamkeit des Konsumenten auf das Produkt oder die beworbene Dienstleistung zieht.
Hierbei entstehen gegensätzliche Auffassungen. Dem Native Advertising wird seitens der Journalisten eine Täuschung der Leser vorgeworfen, während sich Werbetreibende mit Vorteilen für alle Beteiligten brüsten.
Die vorliegende Bachelorarbeit befasst sich mit der Wahrnehmungsmessung nativer Werbeanzeigen im journalistischen Kontext, insbesondere mit deren Kennzeichnung. Als Methode wurde das Eye-Tracking sowie ein Fragebogen genutzt.
Mit einer Probandenzahl von 40 Testpersonen, innerhalb zweier vergleichender Versuchsgruppen, bietet die Studie eine relevante Perspektive, um die Wahrnehmung werblicher Kennzeichnung darzustellen. Insbesondere soll die Untersuchung Aufschluss darüber geben, ob und inwieweit eine werbliche Kennzeichnung Einfluss auf die Glaubwürdigkeit journalistischer Plattformen ausübt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Problemstellung und Zielsetzung
- 1.2 Vorgehensweise und Gliederung der Arbeit
- 2. Theoretische Grundlagen
- 2.1 Diskussion relevanter Begrifflichkeiten
- 2.1.1 Online-Marketing
- 2.1.2 Content Marketing
- 2.1.3 Native Advertising
- 2.2 Rechtliche Rahmenbedingungen von Native Advertising
- 3. Forschungsstand
- 3.1 State of the Art
- 3.2 Abgrenzung des Forschungsfeldes
- 3.3 Herleitung der Forschungsfrage und der daraus resultierenden Hypothesen
- 4. Empirische Untersuchung
- 4.1 Verwendete Methoden
- 4.1.1 Eye-Tracking
- 4.1.2 Aufbau des Fragebogens
- 4.2 Versuchsaufbau
- 4.2.1 Forschungsumgebung
- 4.2.2 Aufbau des Testszenarios
- 4.2.3 Anzahl und Rekrutierung der Probanden
- 4.2.4 Auswahl der Untersuchungsplattform
- 4.2.5 Technische Hilfsmittel
- 4.2.6 Pretest
- 4.2.7 Versuchsablauf
- 5. Auswertung der Ergebnisse
- 5.1 Darstellung des Eye-Trackings
- 5.1.1 Anzahl und Durchschnittsdauer der Fixationen
- 5.1.2 Dauer bis zum ersten Klick im Gruppenvergleich
- 5.2 Ergebnisse des Fragebogens
- 5.2.1 Bewertung der Untersuchungsplattform
- 5.2.2 Werbewahrnehmung und Akzeptanz
- 5.2.3 Einfluss der Kennzeichnung auf die Werbewirkung des Native Advertisings
- 5.2.4 Subjektive Bewertung der Werbeform
- 6. Diskussion
- 6.1 Beantwortung der Forschungsfrage und der Hypothesen
- 6.2 Methodenkritik
- 7. Abschließendes Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelorarbeit untersucht die Wahrnehmung von Native Advertising im journalistischen Kontext, insbesondere den Einfluss der Kennzeichnung auf die Glaubwürdigkeit der Plattform. Die Arbeit kombiniert Eye-Tracking-Methoden mit Fragebögen, um ein umfassendes Verständnis der Nutzerreaktionen zu gewinnen.
- Wahrnehmungsmessung von Native Advertising
- Einfluss der Kennzeichnung auf die Werbewirkung
- Glaubwürdigkeit journalistischer Plattformen
- Anwendung von Eye-Tracking und Fragebogenmethoden
- Analyse der Nutzerreaktionen auf native Werbung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik des Native Advertising ein und beschreibt die Problemstellung der Arbeit. Es definiert die Forschungsfrage und skizziert die Vorgehensweise und die Struktur der gesamten Bachelorarbeit. Die Zielsetzung ist klar umrissen und bildet die Grundlage für die nachfolgenden Kapitel.
2. Theoretische Grundlagen: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen für die empirische Untersuchung. Es definiert relevante Begriffe wie Online-Marketing, Content Marketing und Native Advertising und beleuchtet die rechtlichen Rahmenbedingungen. Es liefert somit den notwendigen Kontext für die Interpretation der später gewonnenen Ergebnisse.
3. Forschungsstand: Dieses Kapitel analysiert den aktuellen Forschungsstand zum Thema Native Advertising. Es beschreibt den State of the Art, grenzt das Forschungsfeld ab und leitet daraus die Forschungsfrage und die zu testenden Hypothesen ab. Die Darstellung des bestehenden Wissens schafft Transparenz und untermauert die Relevanz der eigenen Forschung.
4. Empirische Untersuchung: In diesem Kapitel wird die Methodik der empirischen Untersuchung detailliert beschrieben. Es werden die verwendeten Methoden (Eye-Tracking und Fragebogen) vorgestellt, der Versuchsaufbau erläutert (inklusive Probandenauswahl, Testszenario und technischer Ausstattung), und der Ablauf des Experiments dargelegt. Die detaillierte Beschreibung der Methodik gewährleistet die Nachvollziehbarkeit und Reproduzierbarkeit der Studie.
5. Auswertung der Ergebnisse: Dieses Kapitel präsentiert und interpretiert die Ergebnisse der empirischen Untersuchung. Es werden die Daten des Eye-Trackings (Fixationen, Klickzeiten) und des Fragebogens (Bewertung der Plattform, Werbewahrnehmung, Akzeptanz, Einfluss der Kennzeichnung) ausgewertet und dargestellt. Die Ergebnisse werden systematisch präsentiert und bilden die Grundlage für die Diskussion im folgenden Kapitel.
6. Diskussion: Dieses Kapitel diskutiert die Ergebnisse der Studie im Kontext der Forschungsfrage und der aufgestellten Hypothesen. Es werden die Stärken und Schwächen der verwendeten Methoden kritisch reflektiert und mögliche Limitationen der Studie angesprochen.
Schlüsselwörter
Native Advertising, Werbewahrnehmung, Eye-Tracking, Fragebogen, Kennzeichnung, Glaubwürdigkeit, journalistische Plattformen, Online-Marketing, Content Marketing, empirische Untersuchung.
Häufig gestellte Fragen zur Bachelorarbeit: Wahrnehmung von Native Advertising
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit untersucht die Wahrnehmung von Native Advertising im journalistischen Kontext, insbesondere den Einfluss der Kennzeichnung auf die Glaubwürdigkeit der Plattform. Es wird untersucht, wie Nutzer*innen Native Advertising wahrnehmen und wie sich die Kennzeichnung auf die Werbewirkung auswirkt.
Welche Methoden wurden angewendet?
Die Arbeit kombiniert zwei Methoden: Eye-Tracking zur Messung der visuellen Aufmerksamkeit und Fragebögen zur Erfassung der subjektiven Wahrnehmung und Bewertung. Das Eye-Tracking erfasst Fixationen und Klickzeiten, während die Fragebögen Daten zur Werbewahrnehmung, Akzeptanz und dem Einfluss der Kennzeichnung sammeln.
Welche Forschungsfragen werden bearbeitet?
Die zentrale Forschungsfrage zielt darauf ab, den Einfluss der Kennzeichnung von Native Advertising auf die Glaubwürdigkeit der Plattform zu untersuchen. Zusätzlich werden Fragen zur Wahrnehmung von Native Advertising, zur Werbewirkung und zur Akzeptanz durch die Nutzer*innen bearbeitet.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit folgt einem klassischen wissenschaftlichen Aufbau: Einleitung mit Problemstellung und Zielsetzung, theoretische Grundlagen, Forschungsstand, empirische Untersuchung (Methodenbeschreibung und -durchführung), Auswertung der Ergebnisse, Diskussion der Ergebnisse und abschließendes Fazit. Der detaillierte Aufbau ist im Inhaltsverzeichnis ersichtlich.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Wahrnehmungsmessung von Native Advertising, den Einfluss der Kennzeichnung auf die Werbewirkung, die Glaubwürdigkeit journalistischer Plattformen und die Analyse der Nutzerreaktionen auf native Werbung. Die Anwendung von Eye-Tracking und Fragebogenmethoden ist ein weiterer Schwerpunkt.
Welche Ergebnisse wurden erzielt?
Die Ergebnisse werden im Kapitel „Auswertung der Ergebnisse“ präsentiert und diskutiert. Sie umfassen Daten des Eye-Trackings (Anzahl und Dauer der Fixationen, Klickzeiten) und des Fragebogens (Bewertung der Plattform, Werbewahrnehmung, Akzeptanz, Einfluss der Kennzeichnung). Eine detaillierte Darstellung der Ergebnisse findet sich im Haupttext der Arbeit.
Wie wird die Glaubwürdigkeit journalistischer Plattformen im Kontext von Native Advertising untersucht?
Die Glaubwürdigkeit wird untersucht, indem der Einfluss der Kennzeichnung von Native Advertising auf die Wahrnehmung der Plattform durch die Nutzer*innen analysiert wird. Es wird geprüft, ob eine eindeutige Kennzeichnung die Glaubwürdigkeit beeinflusst und ob Nutzer*innen zwischen Werbung und redaktionellem Inhalt unterscheiden können.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant für die Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselbegriffe sind: Native Advertising, Werbewahrnehmung, Eye-Tracking, Fragebogen, Kennzeichnung, Glaubwürdigkeit, journalistische Plattformen, Online-Marketing, Content Marketing und empirische Untersuchung.
Welche Limitationen der Studie werden angesprochen?
Die Limitationen der Studie werden im Diskussionskapitel kritisch reflektiert. Hier werden die Stärken und Schwächen der verwendeten Methoden und mögliche Einflüsse auf die Ergebnisse diskutiert.
- Quote paper
- Alexander Schmidt (Author), 2017, Native Advertising. Ein empirisches Experiment zur Wahrnehmungsmessung von nativen Werbeanzeigen im journalistischen Kontext, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/386996