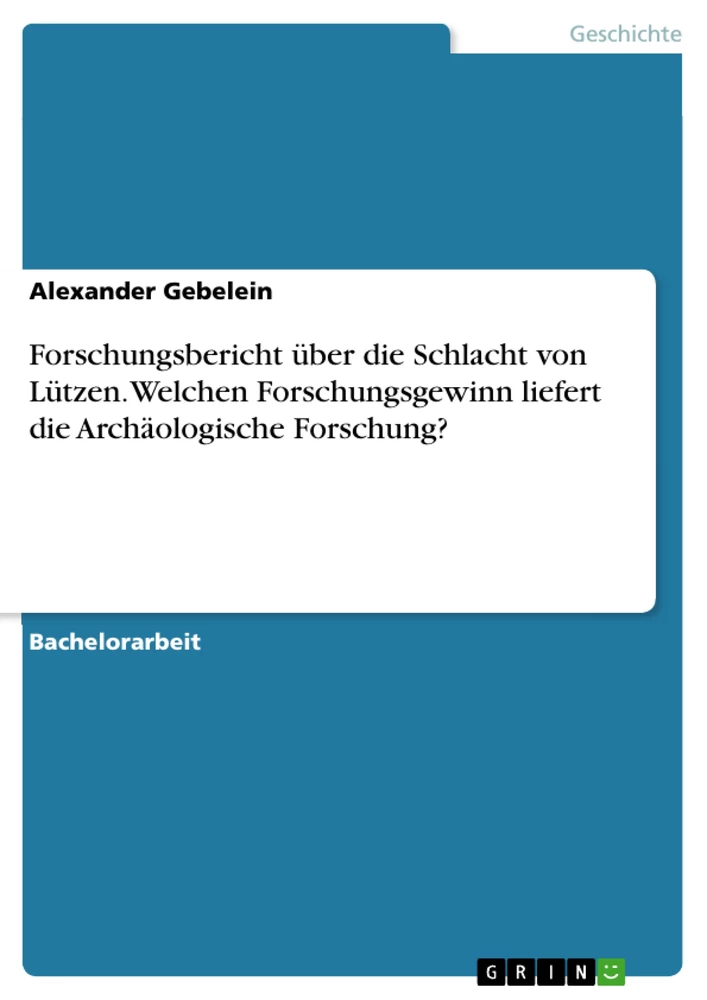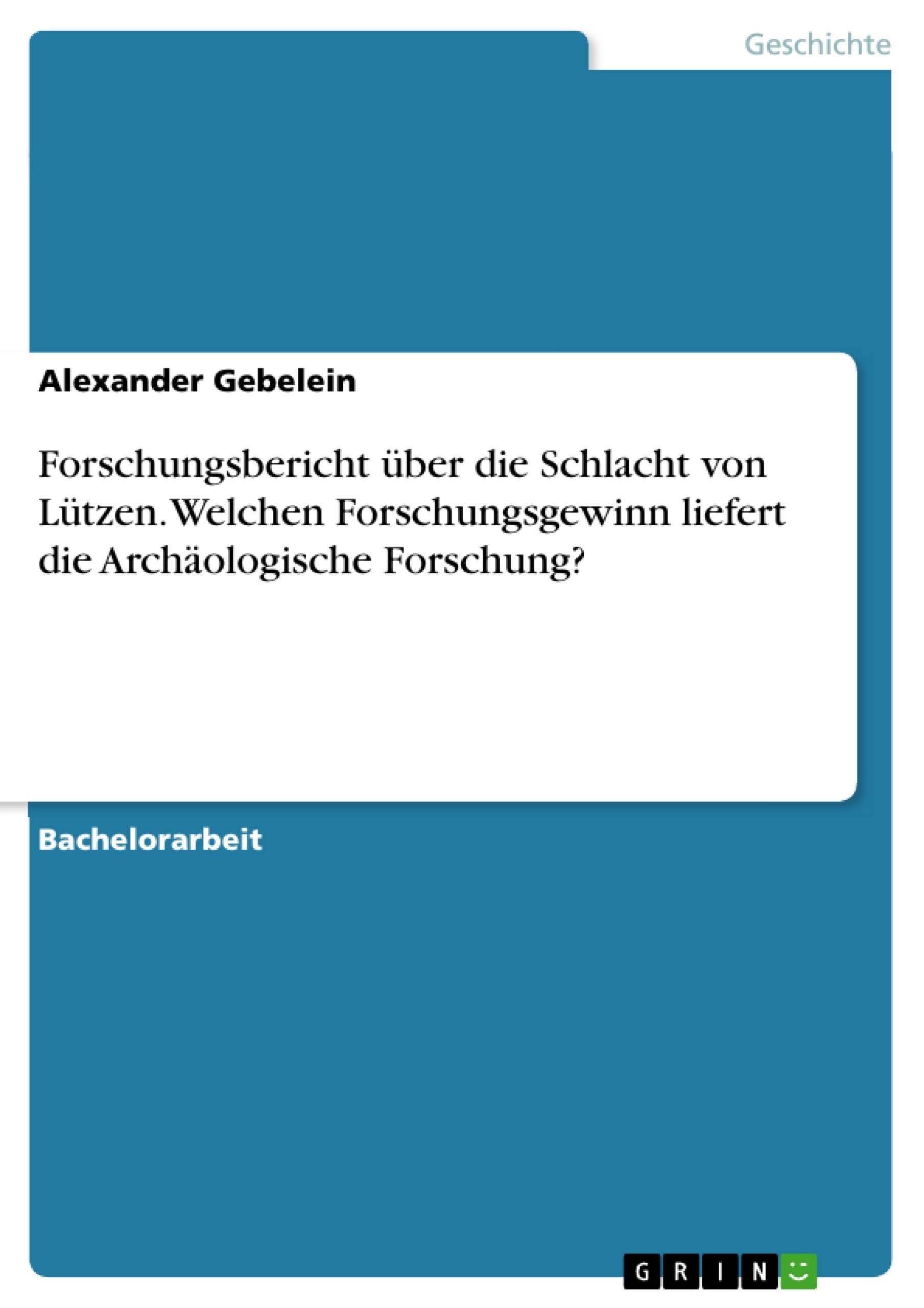Der methodische Ansatz, der in dieser Arbeit verfolgt wird, beruht auf der Herangehensweise von John Keegan, den er in seinem Werk „Das Antlitzt des Krieges“ von 1978 anwandte und die Schlachten des 17. Jahrhunderts nach einem viel allgemeineren Prinzip darstellte. Unterteilt in Infanterie gegen Infanterie oder Kavallerie gegen Artillerie, schafft er es anhand dieser Herangehensweise dem Leser die tatsächlichen Kampfweisen näherzubringen und vermittelt ihm das Gefühl bei der Schlacht dabei gewesen zu sein.
Um das Schlachtgeschehen verlässlich zu rekonstruieren, dienen dem Historiker der frühen Neuzeit schriftliche und bildliche Quellen. Im Falle des dreißigjährigen Krieges handelt es sich dabei um Schlachtpläne, Kupferstiche, wie denen im Theatrum Europaeum, Malereien und Briefe.
Um eine überzeugende Darstellung der Schlacht von Lützen bemüht sich die historische Forschung seit inzwischen fast 150 Jahren. Doch Widersprüche in schriftlichen sowie bildlichen Quellen lassen keinen zufriedenstellenden Schluss zu. Den Anspruch dieses Rätsel zu lösen, erhebt die Schlachtfeldarchäologie. Denn nur das Schlachtfeld selber kann die objektive Wahrheit preisgeben, welche anhand von subjektiven Quellen nicht zu erlangen ist. Die Untersuchungen in Lützen haben sich zu dem größten Schlachtfeldarchäologischen Projekt in Europa herauskristallisiert. Seit 2006 arbeiten Wissenschaftler unterschiedlicher Disziplinen daran, das Gelände der Schlacht zu erforschen und zu prospektieren. Das Projekt begründet ein Forschungsfeld in Deutschland, welches bis dato Hobbyhistorikern oder Schlachtfeldbuddlern überlassen wurde, die in Staaten wie Amerika, Großbritannien oder Polen schon für Aufsehen gesorgt haben. Dabei wurde ein Massengrab mit 47 gefallenen Soldaten entdeckt, welches in dieser Größenordnung Europaweit nicht zu finden war. Sie sollen erzählen, wie nicht nur ihre letzten Stunden abgelaufen sind sondern wie ihr Leben verlief. Anhand der Skelette lassen sich Aussagen zum Sterbealter, der Herkunft, den Lebensbedingungen und Aktivitäten, zu Vorerkrankungen und verheilten Verletzungen sowie zur möglichen Todesursache treffen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Erweiterter Forschungsstand
- 2.1. Historiographische Quellen
- 2.2. Historiographische Forschungsliteratur
- 2.3. Der Wert von Schlachtfeldern als historische Quelle
- 2.4. Schlachtfeldarchäologischer Forschungsstand
- 2.5. Ausgrabungen Lützen
- 3. Historischer Rahmen
- 3.1. Gustav II. Adolf und die Schweden
- 3.2. Albrecht Wallenstein
- 3.3. Bis zur Schlacht bei Lützen
- 4. Heerwesen und Taktik des 17. Jahrhunderts
- 4.1. Handfeuerwaffen
- 4.2. Infanterie
- 4.2.1. Pikeniere
- 4.2.2. Musketiere
- 4.3. Kavallerie
- 4.4. Artillerie
- 5. Wesentliche Strömungen
- 5.1. Spanisch-mediterrane Schule
- 5.2. Die kaiserlich-/lingistische Armee
- 5.3. Oranische Heeresreform
- 5.4. Die Armee Gustav Adolfs
- 6. Die Schlacht bei Lützen
- 6.1. Beschreibung Schlachtfeld
- 6.2. Archäologische Funde
- 6.3. Anmarsch, Aufstellung
- 6.4. Spielen mit Stücken
- 6.5. Kavallerie gegen Kavallerie
- 6.6. Infanterie gegen Kavallerie
- 6.7. Infanterie gegen Infanterie
- 7. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit zielt darauf ab, die Schlacht bei Lützen im Jahr 1632 anhand archäologischer und historiographischer Quellen zu untersuchen und den Forschungsgewinn der Schlachtfeldarchäologie aufzuzeigen. Sie untersucht die Schlacht nicht im Detail, sondern nutzt sie als Fallbeispiel, um das Heerwesen und die Taktik des 17. Jahrhunderts zu beleuchten.
- Das Heerwesen und die Taktik im 17. Jahrhundert
- Die Schlacht bei Lützen als historisches Ereignis
- Der Beitrag der Schlachtfeldarchäologie zur Geschichtsforschung
- Analyse historiographischer Quellen und deren Limitationen
- Vergleich verschiedener militärischer Strategien und Schulen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Schlacht bei Lützen ein und hebt die Bedeutung des Ereignisses sowohl für die schwedische als auch die deutsche Erinnerungskultur hervor. Sie betont die Lücken in der bisherigen Forschung, insbesondere den Mangel an detaillierten Darstellungen der Kampfhandlungen im 17. Jahrhundert, und skizziert den methodischen Ansatz der Arbeit, der sich an John Keegan orientiert.
2. Erweiterter Forschungsstand: Dieses Kapitel untersucht den aktuellen Forschungsstand zur Schlacht bei Lützen, indem es sowohl schriftliche als auch archäologische Quellen berücksichtigt. Es beleuchtet die Herausforderungen bei der Rekonstruktion des Schlachtverlaufs aufgrund von Widersprüchen in den Quellen und hebt die Bedeutung der Schlachtfeldarchäologie hervor, die in Lützen ein großes Projekt realisiert hat, welches ein Massengrab mit 47 Soldaten enthüllte. Diese Funde ermöglichen neue Erkenntnisse über das Leben und Sterben der Soldaten.
Schlüsselwörter
Schlacht bei Lützen, Dreißigjähriger Krieg, Schlachtfeldarchäologie, Militärgeschichte, 17. Jahrhundert, Gustav II. Adolf, Albrecht von Wallenstein, Heerwesen, Taktik, Historiographie, Quellenkritik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit über die Schlacht bei Lützen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Schlacht bei Lützen im Jahr 1632 anhand archäologischer und historiographischer Quellen. Der Fokus liegt auf der Untersuchung des Heerwesens und der Taktik des 17. Jahrhunderts, wobei die Schlacht als Fallbeispiel dient. Die Arbeit zeigt den Forschungsgewinn der Schlachtfeldarchäologie auf.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf sowohl historiographische Quellen (schriftliche Überlieferungen) als auch archäologische Funde aus Lützen. Sie berücksichtigt die Herausforderungen und Limitationen beider Quellenarten und deren Widersprüche bei der Rekonstruktion des Schlachtverlaufs.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Das Heerwesen und die Taktik im 17. Jahrhundert (Infanterie, Kavallerie, Artillerie, Handfeuerwaffen), die Schlacht bei Lützen als historisches Ereignis (Anmarsch, Aufstellung, Kampfhandlungen), den Beitrag der Schlachtfeldarchäologie zur Geschichtsforschung, die Analyse historiographischer Quellen und deren Limitationen sowie den Vergleich verschiedener militärischer Strategien und Schulen (spanisch-mediterrane Schule, kaiserlich-/lingistische Armee, oranische Heeresreform, Armee Gustav Adolfs).
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Erweiterter Forschungsstand (einschließlich historiographischer Quellen, historiographischer Forschungsliteratur, dem Wert von Schlachtfeldern als historische Quelle, dem Stand der Schlachtfeldarchäologie und den Ausgrabungen in Lützen), Historischer Rahmen (Gustav II. Adolf, Albrecht Wallenstein, die Ereignisse vor der Schlacht), Heerwesen und Taktik des 17. Jahrhunderts, Wesentliche Strömungen im Militärwesen des 17. Jahrhunderts, Die Schlacht bei Lützen (Beschreibung des Schlachtfelds, archäologische Funde, Anmarsch und Aufstellung der Armeen, detaillierte Beschreibung der Kampfhandlungen), Schluss.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Schlacht bei Lützen, Dreißigjähriger Krieg, Schlachtfeldarchäologie, Militärgeschichte, 17. Jahrhundert, Gustav II. Adolf, Albrecht von Wallenstein, Heerwesen, Taktik, Historiographie, Quellenkritik.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Schlacht bei Lützen anhand archäologischer und historiographischer Quellen zu untersuchen und den Forschungsgewinn der Schlachtfeldarchäologie aufzuzeigen. Sie nutzt die Schlacht als Fallbeispiel, um das Heerwesen und die Taktik des 17. Jahrhunderts zu beleuchten.
Welche Zusammenfassung der Kapitel bietet die Arbeit?
Die Arbeit bietet detaillierte Zusammenfassungen jedes Kapitels, insbesondere der Einleitung (Einleitung in das Thema und die methodischen Ansätze), des Kapitels zum erweiterten Forschungsstand (Bewertung des Forschungsstandes und die Bedeutung der Schlachtfeldarchäologie in Lützen, inklusive des Fundes eines Massengrabes), und weiterer Kapitel.
- Quote paper
- Alexander Gebelein (Author), 2017, Forschungsbericht über die Schlacht von Lützen. Welchen Forschungsgewinn liefert die Archäologische Forschung?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/386984