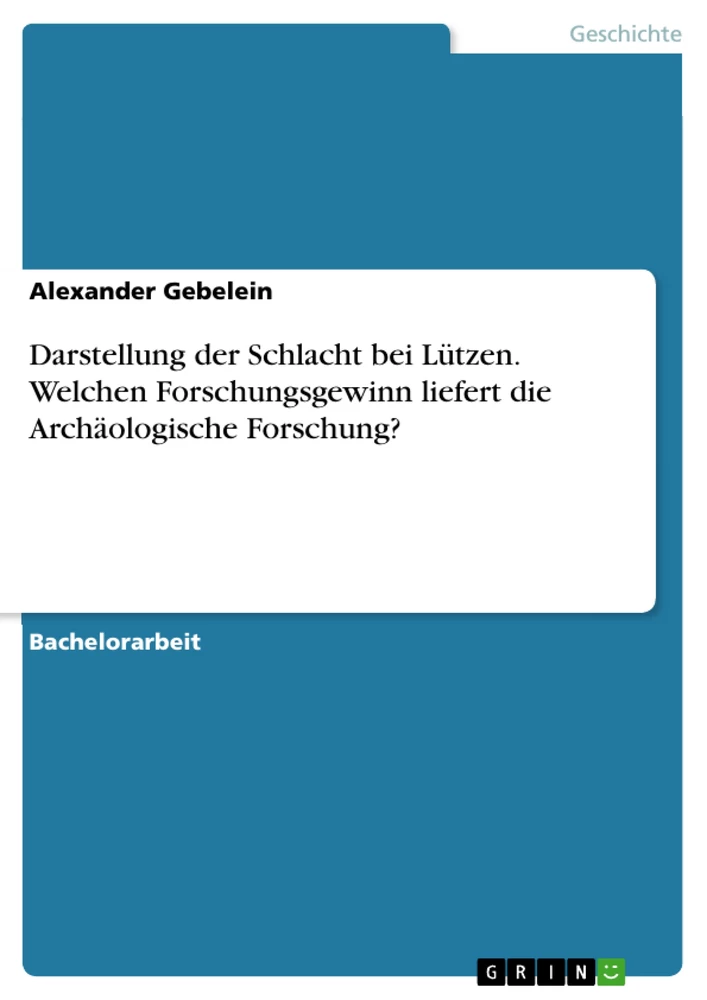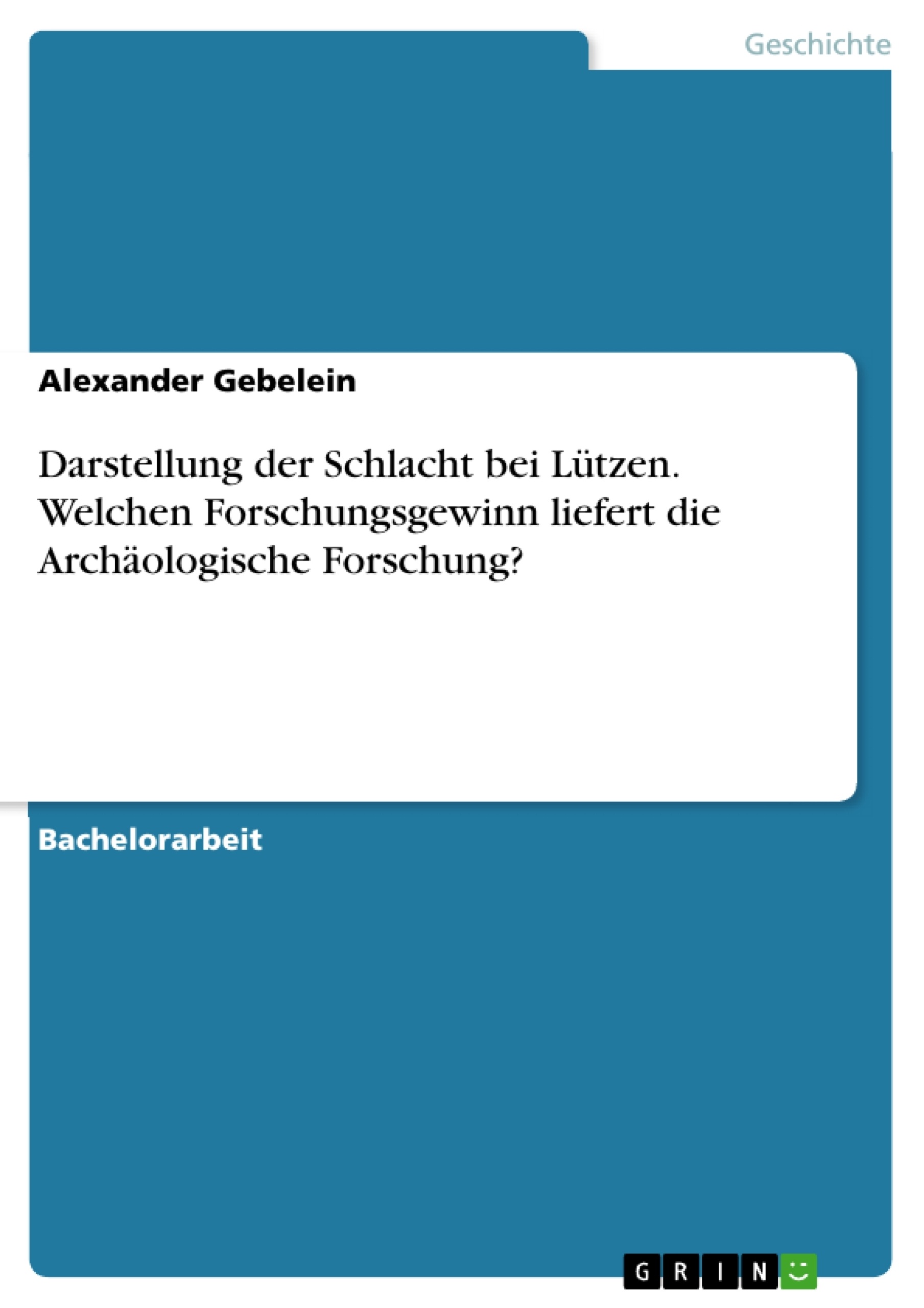"Lützen ist eine kleine Stadt in Sachsen-Anhalt, deren Name in Schweden wohl bekannter ist als in Deutschland", schrieb Maik Reichel, ehemaliger Bürgermeister und Museumsleiter der Stadt Lützen. Nach julianischem Kalender, der von Schweden zum Teil bis in das 18. Jahrhundert verwendet wurde, fand am 06. November 1632, nord-östlich angelehnt an Lützen und der nach Leipzig führenden Via Regia, eine bedeutende Schlacht des dreißigjährigen Krieges statt.
Sie ist weniger aus militärischer Sicht für die lebhafte Erinnerungskultur bedeutend. Inger Schuberth sieht auch nicht darin die Bedeutung Lützens, dass sich die beiden herausragenden Persönlichkeiten des dreißigjährigen Krieges, Gustav II. Adolf König von Schweden und Retter der Protestanten und Albrecht von Wallenstein Generalissimus der kaiserlichen Truppen, zum ersten Mal in einer offenen Feldschlacht gegenüberstanden. Sie sieht in dem Tod des lutherischen König Schwedens in dem protestantischen Kernland die Bedeutung, die der Schlacht beizumessen ist. Wohingegen Lützen kaum in Deutschland bekannt ist, ist es aus der schwedischen Erinnerungskultur nicht wegzudenken. Verwunderlich ist es nicht, dass die ereignisorientierte schwedische Geschichtswissenschaft, sich den Todesumständen dieser Ikone verschrieben hatte. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Erweiterter Forschungsstand
- Historiographische Quellen
- Historiographische Forschungsliteratur
- Der Wert von Schlachtfeldern als historische Quelle
- Schlachtfeldarchäologischer Forschungsstand
- Ausgrabungen Lützen
- Historischer Rahmen
- Gustav II. Adolf und die Schweden
- Albrecht Wallenstein
- Bis zur Schlacht bei Lützen
- Heerwesen und Taktik des 17. Jahrhunderts
- Handfeuerwaffen
- Infanterie
- Pikeniere
- Musketiere
- Kavallerie
- Artillerie
- Wesentliche Strömungen
- Spanisch-mediterrane Schule
- Die kaiserlich-/ lingistische Armee
- Oranische Heeresreform
- Die Armee Gustav Adolfs
- Die Schlacht bei Lützen
- Beschreibung Schlachtfeld
- Archäologische Funde
- Anmarsch, Aufstellung
- Spielen mit Stücken
- Kavallerie gegen Kavallerie
- Infanterie gegen Kavallerie
- Infanterie gegen Infanterie
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Schlacht bei Lützen aus archäologischer Perspektive und analysiert, welchen Forschungsgewinn die Schlachtfeldarchäologie für das Verständnis des Geschehens bietet. Ziel ist es, die Schlacht nicht nur als historisches Ereignis zu betrachten, sondern auch die Erkenntnisse der Archäologie in den Blick zu nehmen, um ein tieferes Verständnis der militärischen Taktiken und der Lebensbedingungen der Soldaten zu erlangen.
- Die Bedeutung der Schlacht bei Lützen für die Geschichte des Dreißigjährigen Krieges
- Der Forschungsstand zur Schlacht bei Lützen, insbesondere die Rolle historiographischer und archäologischer Quellen
- Die Herausforderungen und Möglichkeiten der Schlachtfeldarchäologie, anhand des Beispiels Lützen
- Die Rekonstruktion des Heerwesens und der Taktik des 17. Jahrhunderts durch die Analyse archäologischer Funde
- Die wissenschaftliche Bedeutung von Schlachtfeldarchäologie als Ergänzung zur historischen Forschung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Schlacht bei Lützen und deren Bedeutung im Kontext des Dreißigjährigen Krieges vor. Sie beleuchtet die unterschiedlichen Perspektiven auf die Schlacht, insbesondere die schwedische und deutsche Erinnerungskultur. Des Weiteren wird die Problematik der historischen Forschung im Bereich des Militärwesens des 17. Jahrhunderts aufgezeigt, die durch fehlende detaillierte Informationen über die tatsächlichen Kampfweisen erschwert wird. Der erweiterte Forschungsstand analysiert den aktuellen Stand der historischen und archäologischen Forschung zur Schlacht. Es werden die Quellenlage, die Bedeutung von Schlachtfeldern als historische Quellen und die Herausforderungen der Schlachtfeldarchäologie beleuchtet. Das Kapitel „Historischer Rahmen“ liefert einen Kontext für die Schlacht, indem es die Figuren von Gustav II. Adolf und Albrecht Wallenstein sowie die politischen und militärischen Ereignisse vor der Schlacht beleuchtet. Das Kapitel „Heerwesen und Taktik des 17. Jahrhunderts“ befasst sich mit den verschiedenen militärischen Einheiten und deren Einsatz im Dreißigjährigen Krieg. Hierbei werden die Infanterie, die Kavallerie und die Artillerie sowie die Waffen und Taktiken des 17. Jahrhunderts näher betrachtet. Das Kapitel „Wesentliche Strömungen“ analysiert verschiedene militärische Strömungen, die im 17. Jahrhundert prägend waren, und stellt die Armee Gustav Adolfs im Vergleich zu anderen europäischen Armeen dar. Das Kapitel „Die Schlacht bei Lützen“ beschreibt das Schlachtfeld, die archäologischen Funde, den Anmarsch, die Aufstellung und den Verlauf der Schlacht. Es werden verschiedene Phasen der Schlacht detailliert betrachtet, wie das „Spielen mit Stücken“, der Einsatz von Kavallerie und die Gefechte zwischen Infanterieeinheiten.
Schlüsselwörter
Schlacht bei Lützen, Dreißigjähriger Krieg, Schlachtfeldarchäologie, Heerwesen, Taktik, Infanterie, Kavallerie, Artillerie, Gustav II. Adolf, Albrecht Wallenstein, historiographische Quellen, archäologische Funde, Rekonstruktion.
- Quote paper
- Alexander Gebelein (Author), 2017, Darstellung der Schlacht bei Lützen. Welchen Forschungsgewinn liefert die Archäologische Forschung?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/386972