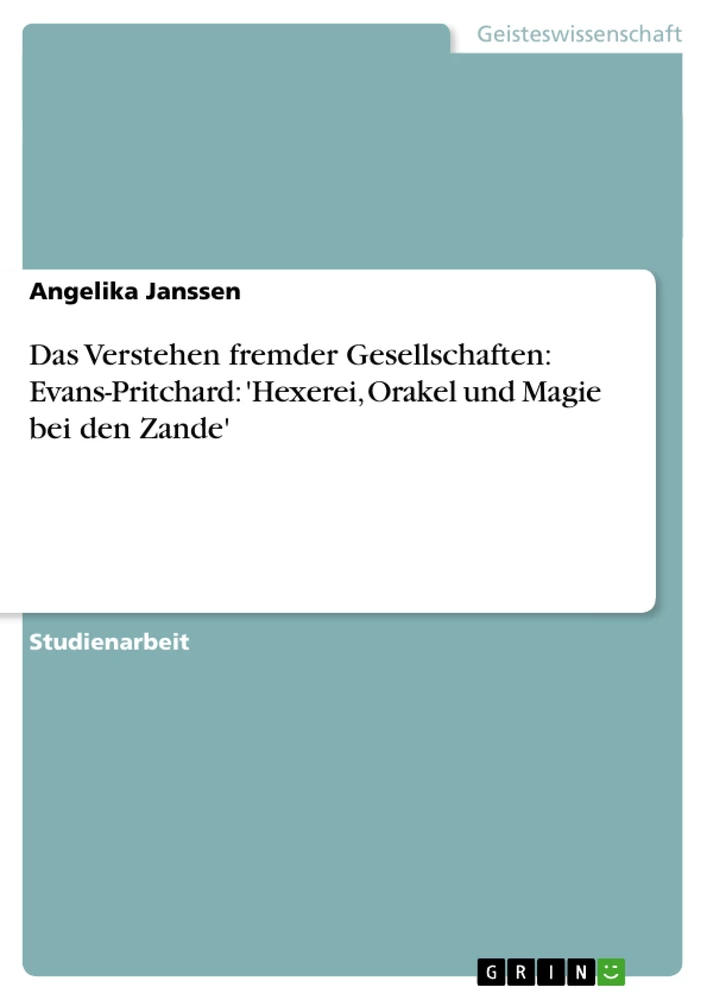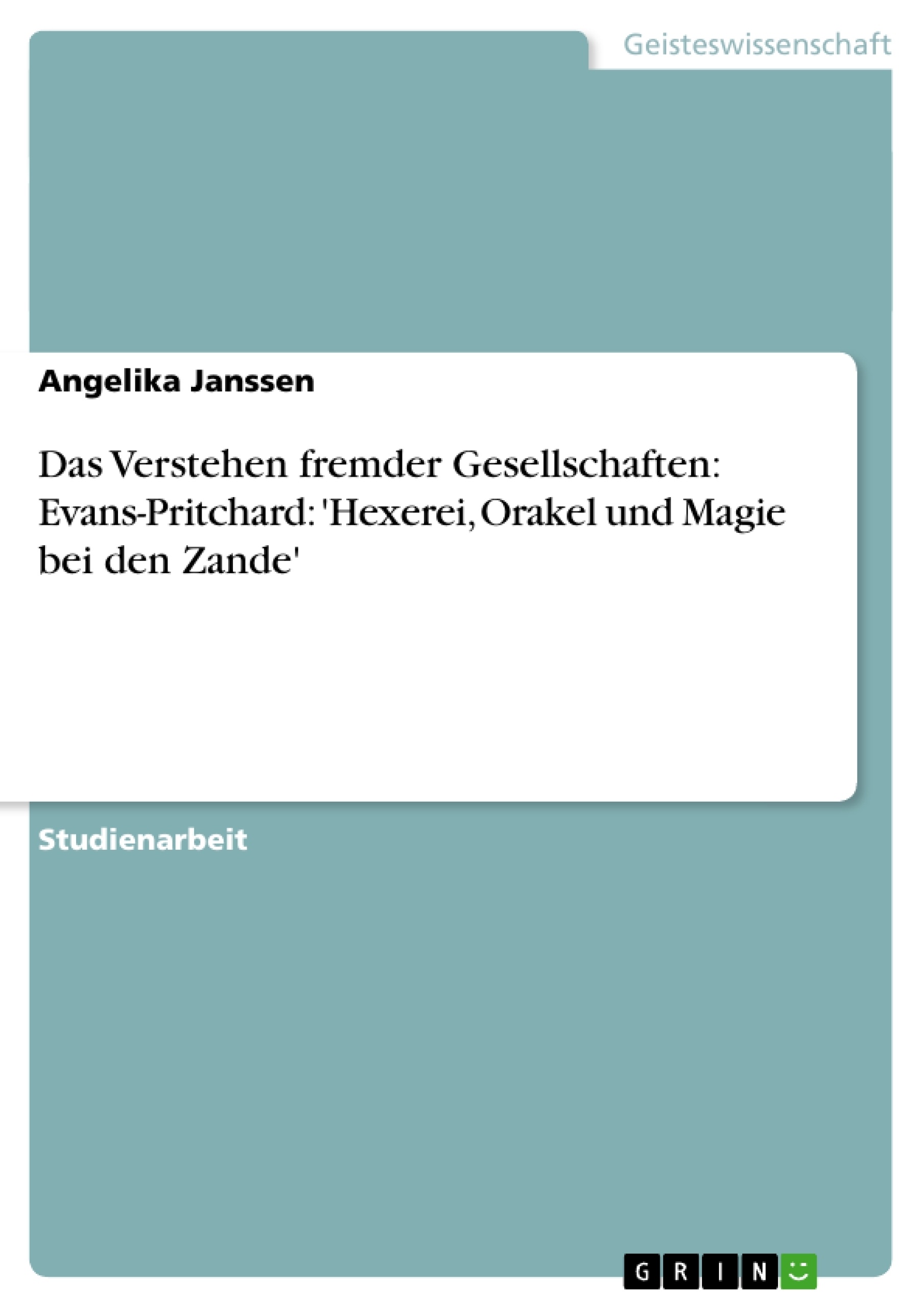Der Ethnologe Edward Evan Evans-Pritchard promovierte 1927 mit einer Arbeit über die soziale Organisation der sudanesischen Zande. Eine gekürzte Version dieser Studie wurde erstmals 1937 unter dem Titel Hexerei, Orakel und Magie bei den Zande veröffentlicht und wurde für die Ethnologen des anschließenden Jahrzehnts ein Standardwerk, das auf die ethnologische Forschung der Nachkriegszeit von großem Einfluß war. In der Folgezeit beschäftigten sich zahlreiche Studien mit den Phänomenen Hexerei und Zauberei, wovon der überwiegende Teil sich den soziologischen Aspekten der Verbreitung magischer Praktiken in bestimmten Gesellschaften widmeten, während Evans-Pritchard einen darüber hinaus ins Religiöse und Metaphysiche gehenden Ansatz verfolgt, an den Peter Winch später in seiner Kritik an Evans- Pritchards Darstellung anknüpft. Evans-Pritchard begnügte sich nicht mit dem Zusammentragen bereits verschriftlichter Beobachtungen (wie beispielsweise Frazer), sondern stützte seine Ausführungen auf eigene Feldforschung. Als Malinowski-Schüler bemühte er sich um größtmögliche Einfühlung und Einfügung in die fremde Kultur; die Schilderungen seiner beobachtenden Teilnahme offenbaren jedoch vielfach seine europäischen Rationalitätsmaßstäbe. Die Anwendung westlicher Kategorien - wie Vernunft und Wissenschaft - wirft die Frage nach der Verstehbarkeit fremder Denkweisen auf. Der europäische Maßstab verzerrt das, was abgebildet werden soll, in diesem Fall: die magischen Praktiken. Evans-Pritchard thematisiert das Problem durchaus und versucht, der sprachlichen Komponente des Problems im Anhang mit einem Glossar der im Zusammenhang mit magischen Praktiken bei den Zande auftretenden Bezeichnungen zu begegnen. Des Weiteren vertritt er die Auffassung, eine höchst detaillierte und exakte Beschreibung impliziere bereits theoretische Schlüsse. In der vorliegenden Arbeit werden die Hauptthesen, die Evans-Pritchard über Hexerei liefert, referiert und, wo es sinnvoll ist, mit Beispielen angereichert. Die vorliegende Arbeit möchte einen Eindruck über die mit magischen Praktiken verknüpften Vorstellungen der Zande vermitteln und Evans-Pritchards Darstellung derselben verkürzt widerspiegeln. Eine Zusammenfassung der Kritik, die Peter Winch an Evans-Pritchards Ansatz in seinem Aufsatz „Was heißt eine primitive Gesellschaft verstehen‘“ übt, schließt an den Hauptteil an. Dabei wird das Verhältnis der Sozialwissenschaften zur Philosophie, wie es Winch erörtert hat, aufgegriffen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung: Evans-Pritchards Hexerei, Orakel und Magie bei den Zande im Seminarkontext
- Evans-Pritchards Hauptthesen über Hexerei:
- Hexerei als körperliches und erbliches Phänomen
- Hexerei erklärt unglückliche Ereignisse
- Von einem Unglück Betroffene suchen unter ihren Feinden nach Hexern
- Kritik an Evans-Pritchards Darstellung:
- Von Evans-Pritchard angeführte Probleme seiner Studie
- Peter Winchs Kritik an Evans-Pritchards Ansatz
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit Evans-Pritchards Darstellung der Hexerei-Vorstellungen der Zande. Sie analysiert seine Hauptthesen und beleuchtet die Kritik, die Peter Winch an seinem Ansatz übt.
- Die Rolle der Hexerei in der Zande-Kultur
- Die Verbindung von Hexerei, Orakel und Magie
- Die ethnologischen und soziologischen Aspekte der Hexerei
- Die Kritik an Evans-Pritchards Methodik und Interpretation
- Das Verhältnis von Sozialwissenschaften und Philosophie
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt Evans-Pritchards Arbeit „Hexerei, Orakel und Magie bei den Zande“ im Kontext des Seminars über Peter Winch vor. Sie beleuchtet die Bedeutung des Werks für die Ethnologie und erläutert Evans-Pritchards Forschungsansatz.
Das zweite Kapitel behandelt Evans-Pritchards Hauptthesen zur Hexerei bei den Zande. Es beschreibt Hexerei als ein körperliches und erbliches Phänomen, das Unglückliche Ereignisse erklärt und eine zentrale Rolle im Leben der Zande spielt.
Das dritte Kapitel beleuchtet die Kritik an Evans-Pritchards Darstellung der Zande-Kultur. Zunächst werden Probleme aufgezeigt, die Evans-Pritchard selbst in seiner Studie thematisiert. Im Anschluss wird Peter Winchs Kritik an Evans-Pritchards Ansatz vorgestellt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Hexerei, Orakel, Magie, Zande-Kultur, Ethnologie, Soziologie, Peter Winch, Evans-Pritchard, Kulturvergleich, interkulturelles Verstehen, Rationalität, magische Praktiken, Philosophie der Sozialwissenschaften.
- Citar trabajo
- Angelika Janssen (Autor), 1997, Das Verstehen fremder Gesellschaften: Evans-Pritchard: 'Hexerei, Orakel und Magie bei den Zande', Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/38682