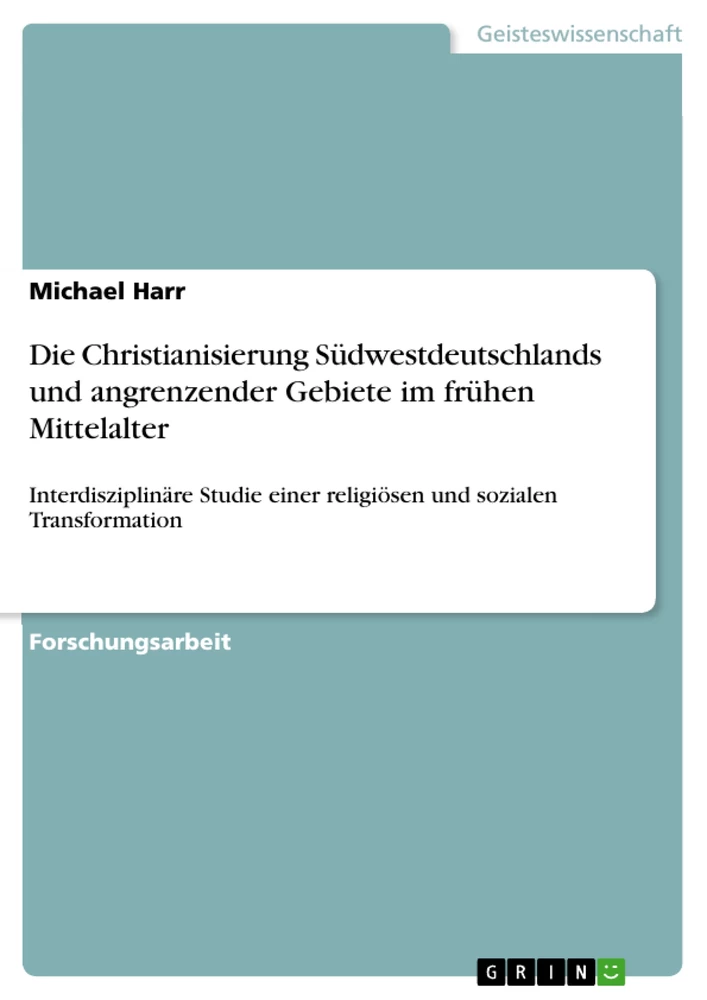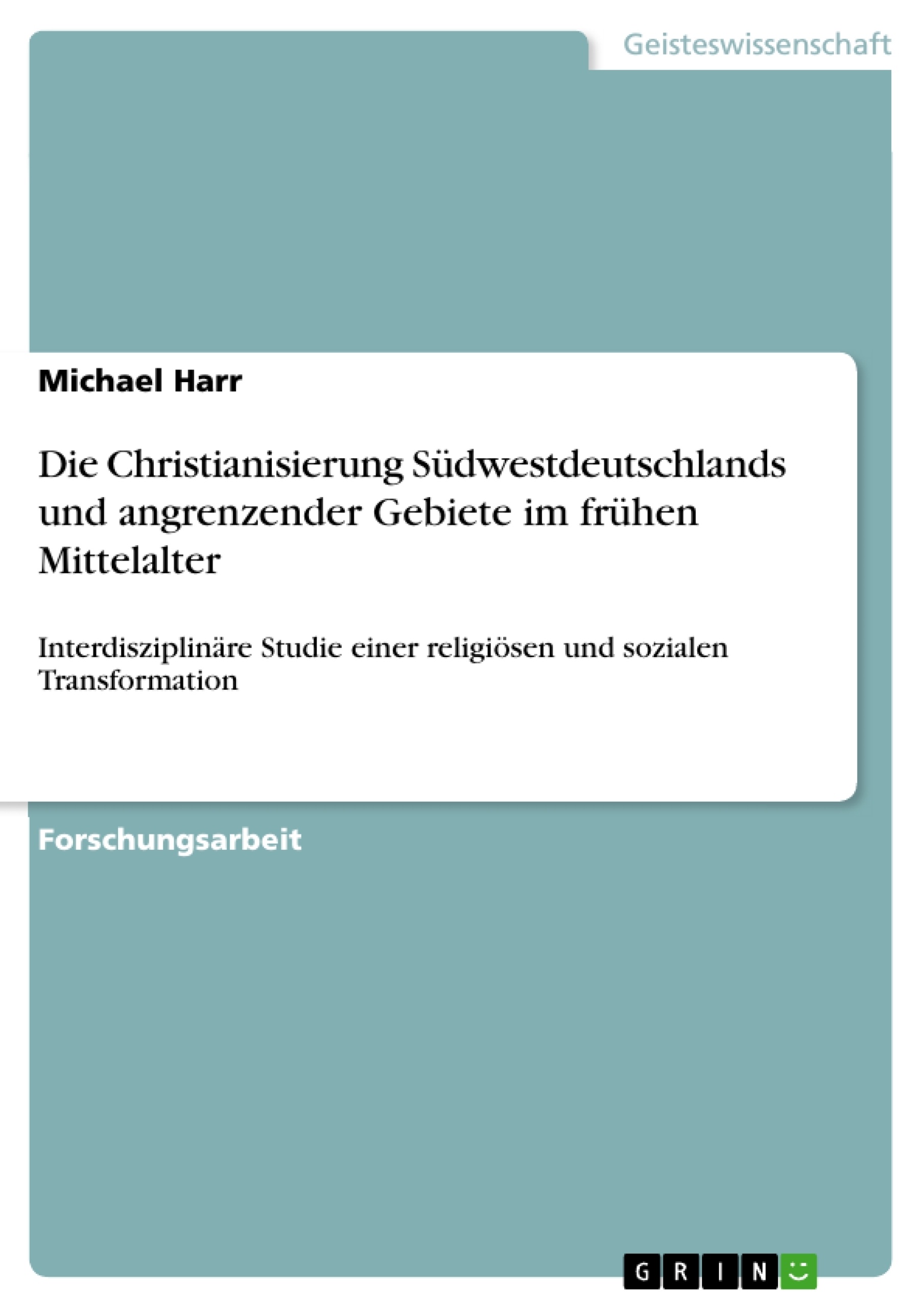In einer interdisziplinären Zusammenschau der Ergebnisse historischer, theologischer und archäologischer Forschung wird der Prozess der Christianisierung einer bestimmten Region untersucht. Dabei werden die sozialen und wirtschaftlichen Implikationen dieser Transformation erhoben und Vorschläge zur Beantwortung bislang offener Fagen in der Erforschunng dieser Epoche angeboten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung in die Thematik
- Intentionen und Ergebnisse der vorliegenden Arbeit
- Die bei der Christianisierung Südwestdeutschlands prägenden theologischen und kulturellen Einflüsse
- Zur Bedeutung des Frühmittelalters für die europäische Geschichte
- Die Zeit des Frühmittelalters in Südwestdeutschland und den angrenzenden Gebieten in der öffentlichen Wahrnehmung
- Zur ethnologischen Nomenklatur
- Die Beurteilung der Christianisierung und des damit zusammenhängenden kulturellen Umbruchs in der gegenwärtigen Diskussion
- Die Christianisierung Europas, insbesondere Mitteleuropas im Lichte der neueren Forschung
- Arnold Angenendt
- Lutz von Padberg
- Torsten Capelle
- Peter Brown
- Richard Fletcher
- Matthew Innes
- Jacques Le Goff
- Fazit des Durchgangs durch den Forschungsstand
- Die Christianisierung Südwestdeutschlands im Blickwinkel der älteren Forschung
- Räumliche und zeitliche Eingrenzung des Untersuchungsraums
- Räumliche Eingrenzung des Untersuchungsraums
- Zeitliche Eingrenzung des Untersuchungsraums
- Vorgeschichte
- Römische Herrschaft und erste germanische Landnahme im Raum des heutigen Südwestdeutschland, der Pfalz und des unteren Maingebiets
- Die vorrömische Zeit
- Die vorrömische Zeit des nachmaligen Dekumatenlandes
- Die vorrömische Zeit der Pfalz und des unteren Maingebiets
- Die römische Inbesitznahme
- Die Inbesitznahme des nachmaligen Dekumatenlandes durch die Römer
- Die Inbesitznahme der Pfalz und des unteren Maingebiets durch die Römer
- Die Wirtschaft im Dekumatenland
- Die römische Religion im Dekumatenland
- Neue Siedler aus Innergermanien Südwestdeutschland nach Rückverlegung des Limes durch die Römer
- Der Abzug der Römer
- Zurückbleibende Romanen
- Neubesiedlung des Landes durch germanische Siedler
- Zur Ethnogenese der Alamannen
- Überlegungen der „Wiener Schule“ im Hinblick auf die Ethnogenese der Alamannen
- Das Siedlungsgebiet der Alamannen
- Alamannische Kriegszüge in der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts
- Pagane religiöse Vorstellungen bei den Alamannen
- Die Entwicklung in der Pfalz und im unteren Maingebiet bis zum Jahr 500
- Die Entwicklung in der Pfalz
- Die Entwicklung im unteren Maingebiet
- Ausbreitung des Christentums unter römischer Herrschaft und dessen Fortbestand über die Völkerwanderungszeit hinweg
- Im rechtsrheinischen Gebiet
- Im linksrheinischen Gebiet
- Zur Christianisierung der Franken
- Einleitende Überlegungen zur frühmittelalterlichen Christianisierung
- Die fränkischen Alamannenkriege und ihre Folgen
- Die Parallelisierung von Konstantin und Chlodwig
- Die Bedeutung der Entscheidung Chlodwigs für das reichskirchliche und gegen das „arianische“ Christentum
- Zur konfessionellen Nomenklatur
- Die Taufe Chlodwigs als historische Weichenstellung
- Der sogenannte „Arianismus“ in seiner Konfrontation mit dem reichskirchlichen Christentum
- Sogenannter „Arianismus“ und Subordinatianismus bei den Germanen
- Der Sieg der Franken über die Alamannen als Folge göttlichen Eingreifens
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Christianisierung Südwestdeutschlands und angrenzender Gebiete im frühen Mittelalter. Ziel ist es, den religiösen und sozialen Wandel dieser Epoche interdisziplinär zu beleuchten und den Forschungsstand kritisch zu würdigen.
- Die Rolle des römischen Reiches und des römischen Christentums in der Vorgeschichte
- Die Herausbildung alamannischer Identität und deren religiöse Vorstellungen
- Der Einfluss der fränkischen Eroberungen und die Durchsetzung des nicänischen Christentums
- Die räumliche und zeitliche Eingrenzung des Prozesses der Christianisierung
- Der Vergleich verschiedener Forschungsansätze zur Christianisierung Europas
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung in die Thematik: Die Einleitung skizziert die Intentionen und Ergebnisse der Arbeit, beleuchtet die prägenden theologischen und kulturellen Einflüsse auf die Christianisierung Südwestdeutschlands und betont die Bedeutung des Frühmittelalters für die europäische Geschichte. Sie thematisiert die öffentliche Wahrnehmung dieser Epoche und die ethnologische Nomenklatur, bevor sie einen Überblick über den Forschungsstand zur frühmittelalterlichen Christianisierung Europas gibt. Besondere Aufmerksamkeit wird der Diskussion um die Beurteilung der Christianisierung und des damit verbundenen kulturellen Umbruchs gewidmet, mit detaillierter Auseinandersetzung mit verschiedenen relevanten Autoren.
Die Beurteilung der Christianisierung und des damit zusammenhängenden kulturellen Umbruchs in der gegenwärtigen Diskussion: Dieses Kapitel analysiert die aktuelle Forschung zur Christianisierung Europas, insbesondere Mitteleuropas, indem es die Ansichten von renommierten Historikern wie Angenendt, von Padberg, Capelle, Brown, Fletcher, Innes und Le Goff vorstellt und vergleicht. Es unterstreicht die verschiedenen Perspektiven und Interpretationen des Prozesses und dessen weitreichender Folgen für die betroffene Bevölkerung.
Räumliche und zeitliche Eingrenzung des Untersuchungsraums: Hier wird der geographische und chronologische Rahmen der Studie präzise definiert. Die räumliche Eingrenzung spezifiziert das Untersuchungsgebiet, während die zeitliche Eingrenzung den Fokus auf die relevanten Perioden des frühen Mittelalters legt. Diese präzise Abgrenzung ist essentiell für die methodische Stringenz der Arbeit.
Vorgeschichte: Dieses Kapitel behandelt die römische Herrschaft und die erste germanische Landnahme in Südwestdeutschland, der Pfalz und dem unteren Maingebiet. Es analysiert die vorrömische Zeit, die römische Inbesitznahme, die Wirtschaft und Religion im Dekumatenland, sowie die Ansiedlung neuer germanischer Bevölkerungsgruppen nach dem Rückzug der Römer. Die detaillierte Darstellung dieser Vorgeschichte dient als Grundlage für das Verständnis der späteren Christianisierung.
Der Abzug der Römer, Zurückbleibende Romanen, Neubesiedlung des Landes durch germanische Siedler, Zur Ethnogenese der Alamannen, Das Siedlungsgebiet der Alamannen, Alamannische Kriegszüge in der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts, Pagane religiöse Vorstellungen bei den Alamannen: Diese Kapitelkombination beschreibt die Entwicklungen nach dem römischen Abzug: die verbleibende romanische Bevölkerung, die Einwanderung und Ansiedlung germanischer Stämme, insbesondere der Alamannen, deren Ethnogenese, Siedlungsgebiete, militärische Aktivitäten und heidnische Glaubensvorstellungen. Die Zusammenführung dieser Aspekte ermöglicht ein tiefgreifendes Verständnis der komplexen sozio-kulturellen Landschaft vor der Christianisierung.
Die Entwicklung in der Pfalz und im unteren Maingebiet bis zum Jahr 500: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Entwicklungen in der Pfalz und im unteren Maingebiet bis zum Jahr 500 n. Chr. Es analysiert die politischen, sozialen und möglicherweise auch religiösen Veränderungen in diesen Gebieten und legt den Fokus auf die Entwicklungen, die die Grundlage für den späteren Prozess der Christianisierung bilden. Die detaillierte Beschreibung der lokalen Gegebenheiten ist essentiell für das Verständnis des Verlaufs der Christianisierung.
Ausbreitung des Christentums unter römischer Herrschaft und dessen Fortbestand über die Völkerwanderungszeit hinweg: Dieses Kapitel beleuchtet die Ausbreitung des Christentums sowohl im rechts- als auch im linksrheinischen Gebiet während und nach der römischen Herrschaft. Es untersucht den Fortbestand christlicher Gemeinden und Praktiken während der Völkerwanderungszeit und zeigt die Kontinuität und Veränderungen im religiösen Leben dieser Gebiete auf. Die Darstellung der Ausbreitung des Christentums vor der fränkischen Expansion ist unerlässlich für die Gesamtbetrachtung.
Zur Christianisierung der Franken: Das Kapitel konzentriert sich auf die Christianisierung der Franken, die fränkischen Alamannenkriege und ihre Folgen. Es beleuchtet die Bedeutung der Taufe Chlodwigs und die daraus resultierende Durchsetzung des nicänischen Christentums, und untersucht den Konflikt zwischen dem nicänischen und dem arianischen Christentum. Dieser Abschnitt verdeutlicht den entscheidenden Einfluss der fränkischen Expansion auf die Christianisierung Südwestdeutschlands.
Schlüsselwörter
Christianisierung, Südwestdeutschland, Frühmittelalter, Alamannen, Franken, Römisches Reich, Religion, Ethnogenese, Völkerwanderung, Konfession, Arianismus, Reichskirche, soziale Transformation, kultureller Wandel.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Christianisierung Südwestdeutschlands im Frühmittelalter
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Christianisierung Südwestdeutschlands und angrenzender Gebiete im Frühmittelalter. Sie beleuchtet den religiösen und sozialen Wandel dieser Epoche interdisziplinär und würdigt kritisch den Forschungsstand.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Rolle des römischen Reiches und des römischen Christentums in der Vorgeschichte, die Herausbildung alamannischer Identität und deren religiöse Vorstellungen, den Einfluss der fränkischen Eroberungen und die Durchsetzung des nicänischen Christentums, die räumliche und zeitliche Eingrenzung des Prozesses der Christianisierung sowie einen Vergleich verschiedener Forschungsansätze zur Christianisierung Europas.
Welche zeitliche und räumliche Eingrenzung hat die Studie?
Die Studie beschreibt den Zeitraum des Frühmittelalters und konzentriert sich geographisch auf Südwestdeutschland, die Pfalz und das untere Maingebiet. Die genaue zeitliche und räumliche Eingrenzung wird im entsprechenden Kapitel detailliert erläutert.
Welche historischen Akteure werden berücksichtigt?
Die Arbeit behandelt die Alamannen, die Franken, das Römische Reich und die Bedeutung wichtiger Persönlichkeiten wie Chlodwig I. Sie beleuchtet auch die Auseinandersetzung mit verschiedenen religiösen Strömungen, insbesondere dem Arianismus und dem nicänischen Christentum.
Welche Forschungsansätze werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht verschiedene Forschungsansätze zur Christianisierung Europas, indem sie die Ansichten und Interpretationen von renommierten Historikern wie Angenendt, von Padberg, Capelle, Brown, Fletcher, Innes und Le Goff vorstellt und analysiert.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in mehrere Kapitel gegliedert: Einleitung, Beurteilung der Christianisierung in der aktuellen Diskussion, räumliche und zeitliche Eingrenzung, Vorgeschichte (Römische Herrschaft, germanische Landnahme), der Abzug der Römer und die Folgen, die Entwicklung in der Pfalz und im unteren Maingebiet bis 500 n. Chr., die Ausbreitung des Christentums unter römischer Herrschaft und über die Völkerwanderungszeit, und schließlich die Christianisierung der Franken.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Christianisierung, Südwestdeutschland, Frühmittelalter, Alamannen, Franken, Römisches Reich, Religion, Ethnogenese, Völkerwanderung, Konfession, Arianismus, Reichskirche, soziale Transformation, kultureller Wandel.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit basiert auf einem Überblick der neueren und älteren Forschung zur Christianisierung, unter Einbezug namhafter Historiker. Spezifische Quellen werden im Haupttext genannt.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, die Christianisierung Südwestdeutschlands im Frühmittelalter interdisziplinär zu beleuchten und den Forschungsstand kritisch zu würdigen. Sie möchte den religiösen und sozialen Wandel dieser Epoche umfassend darstellen.
Wo finde ich weitere Informationen?
Der vollständige Text der Arbeit enthält detaillierte Informationen zu allen Aspekten der Christianisierung Südwestdeutschlands im Frühmittelalter.
- Quote paper
- Michael Harr (Author), 2018, Die Christianisierung Südwestdeutschlands und angrenzender Gebiete im frühen Mittelalter, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/386633