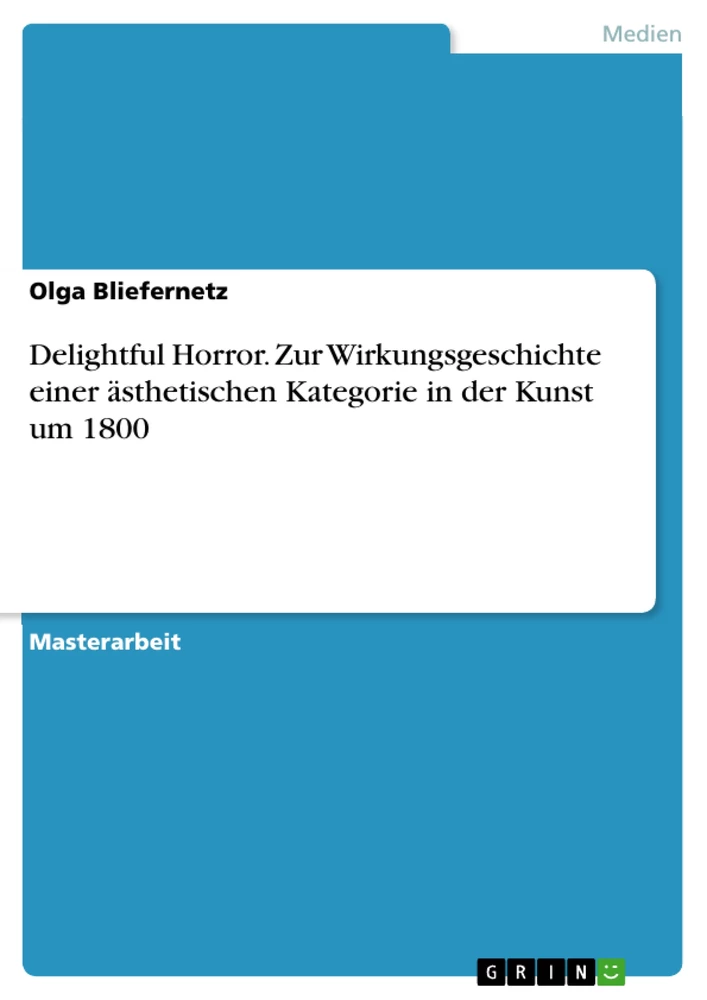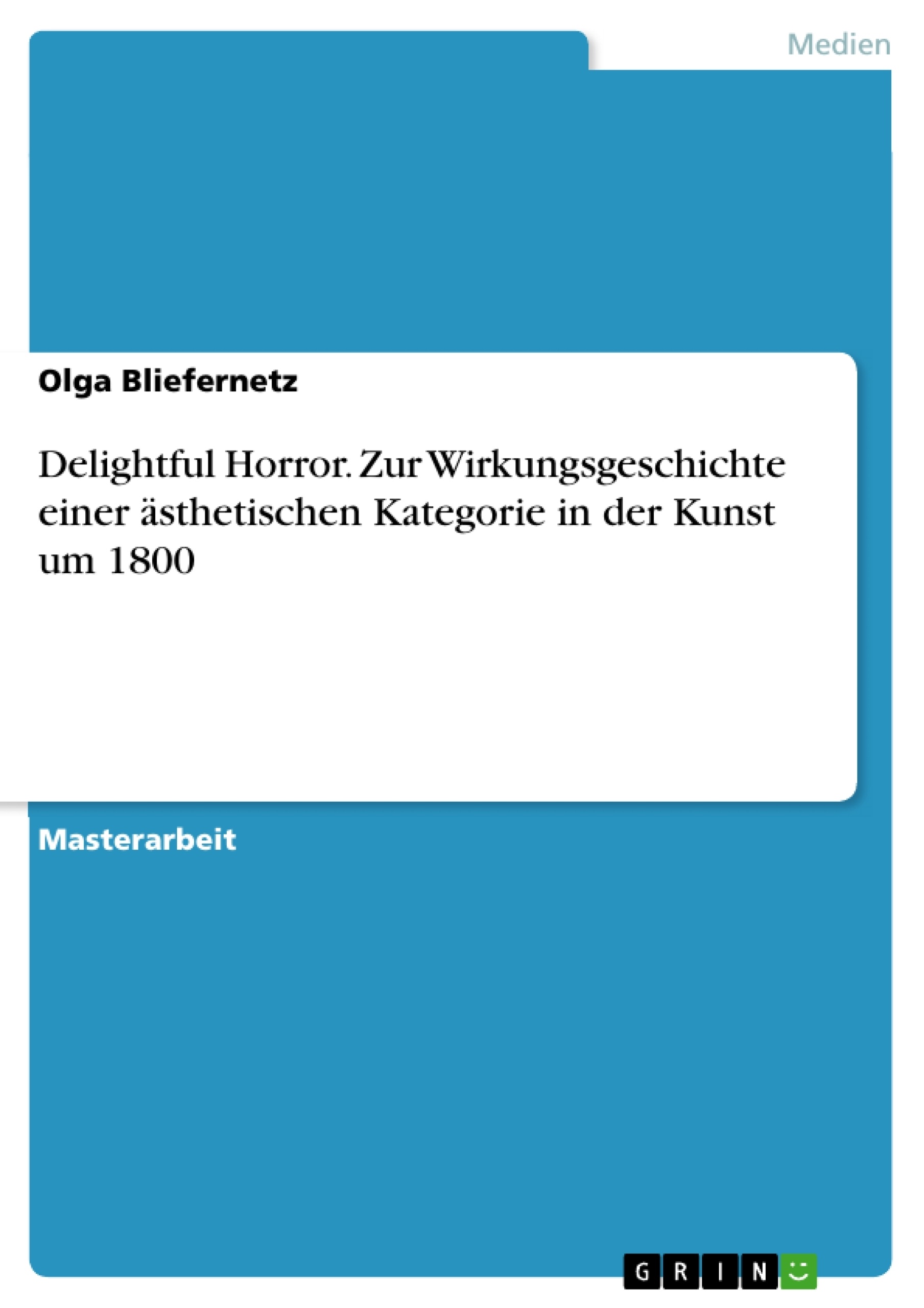Gegenstand dieser Masterarbeit mit dem Titel "Delightful Horror: Zur Wirkungsgeschichte einer ästhetischen Kategorie in der Kunst um 1800 ist die Ästhetik des Erhabenen", die im 18. Jahrhundert zu neuen Bildstrategien führte, aus denen eine Subjekt-Objekt-Relation resultierte. Anhand exemplarischer Werke gilt es aufzuzeigen, wie sich die Methode des Sublimen entfaltete, welche auf die Evokation einer emotional intensiven Reaktion beim Rezipienten abzielte.
Obwohl das Thema der Masterarbeit durch die Diskurse um das Erhabene motiviert ist, so wird eher versucht, den Begriff als Instrument einer Ausdeutung der Malerei in der Zeit um 1800, in der sein Einfluss am fruchtbarsten war, einzusetzen. Diese Epoche war vom Kulturwandel, der hauptsächlich aufgrund von Selbsterkenntnis, fortschreitender Intellektualisierung, sozialen und politischen Umstürzen sowie neuen geistigen Impulsen und Reizen ausgelöst wurde, bestimmt. Johann Heinrich Füssli schöpfte dabei als Vorreiter der sublimen Malerei sowohl aus konventionellem, als auch innovativem Theorieverständnis und erreichte auf diese Weise eine neue Synthese. In seinem Werk wählte er stets spannungsgeladene Augenblicke der Entscheidung.
Um Eindimensionalität zu vermeiden und zu verdeutlichen, wie einflussreich diese Thematik war, sodass sie zum Zeitgeschmack avancierte, werden mehrere philosophische Traktate vorgestellt. Die bedeutsamste Schrift unter ihnen ist die 1757 erschienene "Philosophische Untersuchung über den Ursprung unserer Ideen vom Erhabenen und Schönen" von Edmund Burke, der den Begriff des Erhabenen vom Schönen trennte und das Düstere, Unheimliche, Fantastische sowie Groteske miteinbezog, da nur diese Art von Dingen die gemischte und zugleich stärkste Empfindung des angenehmen Schreckens, oder auch "Delightful Horror" genannt, im Betrachter hervorrufen und dabei die Erfahrung des Sublimen implizieren können. Sein psychologischer, wirkungsästhetischer Ansatz wird zur Legitimation der neuen Kunstwerke, die sich zunehmend den Abgründen der Conditio Humana widmeten, angewendet und in die Interpretationen der zu untersuchenden Bilder Johann Heinrich Füsslis involviert. Burke nimmt daher in der Ästhetiktheorie des späten 18. Jahrhunderts eine wichtige Stellung ein.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Delightful Horror: Über den Begriff des Erhabenen
- 1.2 Das Erhabene im historischen Kontext
- 2 Johann Heinrich Füssli: Das Künstlerleben des Poet-Painters
- 3 Konzeption und Prinzipien der Malerei Füsslis
- 4 Die Erschütterung der Sinne: Zur neuen Ästhetik des Erhabenen in Johann Heinrich Füsslis Werk
- 4.1 Die Sünde, vom Tod verfolgt
- 4.1.1 Ikonografische Analyse
- 4.1.2 Ikonologische Interpretation
- 4.2 Lady Macbeth mit den Dolchen
- 4.2.1 Ikonografische Analyse
- 4.2.2 Ikonologische Interpretation
- 4.3 Der Nachtmahr
- 4.3.1 Ikonografische Analyse
- 4.3.2 Ikonologische Interpretation
- 4.1 Die Sünde, vom Tod verfolgt
- 5 Professor of Painting - Der Maler als Akademiker: Diskrepanz und Kongruenz zwischen Theorie und Praxis
- 6 Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht die ästhetische Kategorie des Erhabenen im 18. Jahrhundert und wie sie zu neuen Bildstrategien führte, die eine besondere Subjekt-Objekt-Relation hervorriefen. Anhand exemplarischer Werke von Johann Heinrich Füssli wird gezeigt, wie die Methode des Sublimen sich entfaltete, mit dem Ziel, beim Rezipienten eine emotionale Reaktion zu evozieren.
- Die historische Entwicklung des Begriffs des Erhabenen
- Die Rolle von Edmund Burke und seiner Theorie des „Delightful Horror“
- Die Anwendung der Ästhetik des Erhabenen in der Malerei von Johann Heinrich Füssli
- Die Intertextualität zwischen Text und Bild in Füsslis Kunst
- Die Beziehung zwischen Füsslis künstlerischer Praxis und seinen akademischen Schriften
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Thematik der Arbeit vor und beleuchtet den Begriff des Erhabenen im Kontext des 18. Jahrhunderts. Dabei wird insbesondere auf Edmund Burkes Theorie des „Delightful Horror“ eingegangen. Kapitel 2 widmet sich der Biografie und künstlerischen Konzeption von Johann Heinrich Füssli, während Kapitel 3 die Konzeption und Prinzipien seiner Malerei beleuchtet. Kapitel 4 untersucht die Ästhetik des Erhabenen in drei ausgewählten Gemälden Füsslis: „Die Sünde, vom Tod verfolgt“, „Lady Macbeth mit den Dolchen“ und „Der Nachtmahr“. Jede Analyse gliedert sich in eine ikonografische und ikonologische Interpretation und beinhaltet außerdem einen kulturhistorischen Kontext. Kapitel 5 beleuchtet die akademischen Schriften Füsslis und untersucht die Beziehung zwischen seiner Lehre und seiner Praxis im Hinblick auf das Erhabene. Die Arbeit endet mit einer Zusammenfassung der gewonnenen Erkenntnisse.
Schlüsselwörter
Erhabene, Delightful Horror, Edmund Burke, Johann Heinrich Füssli, Malerei, Ästhetik, Sublim, Ikonografie, Ikonologie, Intertextualität, Kunst um 1800, Kulturgeschichte, Subjekt-Objekt-Relation
- Quote paper
- Olga Bliefernetz (Author), 2014, Delightful Horror. Zur Wirkungsgeschichte einer ästhetischen Kategorie in der Kunst um 1800, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/386616