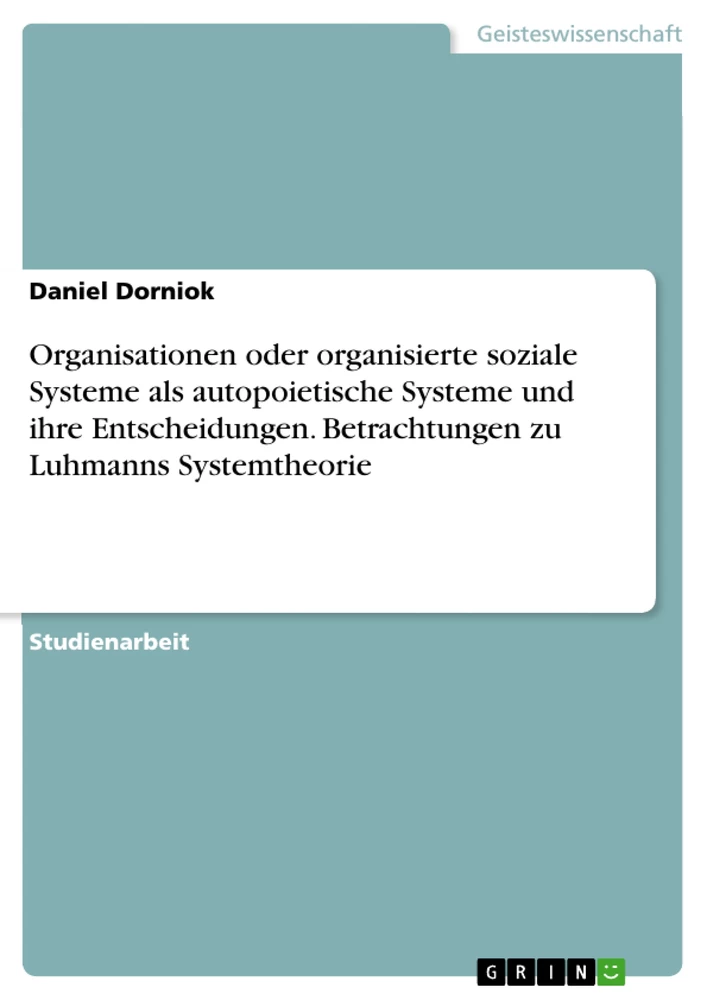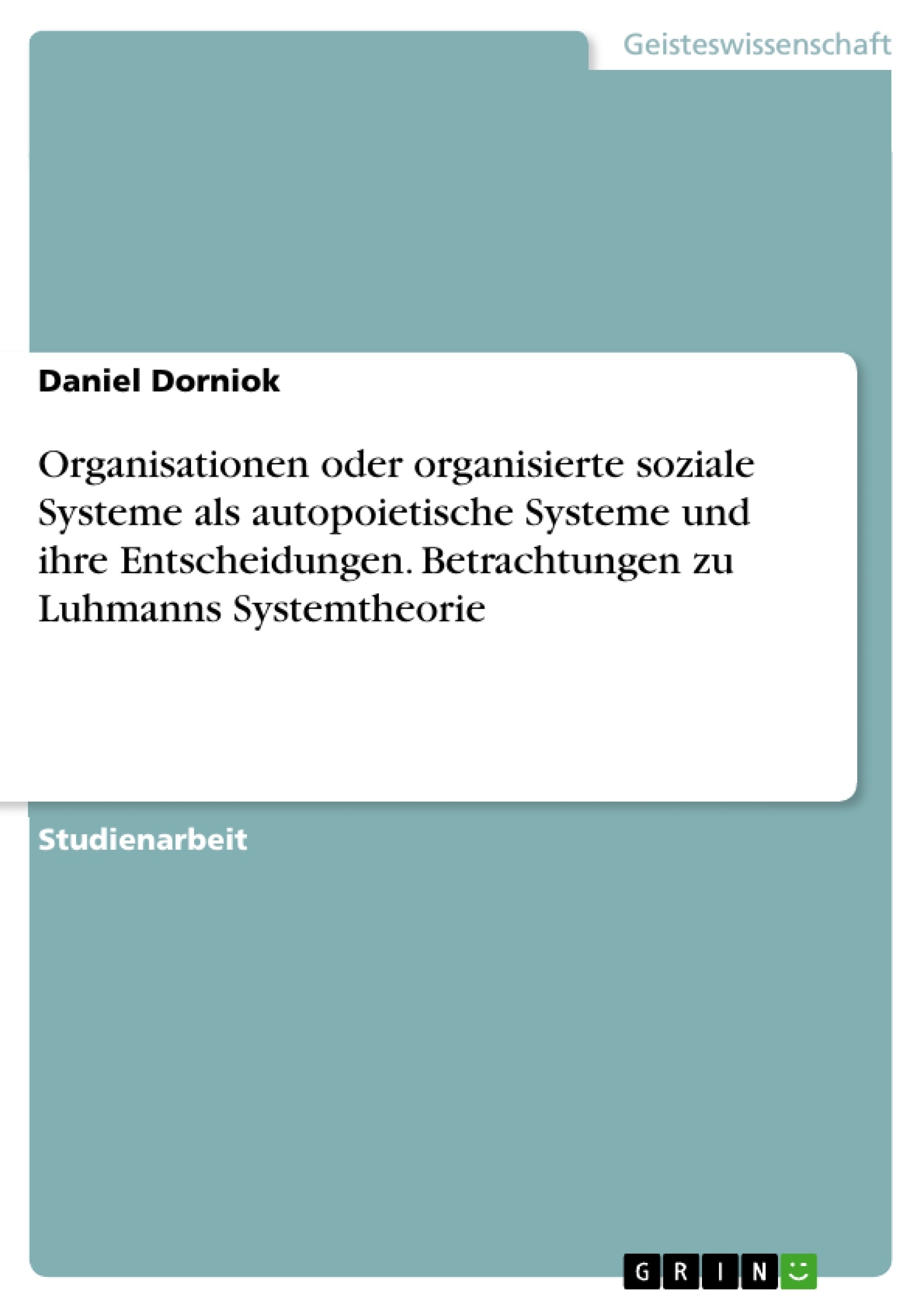Die folgende Arbeit soll zeigen, was nach Luhmanns Systemtheorie Organisationen oder auch organisierte soziale Systeme als autopoietische Systeme erscheinen lässt, welche Theoriebausteine dazu nötig sind, welcher Operationen und Elemente es dazu bedarf und was in diesem Zusammenhang Entscheiden heißt.
Zunächst soll in das Thema eingeführt werden, indem gezeigt wird, was soziale Systeme im Allgemeinen als autopoietische Systeme ausmacht und charakterisiert, um dann spezieller Organisationen als autopoietische Systeme zu beobachten. Im weiteren Verlauf werden die wichtigsten Begriffe zur Organisation wie Mitgliedschaft, Entscheidung, Zeit, Unsicherheit, Personal, Technik, Selbstbeschreibung und Rationalität näher beschrieben, um dann abschließend auf das Verhältnis von Organisation und Gesellschaft einzugehen.
Zudem soll gezeigt werden, auf welche Besonderheiten es beim Verhältnis zwischen funktional differenzierter Gesellschaft und organisierten Systemen ankommt. So wie jede Theorie ist auch diese Theorie „nur“ eine Konstruktion. Das Besondere an der Beobachtung des Beobachters Luhmann ist die Umstellung auf Differenz und der damit eingeleitete besondere Umgang mit Paradoxien. Paradoxien bzw. paradoxe Unterscheidungen sind nicht zu umgehen, im Gegenteil sie können sogar Möglichkeiten ermöglichen; im Falle des Systems zum Beispiel durch ein Reentry der Unterscheidung von System und Umwelt in das System und die durch die Orientierung des Systems an dieser Entscheidung mögliche Autopoiesis eben dieses Systems.
In dieser Arbeit wird man auf diese Paradoxien stoßen, wobei die Paradoxie der Einheit der Differenz von System und Umwelt – welches „die“ Unterscheidung der Systemtheorie darstellt – also die Welt, allgegenwärtig ist und ausgeblendet wird. Daher wird alle Beobachtung je nach Wahl der Systemreferenz auf System oder Umwelt als „Ort“ der Beobachtung bezogen werden. Dabei ist zu beachten, dass schon die Wahl der Systemreferenz bereits ein Entscheidungsprozess ist.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Autopoietische Systeme
- 3. Die Organisation als autopoietisches System
- 3.1. Mitgliedschaft und Motive
- 3.2. Entscheidungen
- 3.2.1. Die Paradoxie des Entscheidens
- 3.2.2. Zeitverhältnisse
- 3.2.3. Unsicherheitsabsorption
- 3.2.4. Risiko und Entscheidungen
- 3.2.5. Entscheidungsprämissen
- 3.2.6. Entscheidungsprogramme
- 3.2.7. Personal
- 3.3. Die Organisation der Organisation
- 3.4. Strukturelle Wandel
- 3.5. Technik
- 3.6. Selbstbeschreibung
- 3.7. Rationalität
- 4. Organisation und Gesellschaft
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Organisationen als autopoietische Systeme im Rahmen der Systemtheorie Niklas Luhmanns. Ziel ist es, Luhmanns Theoriebausteine zu erläutern und zu zeigen, wie Organisationen Entscheidungen treffen. Die Arbeit beleuchtet die spezifischen Operationen und Elemente, die autopoietische Systeme in Organisationen ausmachen.
- Organisationen als autopoietische Systeme
- Entscheidungsprozesse in Organisationen
- Der Einfluss von Zeit, Unsicherheit und Risiko auf Entscheidungen
- Das Verhältnis von Organisation und Gesellschaft
- Strukturelle Kopplungen zwischen Organisationen und ihrer Umwelt
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt den Fokus der Arbeit: die Darstellung von Organisationen als autopoietische Systeme nach Luhmann, die notwendigen Theoriebausteine und die Bedeutung von Entscheidungen in diesem Kontext. Es wird der methodische Ansatz skizziert, der sich an Luhmanns Einteilung des Themas orientiert und die besondere Bedeutung des Umgangs mit Paradoxien in Luhmanns Systemtheorie hervorgehoben.
2. Autopoietische Systeme: Dieses Kapitel erklärt das Konzept autopoietischer Systeme nach Luhmann. Es beschreibt die Ausdifferenzierung von Systemen aus ihrer Umwelt, die operative Geschlossenheit und kognitive Offenheit dieser Systeme und die Rolle von Kommunikation als konstitutives Element. Die Unterscheidung zwischen Autopoiesis und Strukturerhaltung wird geklärt, ebenso wie die Bedeutung von Selbstreferenz und Umweltbeziehungen für das Systemerhalt. Das Kapitel betont die permanente Anpassung an die Umwelt und den Versuch, operative Differenz zu erzeugen um das System zu erhalten.
3. Die Organisation als autopoietisches System: Dieses Kapitel betrachtet Organisationen spezifisch als autopoietische Systeme. Es analysiert Begriffe wie Mitgliedschaft, Entscheidung, Zeit, Unsicherheit, Personal, Technik, Selbstbeschreibung und Rationalität im Kontext von Organisationen. Die einzelnen Unterkapitel untersuchen die Komplexität von Entscheidungen, den Umgang mit Paradoxien im Entscheidungsprozess, und den Einfluss von verschiedenen Faktoren auf organisationales Handeln. Zusammenfassend wird gezeigt, wie diese Elemente zusammenspielen, um die Autopoiesis der Organisation zu gewährleisten.
4. Organisation und Gesellschaft: Dieses Kapitel untersucht die Beziehung zwischen Organisationen und der Gesellschaft. Es analysiert, wie Organisationen in eine funktional differenzierte Gesellschaft eingebettet sind und wie sie mit ihrer Umwelt interagieren. Der Fokus liegt auf den besonderen Herausforderungen und Besonderheiten des Verhältnisses zwischen funktional differenzierter Gesellschaft und organisierten Systemen. Die Kapitel beleuchtet die strukturellen Kopplungen zwischen Organisationen und anderen sozialen Systemen.
Schlüsselwörter
Autopoiesis, Systemtheorie, Niklas Luhmann, Organisation, Entscheidung, Gesellschaft, Kommunikation, Selbstreferenz, Umwelt, Struktur, Risiko, Unsicherheit, Rationalität, Mitgliedschaft.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Organisationen als autopoietische Systeme"
Was ist der Hauptgegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht Organisationen als autopoietische Systeme im Rahmen der Systemtheorie Niklas Luhmanns. Der Fokus liegt auf der Erklärung von Luhmanns Theoriebausteinen und der Darstellung, wie Organisationen Entscheidungen treffen. Dabei werden die spezifischen Operationen und Elemente autopoietischer Systeme in Organisationen beleuchtet.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunktthemen: Organisationen als autopoietische Systeme, Entscheidungsprozesse in Organisationen, den Einfluss von Zeit, Unsicherheit und Risiko auf Entscheidungen, das Verhältnis von Organisation und Gesellschaft sowie strukturelle Kopplungen zwischen Organisationen und ihrer Umwelt.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es jeweils?
Die Arbeit besteht aus vier Kapiteln: Kapitel 1 (Einleitung) führt in die Thematik ein und beschreibt den methodischen Ansatz. Kapitel 2 ("Autopoietische Systeme") erklärt das Konzept autopoietischer Systeme nach Luhmann. Kapitel 3 ("Die Organisation als autopoietisches System") betrachtet Organisationen als autopoietische Systeme und analysiert Begriffe wie Mitgliedschaft, Entscheidung, Zeit, Unsicherheit etc. Kapitel 4 ("Organisation und Gesellschaft") untersucht die Beziehung zwischen Organisationen und der Gesellschaft, insbesondere die strukturellen Kopplungen.
Wie wird das Konzept der Autopoiesis in Bezug auf Organisationen angewendet?
Die Arbeit beschreibt Organisationen als operative geschlossene, aber kognitiv offene Systeme. Autopoiesis wird als die selbstreferentielle Reproduktion des Systems durch seine eigenen Elemente (z.B. Kommunikation) verstanden. Die Organisation erhält sich durch ihre eigenen Operationen und passt sich gleichzeitig an ihre Umwelt an.
Welche Rolle spielen Entscheidungen in diesem Kontext?
Entscheidungen werden als zentrale Operationen im autopoietischen System Organisation betrachtet. Die Arbeit analysiert die Komplexität von Entscheidungen, den Umgang mit Paradoxien im Entscheidungsprozess und den Einfluss verschiedener Faktoren (Zeit, Unsicherheit, Risiko) auf organisationales Handeln.
Wie wird das Verhältnis von Organisation und Gesellschaft dargestellt?
Das Verhältnis wird als eines der strukturellen Kopplung beschrieben. Organisationen sind in eine funktional differenzierte Gesellschaft eingebettet und interagieren mit ihrer Umwelt, wobei besondere Herausforderungen und Besonderheiten dieses Verhältnisses beleuchtet werden.
Welche Schlüsselbegriffe sind für das Verständnis der Arbeit zentral?
Zentrale Schlüsselbegriffe sind: Autopoiesis, Systemtheorie, Niklas Luhmann, Organisation, Entscheidung, Gesellschaft, Kommunikation, Selbstreferenz, Umwelt, Struktur, Risiko, Unsicherheit, Rationalität und Mitgliedschaft.
Welche Methodik wird angewendet?
Der methodische Ansatz orientiert sich an Luhmanns Einteilung des Themas und hebt die besondere Bedeutung des Umgangs mit Paradoxien in Luhmanns Systemtheorie hervor. Die Arbeit erläutert Luhmanns Theoriebausteine und zeigt deren Anwendung auf Organisationen.
- Quote paper
- Daniel Dorniok (Author), 2005, Organisationen oder organisierte soziale Systeme als autopoietische Systeme und ihre Entscheidungen. Betrachtungen zu Luhmanns Systemtheorie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/38629