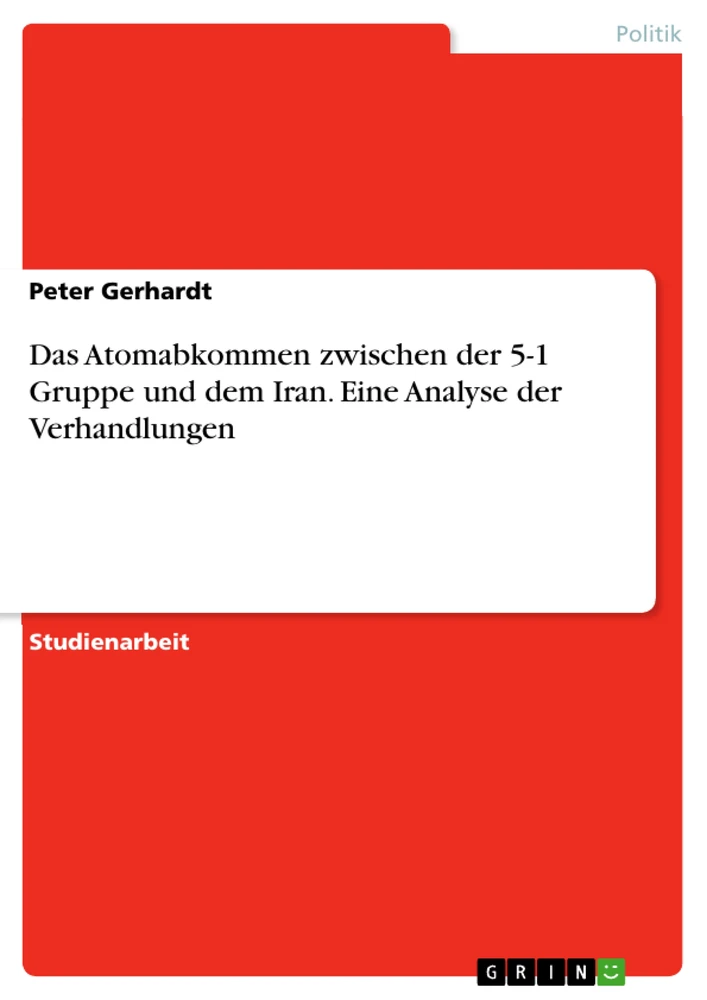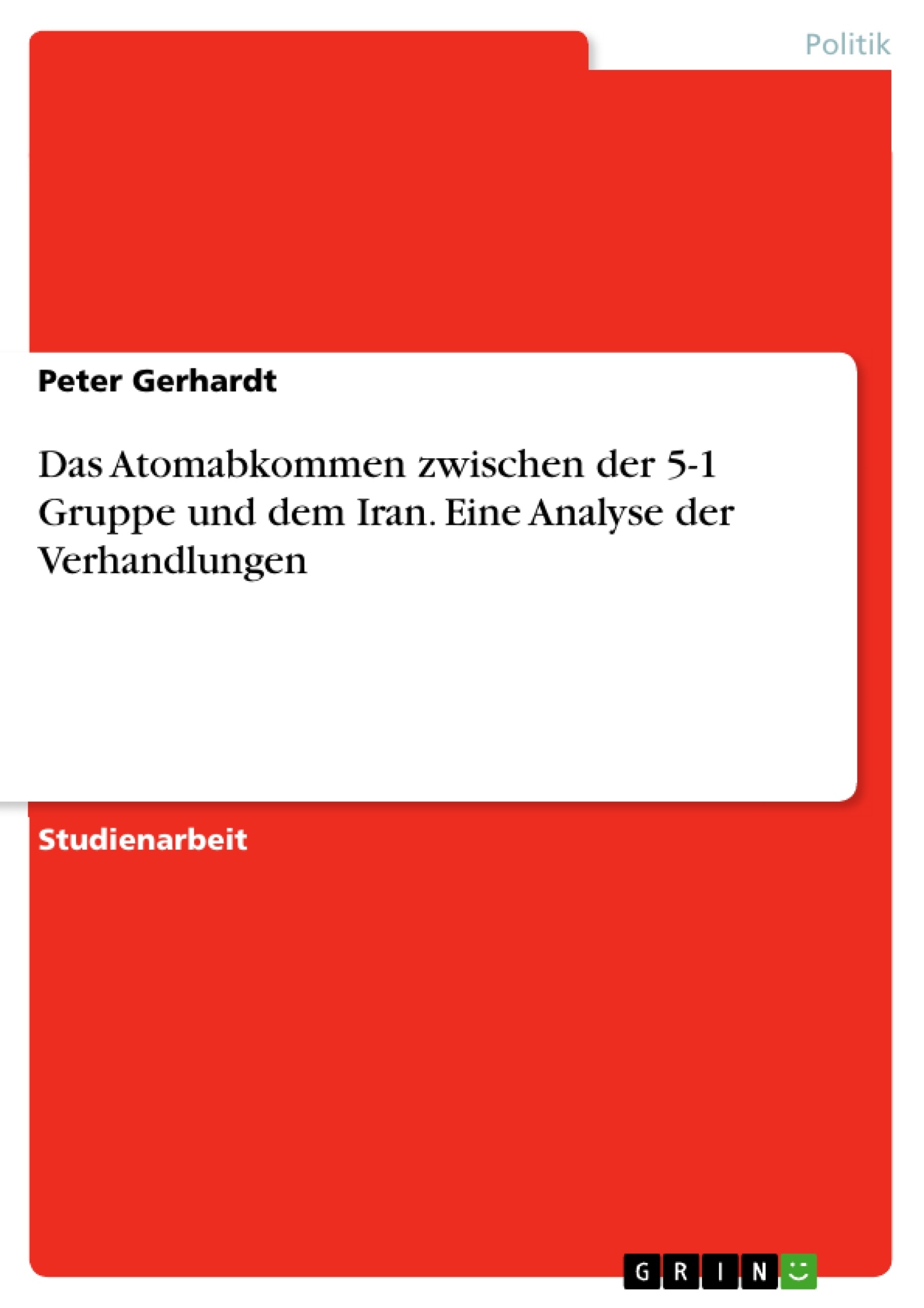Als sich die 5+1 Gruppe mit dem Iran nach jahrzehntelangen Verhandlungen auf einen gemeinsamen Vertrag über das iranische Atomprogramm einigen konnte sprach US-amerikanische Präsident Obama von einer „historischen Vereinbarung“, während Israel, einer der schärfsten Kritiker des Atomabkommens, von einem „historischen Fehler“ sprach. Der Iran beteuert zwar stets sein Atomprogramm diene nur friedlichen Zwecken, Aussagen von Exiliranern und die jahrelange Verschleierung der Atomforschung zeigen das Gegenteil. Nach der Einigung vergangenen Jahres, stellen sich viele Kritiker die Frage, welche Garantien die USA haben, dass der Iran im Geheimen nicht doch an den Bau von Atombomben arbeitet. Kann der Vertrag überhaupt langfristig bestehen bleiben? Mit Hilfe verhandlungstheoretischer Methoden wird in dieser Arbeit versucht, die Atomverhandlungen zwischen den USA und der EU mit dem Iran zu analysieren. Als theoretische Grundlage wird die Rational-Choice Theorie und das daraus entwickelte Konzept des two-level games von Robert Putnam verwendet.
Zunächst erfolgt eine chronologische Darstellung der Atomverhandlungen zwischen der Internationalen Staatengemeinschaft und dem Iran bis zur endgültigen Einigung auf einen Vertrag in Wien am 14. Juli 2015. Die vorangegangenen fast 15 Jahre waren geprägt von Hinhaltetaktiken und Vertragsbrüchen seitens des Iran. Die Voraussetzungen für eine Einigung waren
denkbar schlecht. Warum es dennoch zu einer Einigung gekommen ist, wird Gegenstand der Hausarbeit sein.
Dazu ist es notwendig, die möglichen Motive und Handlungsmöglichkeiten des Irans und der Internationalen Staatengemeinschaft bei den Atomverhandlungen zu betrachten. Aufgrund der Komplexität der politischen Beziehung des Iran mit dem Westen werden die Atomverhandlungen nur stark verkürzt dargestellt. Ein Schwerpunkt bildet dabei die Frage, welche Ziele beide Akteure verfolgt haben und warum es nach der Theorie des two-level games zu einer Vertragsvereinbarung gekommen ist. Die Akteure der 5-1 Gruppe werden dabei als einheitlicher Akteur mit einheitlichen Zielen betrachtet. Zum Schluss erfolgt eine Zusammenfassung der Erkenntnisse und eine Einschätzung hinsichtlich der Beständigkeit des Vertrages.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theorie des Verhandelns in Konflikten
- 3. Chronologie der Atomverhandlungen mit dem Iran
- 4. Verhandlungen der Internationalen Staatengemeinschaft mit dem Iran
- 4.1 Strategien und Motive des Iran
- 4.2 Strategien und Motive der 5+1 Gruppe
- 4.3 Ergebnis der Verhandlungen mit verhandlungstheoretischer Interpretation
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Atomverhandlungen zwischen der 5+1 Gruppe und dem Iran unter Verwendung verhandlungstheoretischer Methoden, insbesondere der Rational-Choice Theorie und des Two-Level-Games-Konzepts von Robert Putnam. Ziel ist es, die Motive und Strategien beider Seiten zu beleuchten und zu erklären, warum es trotz schwieriger Voraussetzungen zu einer Einigung kam.
- Die Anwendung der Rational-Choice Theorie auf internationale Verhandlungen.
- Die Analyse der Strategien und Motive des Iran und der 5+1 Gruppe.
- Die chronologische Darstellung der Atomverhandlungen.
- Die Erläuterung des Two-Level-Games-Konzepts im Kontext der Verhandlungen.
- Die Bewertung der Nachhaltigkeit des Atomabkommens.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die kontroversen Reaktionen auf das iranische Atomabkommen heraus – von "historischer Vereinbarung" bis "historischem Fehler" – und problematisiert die fehlenden Garantien gegen geheime Atombombenentwicklung. Sie skizziert den methodischen Ansatz der Arbeit, der die Rational-Choice Theorie und das Two-Level-Games-Konzept von Putnam nutzt, um die Verhandlungen zu analysieren und die Frage nach der Einigung trotz schlechter Voraussetzungen zu beantworten. Die Einleitung legt den Fokus auf die Analyse der Motive und Handlungsspielräume sowohl des Irans als auch der 5+1 Gruppe.
2. Theorie des Verhandelns in Konflikten: Dieses Kapitel erläutert die Grundlagen der Rational-Choice Theorie im Kontext internationaler Beziehungen und konzentriert sich auf die Strategien von Staaten zur Durchsetzung ihrer Interessen bei der Verteilung knapper Güter. Es beschreibt Strategien wie Drohungen, Verpflichtungen und Versprechen und führt das Konzept der "two-level games" von Putnam ein. Dieses Konzept analysiert Verhandlungen auf zwei Ebenen: der zwischenstaatlichen und der innerstaatlichen, wobei die innerstaatlichen Kräfte (z.B. gesellschaftliche Akteure) erheblichen Einfluss auf die Verhandlungsposition haben. Das Konzept des "win-sets" wird eingeführt, das den Bereich möglicher akzeptabler Vereinbarungen darstellt, wobei sich überlappende Win-sets als Voraussetzung für einen erfolgreichen Abschluss erweisen. Der Einfluss innerstaatlicher Faktoren wie Machtstrukturen, politische Institutionen und Strategien der Verhandlungsführer auf die Größe des win-sets wird eingehend erörtert. Die Unsicherheit über die Größe des eigenen und des gegnerischen win-sets wird als zentrale Herausforderung bei Verhandlungen hervorgehoben.
3. Chronologie der Atomverhandlungen mit dem Iran: Dieses Kapitel bietet eine chronologische Übersicht der Atomverhandlungen zwischen dem Iran und der internationalen Staatengemeinschaft. Es beginnt mit dem Beitritt des Irans zum Atomwaffensperrvertrag unter Schah Mohammed Reza Pahlavi und beschreibt die Entwicklung der Verhandlungen bis zum Abschluss des Abkommens in Wien 2015. Der Fokus liegt auf den Hinhaltetaktiken und Vertragsbrüchen des Irans sowie den sich ändernden politischen Konstellationen und Akteuren. Es liefert einen historischen Kontext für die komplexen Verhandlungen, die durch die Islamische Revolution und den Irak-Iran-Krieg zusätzlich beeinflusst wurden.
4. Verhandlungen der Internationalen Staatengemeinschaft mit dem Iran: Dieses Kapitel analysiert detailliert die Strategien und Motive sowohl des Irans als auch der 5+1 Gruppe während der Atomverhandlungen. Es untersucht die jeweiligen Ziele und Interessen der beteiligten Akteure und setzt diese im Kontext des Two-Level-Games-Konzepts in Beziehung zueinander. Die Analyse umfasst eine verhandlungstheoretische Interpretation des Ergebnisses der Verhandlungen. Hier wird tiefergehend auf die innerstaatlichen und zwischenstaatlichen Dynamiken eingegangen, die das Verhandlungsergebnis prägten. Es stellt die Komplexität der politischen Beziehungen dar und untersucht, wie die jeweiligen Akteure ihre Ziele verfolgt haben und warum trotz der Widerstände eine Einigung erzielt wurde. Die 5+1 Gruppe wird hier als einheitlicher Akteur mit gemeinsamen Zielen betrachtet, was die Analyse vereinfacht, aber gleichzeitig die Komplexität der tatsächlichen Verhandlungsdynamiken reduziert.
Schlüsselwörter
Atomabkommen, Iran, 5+1 Gruppe, Atomverhandlungen, Rational-Choice Theorie, Two-Level Games, Verhandlungsstrategien, Win-set, Internationale Beziehungen, Machtstrukturen, Interessen, Koalitionen, Innenpolitik, Außenpolitik.
Häufig gestellte Fragen zum Dokument: Analyse der Atomverhandlungen mit dem Iran
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Atomverhandlungen zwischen dem Iran und der 5+1 Gruppe (USA, Russland, China, Frankreich, Großbritannien, Deutschland) unter Anwendung verhandlungstheoretischer Methoden, insbesondere der Rational-Choice Theorie und des Two-Level-Games-Konzepts. Sie untersucht die Motive und Strategien beider Seiten und erklärt, warum es trotz schwieriger Voraussetzungen zu einer Einigung kam.
Welche Theorien werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich hauptsächlich auf die Rational-Choice Theorie und das Two-Level-Games-Konzept von Robert Putnam. Die Rational-Choice Theorie hilft, die strategischen Entscheidungen der beteiligten Akteure zu verstehen, während das Two-Level-Games-Konzept die innerstaatlichen und zwischenstaatlichen Dynamiken beleuchtet, die die Verhandlungen beeinflussen.
Welche Kapitel beinhaltet die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Theorie des Verhandelns in Konflikten, Chronologie der Atomverhandlungen mit dem Iran, Verhandlungen der Internationalen Staatengemeinschaft mit dem Iran und Fazit. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt der Atomverhandlungen.
Was wird im Kapitel "Theorie des Verhandelns in Konflikten" behandelt?
Dieses Kapitel erläutert die Grundlagen der Rational-Choice Theorie und des Two-Level-Games-Konzepts. Es beschreibt verschiedene Verhandlungsstrategien, den Einfluss innerstaatlicher Faktoren auf die Verhandlungsposition (z.B. Machtstrukturen, politische Institutionen) und das Konzept des "Win-sets" (Bereich möglicher akzeptabler Vereinbarungen).
Was wird in der Chronologie der Atomverhandlungen dargestellt?
Das Kapitel zur Chronologie bietet einen historischen Überblick über die Atomverhandlungen, beginnend mit dem Beitritt des Irans zum Atomwaffensperrvertrag bis zum Abschluss des Abkommens 2015. Es beschreibt die Hinhaltetaktiken des Irans, Vertragsbrüche und die sich ändernden politischen Konstellationen.
Wie werden die Strategien und Motive des Iran und der 5+1 Gruppe analysiert?
Das Kapitel zu den Verhandlungen analysiert detailliert die Strategien und Motive beider Seiten. Es untersucht ihre Ziele und Interessen im Kontext des Two-Level-Games-Konzepts und bietet eine verhandlungstheoretische Interpretation des Ergebnisses. Die Analyse berücksichtigt sowohl innerstaatliche als auch zwischenstaatliche Dynamiken.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Atomabkommen, Iran, 5+1 Gruppe, Atomverhandlungen, Rational-Choice Theorie, Two-Level Games, Verhandlungsstrategien, Win-set, Internationale Beziehungen, Machtstrukturen, Interessen, Koalitionen, Innenpolitik, Außenpolitik.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Motive und Strategien des Irans und der 5+1 Gruppe während der Atomverhandlungen zu beleuchten und zu erklären, warum es trotz schwieriger Voraussetzungen zu einer Einigung kam. Sie demonstriert die Anwendung verhandlungstheoretischer Methoden auf internationale Konflikte.
Wie wird das Atomabkommen bewertet?
Die Arbeit bewertet die Nachhaltigkeit des Atomabkommens, indem sie die komplexen politischen Beziehungen und die Strategien der beteiligten Akteure analysiert. Die Einleitung erwähnt die kontroversen Reaktionen auf das Abkommen, von "historischer Vereinbarung" bis "historischem Fehler", und problematisiert die fehlenden Garantien gegen geheime Atombombenentwicklung.
- Citar trabajo
- Peter Gerhardt (Autor), 2015, Das Atomabkommen zwischen der 5-1 Gruppe und dem Iran. Eine Analyse der Verhandlungen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/385821