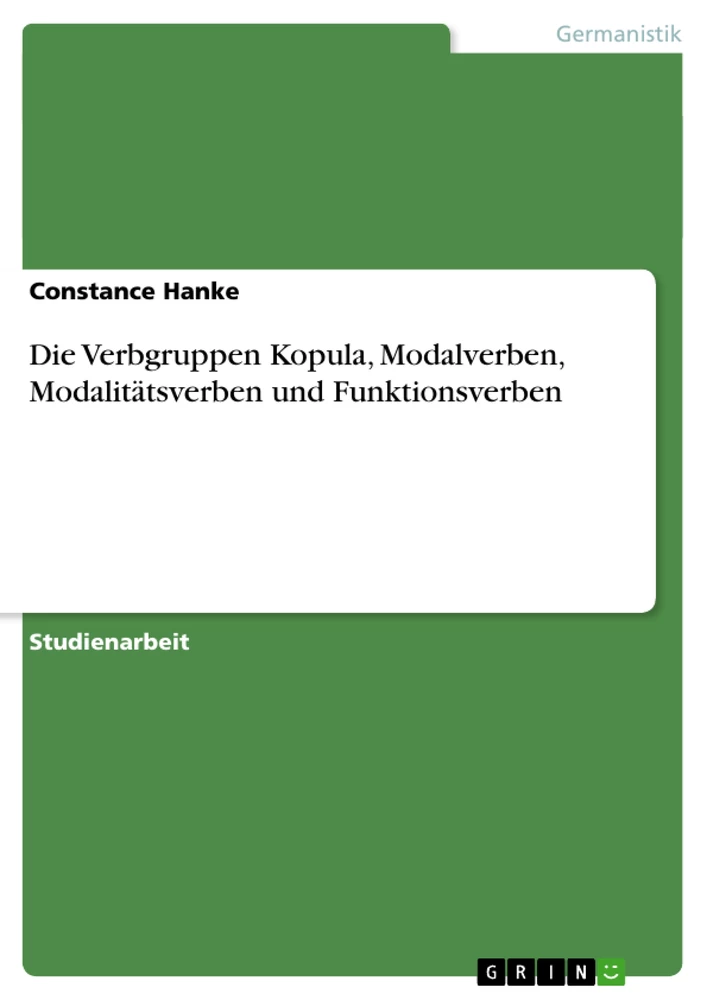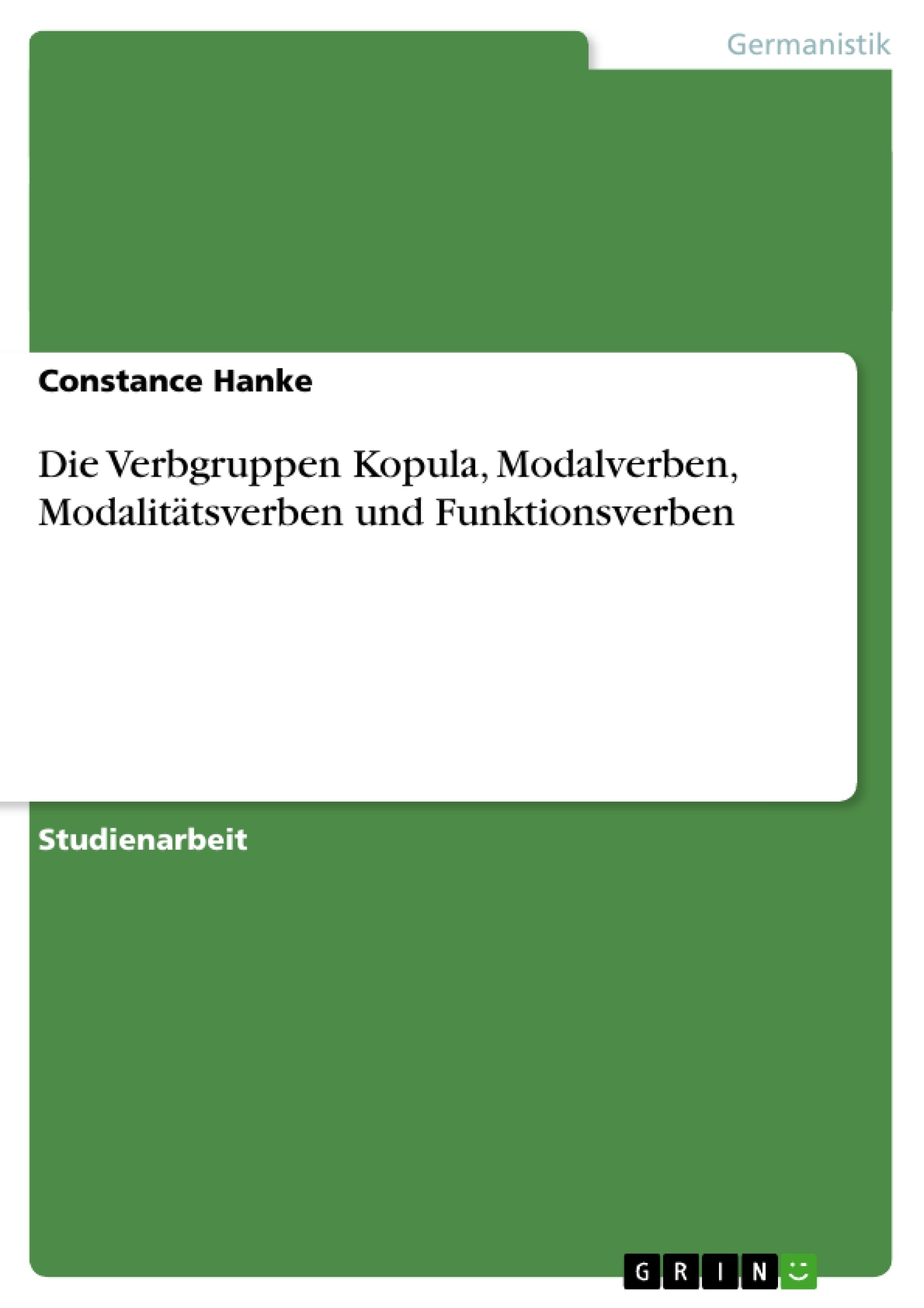Verben werden in unterschiedliche Kategorien eingeteilt. Dabei spielen ihre Bedeutung, ihr Anteil an Verbphrasen und ihre Kombinierbarkeit eine Rolle. Die Verteilung der Klassen und deren Bezeichnung wird in jeder Grammatik anders dargestellt. Die Termini Kopulaverben, Modalverben, Modalitätsverben und Funktionsverben werden in nahezu jeder deutschen Grammatik verwendet und erklärt. Dennoch besteht keine eindeutig einheitliche Meinung der Linguisten, was Definitionen und Klassifizierungen der oben genannten Verben betrifft. Ich möchte in meiner Arbeit klären, welche Bedeutung und Funktion Kopulae, Modalverben, Modalitätsverben und Funktionsverben haben, worin sie sich unterscheiden und wo ihre Gemeinsamkeiten liegen. Dabei werde ich auf die Ansichten der Linguisten der Dudenredaktion sowie auf die von Wilfried Kürschner, Gerhard Helbig, Joachim Buscha, Hans-Werner Eroms, Kirsten Adamzik, Walter Jung, Peter Eisenberg, Elke Hentschel und Halrald Weydt eingehen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Kopulaverben
- 2.1. Eigene Definition
- 2.2. Definition nach Wilfried Kürschner
- 2.3. Definition nach Gerhard Helbig und Joachim Buscha
- 2.4. Definition nach Kirsten Adamzik
- 2.5. Definition nach Peter Eisenberg
- 2.6. Definition nach Elke Hentschel und Harald Weydt
- 3. Modalverben
- 3.1. Eigene Definition
- 3.2. Definition nach Wilfried Kürschner
- 3.3. Definition nach Gerhard Helbig
- 3.4. Definition nach Hans-Werner Eroms
- 3.5. Definition nach Kirsten Adamzik
- 3.6. Definition nach Walter Jung
- 3.7. Definition nach Elke Hentschel und Harald Weydt
- 4. Modalitätsverben
- 4.1. Eigene Definition
- 4.2. Definition nach Wilfried Kürschner
- 4.3. Definition nach Gerhard Helbig und Joachim Buscha
- 4.4. Definition nach Hans-Werner Eroms
- 4.5. Definition nach Kirsten Adamzik
- 4.6. Definition nach Elke Hentschel und Harald Weydt
- 5. Funktionsverben
- 5.1. Eigene Definition
- 5.2. Definition nach Wilfried Kürschner
- 5.3. Definition nach Gerhard Helbig und Joachim Buscha
- 5.4. Definition nach Hans-Werner Eroms
- 5.5. Definition nach Kirsten Adamzik
- 5.6. Definition nach Walter Jung
- 5.7. Definition nach Peter Eisenberg
- 5.8. Definition nach Duden
- 5.9. Definition nach Elke Hentschel und Harald Weydt
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Bedeutung und Funktion von Kopulaverben, Modalverben, Modalitätsverben und Funktionsverben im Deutschen. Sie klärt die Unterschiede und Gemeinsamkeiten dieser Verbtypen anhand der Definitionen verschiedener Linguisten.
- Definition und Abgrenzung der vier Verbtypen
- Vergleichende Analyse der Definitionen verschiedener Sprachwissenschaftler
- Untersuchung der syntaktischen und semantischen Funktionen der Verben
- Identifizierung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden zwischen den Verbtypen
- Klärung von kontroversen Punkten in der linguistischen Klassifizierung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der verschiedenen Verbtypen im Deutschen ein und erläutert die unterschiedlichen Ansätze in der linguistischen Klassifizierung. Sie hebt die Uneinigkeit unter Linguisten bezüglich der Definitionen und Einordnungen von Kopula-, Modal-, Modalitäts- und Funktionsverben hervor und beschreibt die Zielsetzung der Arbeit: die Klärung der Bedeutung, Funktion, Unterschiede und Gemeinsamkeiten dieser Verbtypen anhand verschiedener linguistischer Perspektiven.
2. Kopulaverben: Dieses Kapitel analysiert die Definition von Kopulaverben aus verschiedenen Perspektiven. Es beginnt mit einer eigenen Definition, die die Verben "sein," "werden," und "bleiben" als Kopulaverben beschreibt, wenn sie mit einem Prädikativ das Prädikat bilden. Anschließend werden die Definitionen von Kürschner, Helbig/Buscha, Adamzik, Eisenberg und Hentschel/Weydt verglichen und kontrastiert. Die Diskussion umfasst die semantischen und syntaktischen Eigenschaften der Kopulaverben, die Frage nach der "Inhaltsleere" und die Einbeziehung von Verben wie "scheinen" in die Kategorie der Kopulaverben.
3. Modalverben: Dieses Kapitel widmet sich den Modalverben und präsentiert diverse linguistische Definitionen. Die Analyse beleuchtet die unterschiedlichen Auffassungen bezüglich der Abgrenzung und Klassifizierung von Modalverben. Es wird auf die syntaktische Funktion und die semantische Bedeutung der Modalverben eingegangen, sowie auf den Vergleich der verschiedenen Perspektiven von Kürschner, Helbig, Eroms, Adamzik, Jung und Hentschel/Weydt.
4. Modalitätsverben: Das Kapitel zu den Modalitätsverben folgt dem gleichen Schema wie die Kapitel zu Kopula- und Modalverben. Es werden verschiedene Definitionen vorgestellt und miteinander verglichen, um ein umfassendes Bild der linguistischen Auseinandersetzung mit dieser Verbtype zu liefern. Die Analyse konzentriert sich auf die syntaktischen und semantischen Eigenschaften der Modalitätsverben und untersucht die verschiedenen Ansätze von Kürschner, Helbig/Buscha, Eroms, Adamzik, und Hentschel/Weydt.
5. Funktionsverben: Ähnlich wie in den vorherigen Kapiteln, wird hier ein umfassender Überblick über verschiedene Definitionen von Funktionsverben gegeben, inklusive der Perspektiven von Kürschner, Helbig/Buscha, Eroms, Adamzik, Jung, Eisenberg, und dem Duden. Die Analyse beleuchtet die syntaktischen und semantischen Besonderheiten dieser Verben, die Herausforderungen ihrer Klassifizierung und die Einordnung von umstrittenen Fällen.
Schlüsselwörter
Kopulaverben, Modalverben, Modalitätsverben, Funktionsverben, Verbtypen, deutsche Grammatik, syntaktische Funktionen, semantische Bedeutung, Linguistik, Wilfried Kürschner, Gerhard Helbig, Joachim Buscha, Hans-Werner Eroms, Kirsten Adamzik, Walter Jung, Peter Eisenberg, Elke Hentschel, Harald Weydt, Duden.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: "Definition und Abgrenzung von Kopula-, Modal-, Modalitäts- und Funktionsverben im Deutschen"
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Bedeutung und Funktion von Kopulaverben, Modalverben, Modalitätsverben und Funktionsverben im Deutschen. Sie vergleicht die Definitionen dieser Verbtypen aus verschiedenen linguistischen Perspektiven und untersucht deren syntaktische und semantische Eigenschaften. Die Arbeit zielt darauf ab, die Unterschiede und Gemeinsamkeiten dieser Verbtypen zu klären und kontroverse Punkte in der linguistischen Klassifizierung zu beleuchten.
Welche Verbtypen werden untersucht?
Die Arbeit konzentriert sich auf vier Verbtypen: Kopulaverben, Modalverben, Modalitätsverben und Funktionsverben. Für jeden Typ werden verschiedene Definitionen von bekannten Linguisten vorgestellt und analysiert.
Welche Linguisten werden in der Arbeit zitiert?
Die Arbeit bezieht sich auf die Definitionen und Ansätze folgender Linguisten: Wilfried Kürschner, Gerhard Helbig, Joachim Buscha, Hans-Werner Eroms, Kirsten Adamzik, Walter Jung, Peter Eisenberg, Elke Hentschel, Harald Weydt und der Duden.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit besteht aus fünf Kapiteln: einer Einleitung, je einem Kapitel zu Kopulaverben, Modalverben und Modalitätsverben sowie einem Kapitel zu Funktionsverben. Jedes Kapitel beinhaltet eine eigene Definition des jeweiligen Verbtyps und einen Vergleich mit den Definitionen verschiedener Linguisten. Zusätzlich enthält die Arbeit ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Kapitel, eine Beschreibung der Zielsetzung und der Themenschwerpunkte und eine Liste der Schlüsselwörter.
Was sind die zentralen Themen der Arbeit?
Die zentralen Themen sind die Definition und Abgrenzung der vier Verbtypen, ein Vergleich der Definitionen verschiedener Sprachwissenschaftler, die Untersuchung der syntaktischen und semantischen Funktionen der Verben, die Identifizierung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden zwischen den Verbtypen und die Klärung von kontroversen Punkten in der linguistischen Klassifizierung.
Welche Methoden werden in der Arbeit angewendet?
Die Arbeit verwendet eine vergleichende Analysemethode. Sie vergleicht die Definitionen der vier Verbtypen aus verschiedenen linguistischen Quellen und untersucht die Gemeinsamkeiten und Unterschiede dieser Definitionen. Dabei werden die syntaktischen und semantischen Eigenschaften der Verben berücksichtigt.
Gibt es eine Zusammenfassung der Kapitel?
Ja, die Arbeit enthält eine Zusammenfassung jedes Kapitels, die die wichtigsten Punkte und Ergebnisse des jeweiligen Kapitels zusammenfasst.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Kopulaverben, Modalverben, Modalitätsverben, Funktionsverben, Verbtypen, deutsche Grammatik, syntaktische Funktionen, semantische Bedeutung, Linguistik, Wilfried Kürschner, Gerhard Helbig, Joachim Buscha, Hans-Werner Eroms, Kirsten Adamzik, Walter Jung, Peter Eisenberg, Elke Hentschel, Harald Weydt, Duden.
- Quote paper
- Constance Hanke (Author), 2005, Die Verbgruppen Kopula, Modalverben, Modalitätsverben und Funktionsverben, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/38579