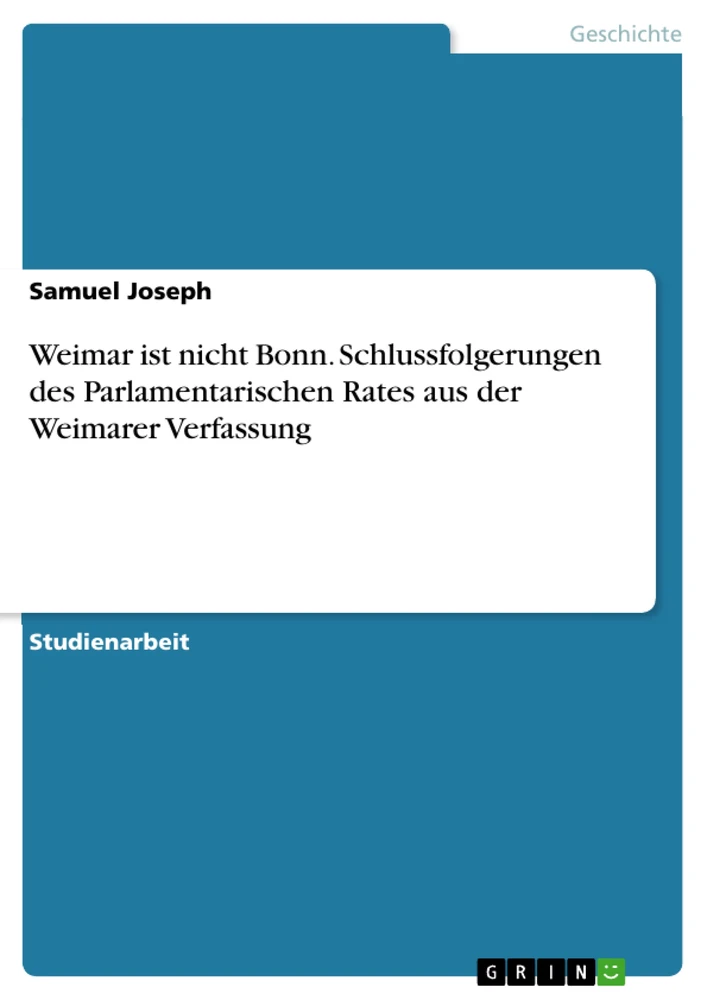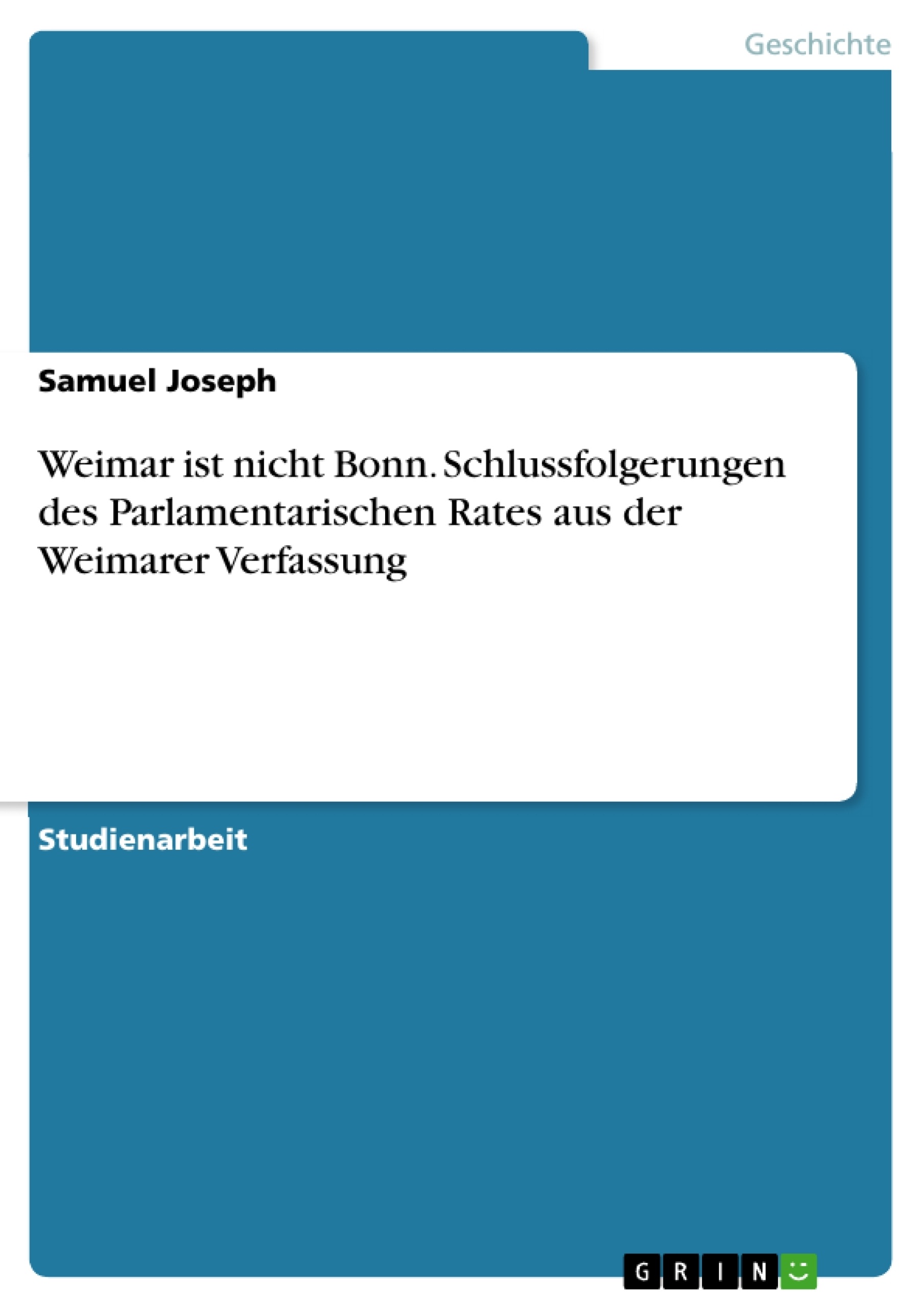Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs zeichnete sich sehr schnell eine deutsche Teilung ab, da die Vorstellungen der Alliierten über die Gestaltung einer gesamtdeutschen politischen Linie weit auseinander gingen. Nachdem der staatliche Neuaufbau über die Gemeindeebene bis hin zur Bildung von Ländern erfolgt war, wurden die Ministerpräsidenten der elf westdeutschen Länder von den drei westlichen Militärgouverneuren beauftragt, "eine 'verfassungsgebende Versammlung' einzuberufen" (ebd., S. 7).
Die sogenannten "Londoner Empfehlungen" von 1948 bereiteten damit den Weg für die Entstehung eines westdeutschen Teilstaats. Der Parlamentarische Rat wurde nicht nur vor die Herausforderung gestellt, parteiübergreifend konstruktive Arbeit zu leisten, sondern musste ebenso die angeblichen oder tatsächlichen Funktionsfehler der Weimarer Reichsverfassung (WRV) analysieren, die eine Verfassungsdurchbrechung ermöglichten, und letztendlich zur Entstehung der totalitären Diktatur führten.
Die negativen Erfahrungen über das Scheitern der Weimarer Republik waren zu einprägsam, um unverändert zur Weimarer Staatsform zurückzukehren. Wie sollte der neue Parlamentarismus aussehen? Wie viel Macht sollte dem Staatsoberhaupt zustehen? Welche Maßnahmen müssen getroffen werden, um eine Regierungsstabilität zu ermöglichen?
Der Parlamentarische Rat stand bei der Ausarbeitung des Bonner Grundgesetzes (BGG) vor vielen Fragen. Eines war jedoch sicher: Eine Aushöhlung der demokratischen Ordnung, wie sie in der Weimarer Republik stattgefunden hat, sollte sich nicht wiederholen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Reichstag/ Bundestag
- Der Reichstag - Zwischen Verfassungsanspruch und Verfassungswirklichkeit
- Folgerungen des Parlamentarischen Rats
- Reichspräsident/ Bundespräsident
- Die Kombination von Artikel 25 und Artikel 43 der Weimarer Reichsverfassung
- Artikel 48 der Weimarer Reichsverfassung
- Folgerungen des Parlamentarischen Rats
- Reichsregierung/ Bundesregierung
- Die Stellung der Reichsregierung in der Weimarer Reichsverfassung
- Die Stellung der Regierung im Bonner Grundgesetz
- Verfassungsschutz Weimarer Verfassung/ Bonner Grundgesetz
- Verfassungsschutz der Weimarer Reichsverfassung
- Verfassungsschutz des Bonner Grundgesetzes
- Folgerungen des Parlamentarischen Rats - Ein Resümee
- Abschließende Bewertung „Weimar ist nicht Bonn“
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert die Schlussfolgerungen des Parlamentarischen Rats aus der Weimarer Reichsverfassung im Kontext des „Bonn ist nicht Weimar“-Lehrspruchs. Sie untersucht, wie die Erfahrungen der Weimarer Republik in die Ausarbeitung des Bonner Grundgesetzes eingeflossen sind, um eine Wiederholung der gescheiterten Demokratie zu verhindern.
- Analyse der Funktionsweise des Reichstags in der Weimarer Republik
- Bewertung der Rolle des Reichspräsidenten und seiner Machtbefugnisse
- Untersuchung der Gestaltung der Reichsregierung und ihrer Stellung im politischen System
- Vergleich des Verfassungsschutzes in der Weimarer Reichsverfassung und dem Bonner Grundgesetz
- Bewertung der Folgerungen des Parlamentarischen Rats für die Gestaltung des Bonner Grundgesetzes
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Problematik des Scheiterns der Weimarer Republik und die Entstehung des Bonner Grundgesetzes ein. Sie stellt den Fokus der Hausarbeit auf die Analyse der Schlussfolgerungen des Parlamentarischen Rats dar.
Das zweite Kapitel analysiert die Funktionsweise des Reichstags in der Weimarer Republik, wobei die Spannungen zwischen Verfassungsanspruch und Verfassungswirklichkeit betrachtet werden. Es beleuchtet die Gesetzgebungsfunktion des Reichstags und die Herausforderungen, die aus der Verhältniswahl und der geringen Bedeutung von Parteien resultierten.
Das dritte Kapitel untersucht die Rolle des Reichspräsidenten und seine Machtbefugnisse im Kontext der Weimarer Reichsverfassung.
Das vierte Kapitel befasst sich mit der Stellung der Reichsregierung in der Weimarer Reichsverfassung und der Gestaltung der Bundesregierung im Bonner Grundgesetz.
Das fünfte Kapitel analysiert den Verfassungsschutz in beiden Verfassungen und beleuchtet die Unterschiede in der Gestaltung des Schutzes der demokratischen Ordnung.
Das sechste Kapitel fasst die Folgerungen des Parlamentarischen Rats zusammen und stellt die Bedeutung der gewonnenen Erkenntnisse für die Gestaltung des Bonner Grundgesetzes heraus.
Schlüsselwörter
Weimarer Reichsverfassung, Bonner Grundgesetz, Parlamentarischer Rat, Reichstag, Bundesversammlung, Reichspräsident, Bundespräsident, Reichsregierung, Bundesregierung, Verfassungsschutz, Funktionsfehler, Demokratie, Verhältniswahl, Machtbefugnisse, Gesetzgebung, Präsidialregierung
- Quote paper
- Samuel Joseph (Author), 2017, Weimar ist nicht Bonn. Schlussfolgerungen des Parlamentarischen Rates aus der Weimarer Verfassung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/385759