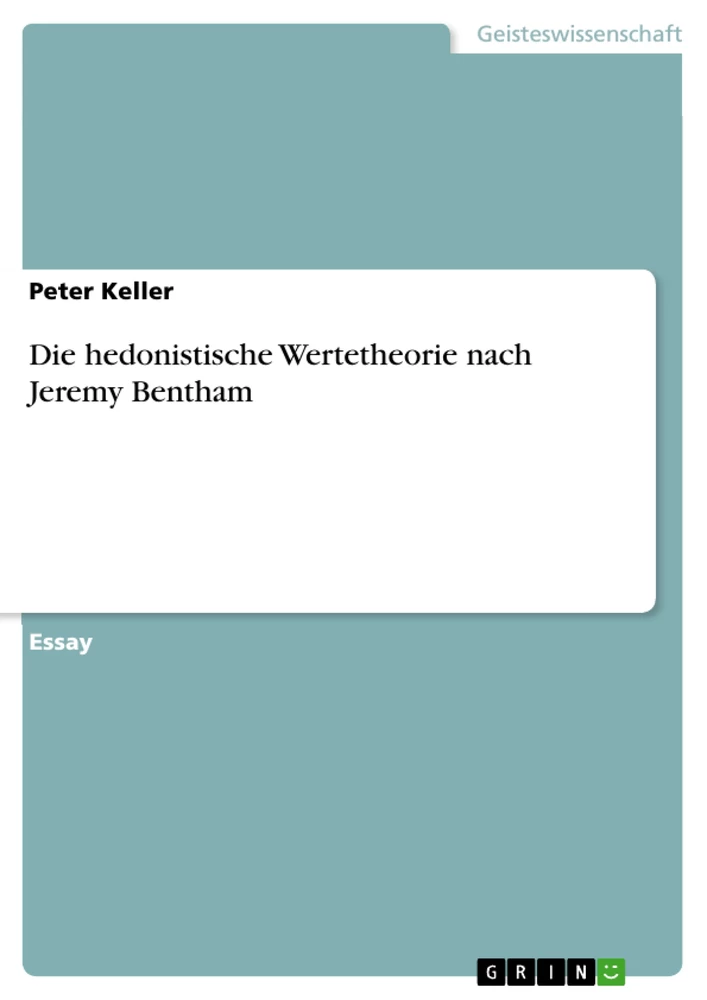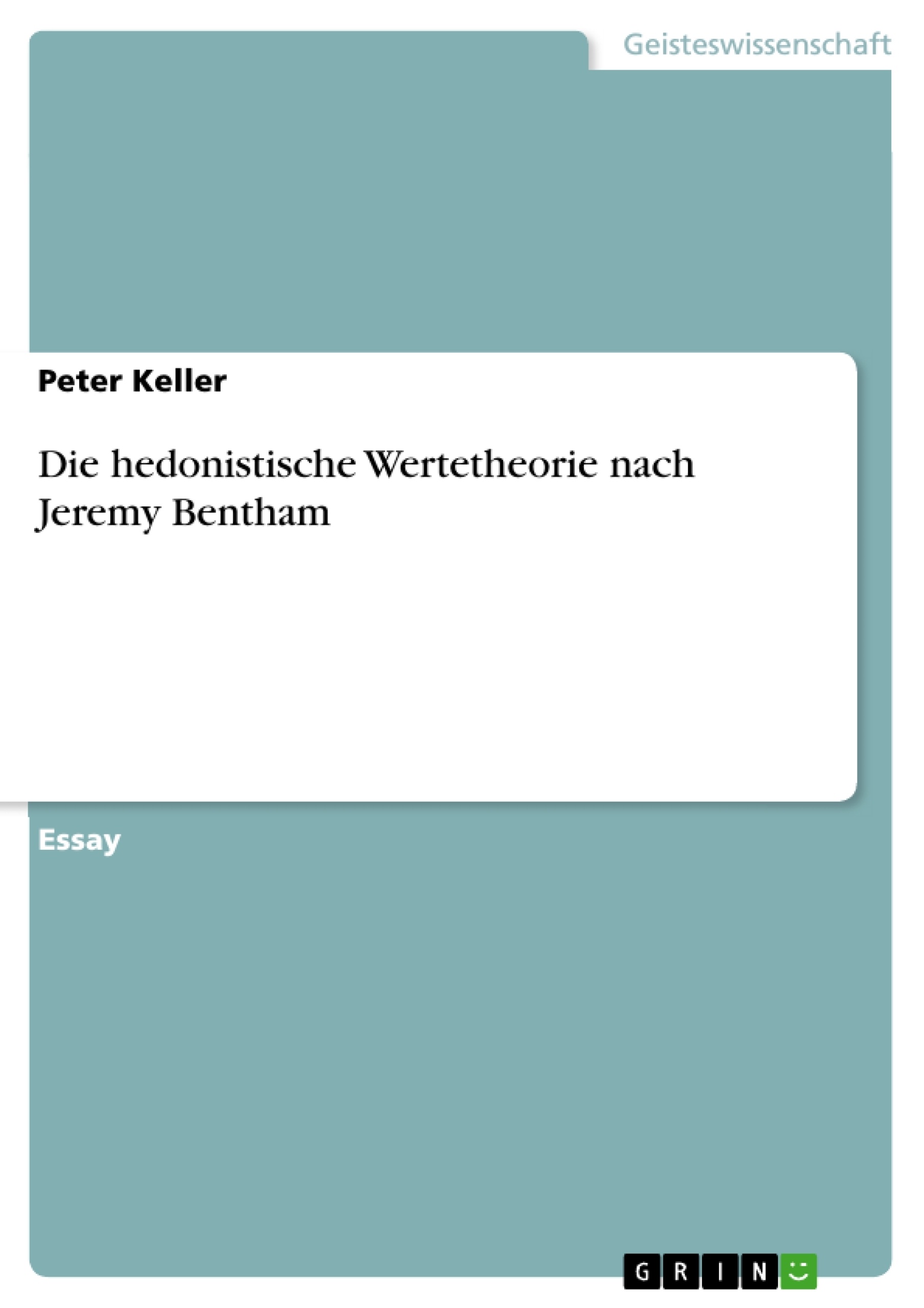Die hedonistische Wertetheorie, die in der Regel ursächlich auf Jeremy Bentham und sein Werk "Eine Einführung in die Prinzipien der Moral und Gesetzgebung" zurückgeführt wird, soll in der vorliegenden Arbeit in einigen Facetten diskutiert und kritisiert werden. Die Wirkmächtigkeit dieser Theorie ist unbestritten und ihre Anwendung als Begründung für alltägliche Entscheidungen oder weitreichende politische Handlungen ist evident.
Selbst Menschen, die grundsätzlich eine gegenseitige Aufrechnung von Menschenleben intuitiv strikt ablehnen würden, nehmen in Situationen, in denen das Aufopfern von einzelnen Menschen zur Rettung vieler beträgt, eine solche Abwägung dennoch in Kauf. Was ist das erzeugte Leid bei 100 Toten gegenüber dem Leid beim Tod von 50'000 Menschen? So bleibt die Frage virulent: Kann die hedonistische Wertetheorie nicht doch ein Fundament einer praktikablen Moraltheorie sein?
Im Folgenden wird versucht, dieser Frage in Teilen nachzugehen. Dabei liegt das Hauptaugenmerk fast ausschliesslich auf dem Werk von Bentham. Dies lässt sich damit begründen, dass in der vorliegenden Diskussion grundlegende Themen angesprochen werden, die durch einen breiteren Miteinbezug von Werken beispielsweise von John Stuart Mill nicht grundsätzlich erweitert würden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Wertetheorie von J. Bentham
- Kritik der hedonistischen Wertetheorie
- Das ungenügende Subjekt
- Konsequenzen für das Selbstverständnis des Individuums
- Benthams vereinfachende Sicht der Gesellschaft
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich kritisch mit der hedonistischen Wertetheorie, insbesondere mit Jeremy Benthams Werk. Ziel ist es, die Anwendbarkeit und die Grenzen dieser Theorie als Grundlage für eine praktikable Moraltheorie zu untersuchen.
- Das ungenügende Subjekt der hedonistischen Wertetheorie
- Die Konsequenzen einer rein auf mentalen Zuständen basierenden Wertebestimmung für das Selbstverständnis des Individuums
- Die Vereinfachung der Gesellschaft als Summe individueller Glücks- und Leidenserfahrungen
- Die praktische Anwendbarkeit des hedonistischen Kalküls
- Die Rolle der Vernunft und des Rechts in Benthams Theorie
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der hedonistischen Wertetheorie ein und skizziert die zentralen Fragestellungen der Arbeit. Sie benennt Jeremy Bentham als Hauptfokus und begründet die Beschränkung auf dessen Werk. Die Einleitung stellt die Struktur der Arbeit vor und hebt die drei Hauptkritikpunkte hervor, die im dritten Kapitel behandelt werden. Die zentrale Frage, ob die hedonistische Wertetheorie ein Fundament für eine praktikable Moraltheorie bilden kann, wird als Leitmotiv eingeführt.
Wertetheorie von J. Bentham: Dieses Kapitel stellt Benthams Wertetheorie dar. Es erläutert Benthams zentrale These, dass menschliches Handeln einzig durch Freude und Leid bestimmt wird, und wie diese These das „Prinzip der Nützlichkeit“ begründet. Benthams Ziel, ein „Gebäude der Glückseligkeit“ zu errichten, wird vorgestellt, ebenso seine Auffassung von der Gesellschaft als Summe individueller Interessen und sein hedonistisches Kalkül zur Messung von Freude und Leid. Die Nicht-Beweisbarkeit des Prinzips der Nützlichkeit und dessen Begründung durch die „natürliche Beschaffenheit der menschlichen Verfasstheit“ wird diskutiert. Schliesslich wird Benthams Fokus auf die Gesetzgebung und die Rolle des Staates als Maximierer des Gesamtnutzens herausgestellt, inklusive der Verwendung von Freude und Leid als Mittel zur Steuerung menschlichen Verhaltens.
Kritik der hedonistischen Wertetheorie: Dieses Kapitel beinhaltet eine kritische Auseinandersetzung mit drei zentralen Aspekten von Benthams Theorie. Erstens wird das Problem des ungenügenden Subjekts beleuchtet, welches die Komplexität menschlichen Erlebens nicht ausreichend berücksichtigt. Zweitens werden die negativen Auswirkungen einer rein auf mentalen Zuständen basierenden Wertebestimmung auf das Selbstverständnis eines individuellen, selbstverantwortlichen Ichs diskutiert. Drittens wird Benthams stark vereinfachende Vorstellung von der Gesellschaft als Summe individueller Glücks- und Leidenserfahrungen kritisiert, welche die Komplexität sozialer Interaktionen ignoriert. Die Kapitel analysieren, wie diese drei Aspekte die Tragfähigkeit der Theorie als Grundlage für eine Moraltheorie in Frage stellen.
Schlüsselwörter
Hedonistische Wertetheorie, Jeremy Bentham, Prinzip der Nützlichkeit, Freude, Leid, hedonistisches Kalkül, Moraltheorie, Gesetzgebung, Gesamtnutzen, Individuum, Gesellschaft, Selbstverständnis, Vernunft, Recht.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Kritische Auseinandersetzung mit der hedonistischen Wertetheorie Jeremy Benthams
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert kritisch die hedonistische Wertetheorie, insbesondere die von Jeremy Bentham. Sie untersucht die Anwendbarkeit und Grenzen dieser Theorie als Grundlage für eine praktikable Moraltheorie.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit folgenden Themenschwerpunkten: Das ungenügende Subjekt der hedonistischen Wertetheorie, die Konsequenzen einer rein auf mentalen Zuständen basierenden Wertebestimmung für das Selbstverständnis des Individuums, die Vereinfachung der Gesellschaft als Summe individueller Glücks- und Leidenserfahrungen, die praktische Anwendbarkeit des hedonistischen Kalküls, die Rolle der Vernunft und des Rechts in Benthams Theorie.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Wertetheorie von J. Bentham, ein Kapitel zur Kritik der hedonistischen Wertetheorie und ein Fazit. Die Einleitung führt in die Thematik ein und skizziert die zentralen Fragestellungen. Das zweite Kapitel stellt Benthams Theorie dar, während das dritte Kapitel drei Hauptkritikpunkte an dieser Theorie beleuchtet.
Was ist Benthams zentrale These?
Benthams zentrale These besagt, dass menschliches Handeln einzig durch Freude und Leid bestimmt wird. Diese These begründet sein „Prinzip der Nützlichkeit“, das darauf abzielt, das größtmögliche Glück für die größte Anzahl von Menschen zu erreichen.
Welche Kritikpunkte werden an Benthams Theorie geübt?
Die Arbeit kritisiert Benthams Theorie aus drei Hauptaspekten: Erstens wird das „ungenügende Subjekt“ kritisiert, da die Theorie die Komplexität menschlichen Erlebens nicht ausreichend berücksichtigt. Zweitens werden die negativen Auswirkungen einer rein auf mentalen Zuständen basierenden Wertebestimmung auf das Selbstverständnis des Individuums diskutiert. Drittens wird Benthams vereinfachte Vorstellung von der Gesellschaft als Summe individueller Glücks- und Leidenserfahrungen kritisiert.
Welche Rolle spielen Vernunft und Recht in Benthams Theorie?
Benthams Theorie betont die Rolle des Staates als Maximierer des Gesamtnutzens. Freude und Leid werden als Mittel zur Steuerung menschlichen Verhaltens eingesetzt. Die Arbeit diskutiert die Rolle von Vernunft und Recht in diesem Kontext.
Was ist das Fazit der Arbeit?
Das Fazit fasst die Ergebnisse der kritischen Auseinandersetzung mit Benthams hedonistischer Wertetheorie zusammen und bewertet deren Tauglichkeit als Grundlage für eine praktikable Moraltheorie. (Der genaue Inhalt des Fazits ist nicht in der Vorschau enthalten.)
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Hedonistische Wertetheorie, Jeremy Bentham, Prinzip der Nützlichkeit, Freude, Leid, hedonistisches Kalkül, Moraltheorie, Gesetzgebung, Gesamtnutzen, Individuum, Gesellschaft, Selbstverständnis, Vernunft, Recht.
- Quote paper
- Peter Keller (Author), 2017, Die hedonistische Wertetheorie nach Jeremy Bentham, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/385719