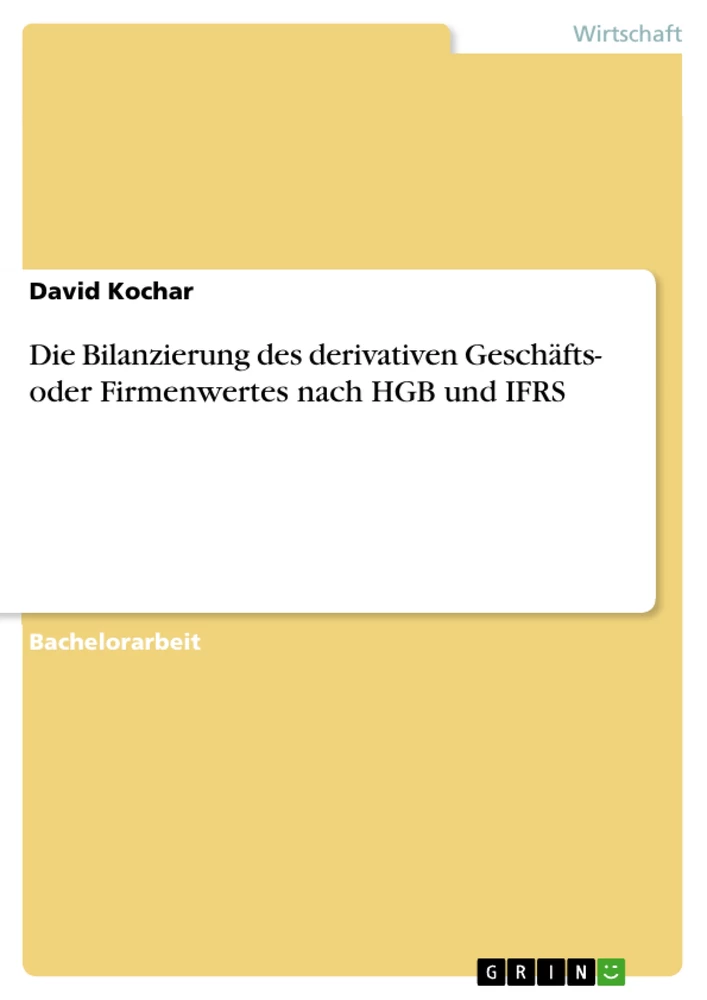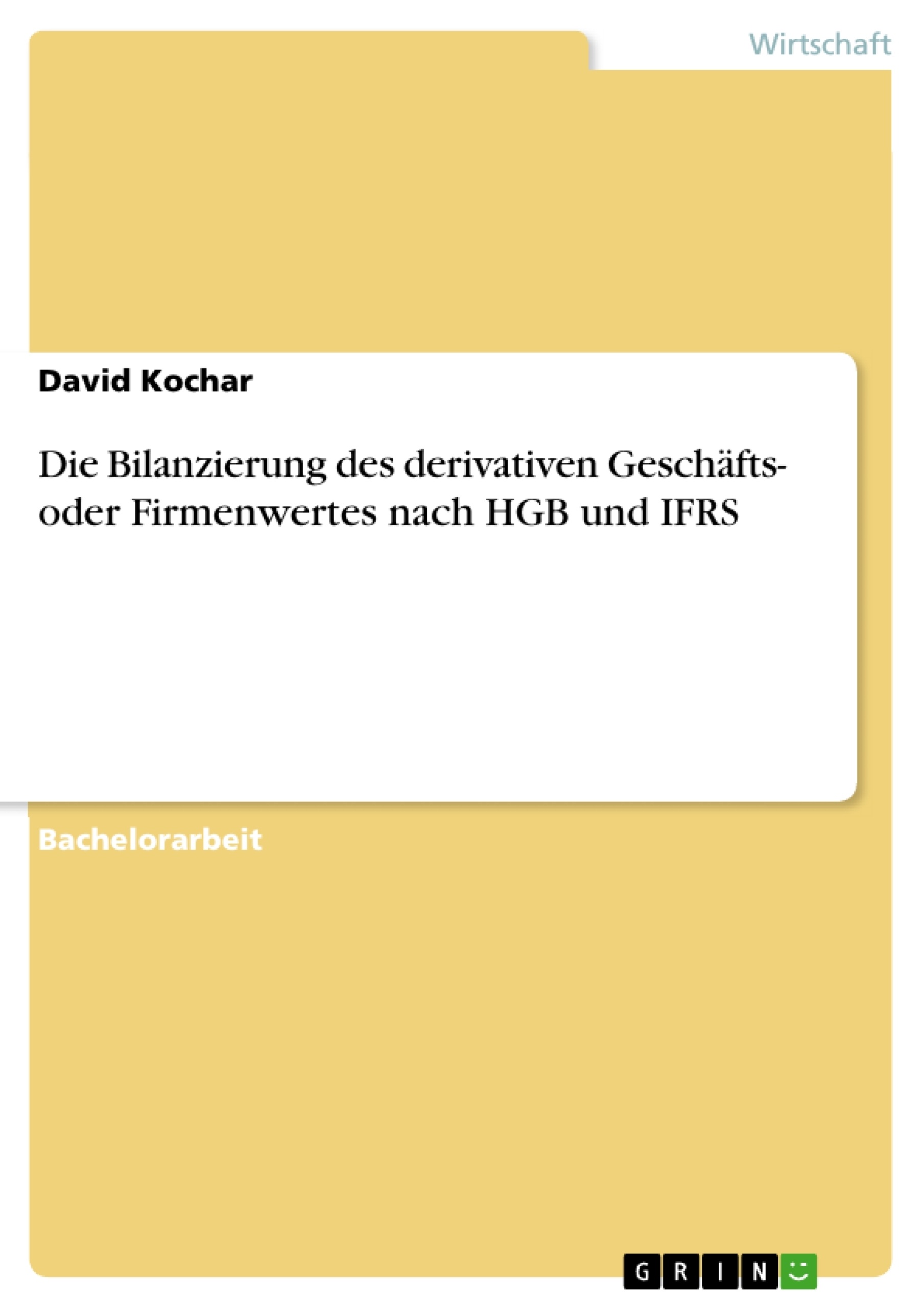Nach einer theoretisch fundierten Darstellung von Begriffskonzeption und Bilanzierungsmöglichkeiten des Goodwills sollen im Rahmen der Arbeit existierende Normen gem. HGB und IFRS hinsichtlich des Erstansatzes sowie der Erst- und Folgebewertung miteinander verglichen werden, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede herauszuarbeiten, wobei der Schwerpunkt auf Bewertungskonzeptionen und Abschreibungszeiträumen (d. h. der Lebensdauer des Firmenwertes) liegt. Darauf aufbauend soll anhand ausgewählter Unternehmensakquisitionen (im Rahmen von Asset Deals) aufgezeigt werden, mit welchem Anteil der Goodwill in den Kaufpreis eingeht, d. h. wie hoch im Einzelnen die Differenz zwischen dem gezahlten Kaufpreis und dem neubewerteten Reinvermögen der übernommenen Wirtschaftsgüter ist. Folgerichtig muss ebenso danach gefragt werden, wie solche Differenzen zustande kommen, d. h. welche konkreten immateriellen Vermögensvorteile - die i. E. den Goodwill bilden - ausschlaggebend dafür sind, dass der Käufer bereit ist, einen höheren Preis zu zahlen. In einem letzten Teil der praktischen Untersuchung soll schließlich die bilanzielle Abbildung des Goodwills im Vordergrund stehen. Nachdem im vorangegangen Kapitel der Versuch unternommen wird, die wertmäßigen Komponenten des Goodwills aufzuschlüsseln, ist es nunmehr Fragestellung, wie der bilanzielle Wert in der Zukunft fortgeführt wird.
Inhaltsverzeichnis
- Problemstellung
- Theoretische Konzeption des Geschäfts- oder Firmenwertes
- Begriffskonzeption
- Substanzwert des Unternehmens
- Ertragswert des Unternehmens
- Der originäre Geschäfts- oder Firmenwert als Residualgröße
- Abgrenzung zum derivativen Geschäfts- oder Firmenwert
- Beispiel und Fazit
- Denkbare Bilanzierungsmöglichkeiten des Geschäfts- oder Firmenwertes vor bilanztheoretischem Hintergrund
- Grundsätze externer Rechnungslegung
- Formelle Bilanztheorie
- Materielle Bilanztheorie
- Fazit
- Bilanzierungsgrundsätze für den derivativen Geschäfts- oder Firmenwert im Einzelabschluss
- Bilanzierung nach dem deutschen Handelsgesetzbuch (HGB)
- Bilanzierung dem Grunde nach
- Bilanzierung der Höhe nach
- Bilanzierung nach den International Financial Reporting Standards (IFRS)
- Bilanzierung dem Grunde nach
- Bilanzierung der Höhe nach
- Vergleichende Gegenüberstellung
- Der Geschäfts- oder Firmenwert in der unternehmerischen Praxis
- Einfluss und Bewertung des Goodwills am Beispiel der Bayer AG
- Asset Deal: Bayer AG und Merck & Co., Inc.
- Ertragswertmodellierung
- Fazit
- Planmäßige Abschreibung des Goodwills im HGB-Einzelabschluss
- Außerplanmäßige Abschreibung des Goodwills am Beispiel der Commerzbank AG
- Resegmentierung als Wertminderungsindikator
- Einflussgrößen der Ertragsbewertung
- Wesentliche Gemeinsamkeiten und Unterschiede der außerplanmäßigen Folgebewertung nach IFRS und HGB
- Thesenförmige Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit befasst sich mit der Bilanzierung des derivativen Geschäfts- oder Firmenwertes nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und den International Financial Reporting Standards (IFRS). Die Arbeit analysiert die verschiedenen Konzepte und Bilanzierungsmöglichkeiten des Geschäfts- oder Firmenwertes und beleuchtet die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Rechnungslegungsstandards. Darüber hinaus werden die praktischen Implikationen des Goodwills im Rahmen von Unternehmenskäufen anhand von Fallbeispielen aus der Wirtschaft untersucht.
- Begriffsbestimmung und Abgrenzung des derivativen Geschäfts- oder Firmenwertes
- Bilanzierungsgrundsätze nach HGB und IFRS
- Bewertung des Goodwills in der Praxis
- Planmäßige und außerplanmäßige Abschreibung des Goodwills
- Vergleichende Analyse der Bilanzierung nach HGB und IFRS
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Problemstellung der Bilanzierung des derivativen Geschäfts- oder Firmenwertes ein und skizziert die Relevanz des Themas für die Rechnungslegung. Das zweite Kapitel befasst sich mit der theoretischen Konzeption des Geschäfts- oder Firmenwertes und beleuchtet verschiedene Begriffsbestimmungen und Bilanzierungsmöglichkeiten im Kontext unterschiedlicher Bilanztheorien. Im dritten Kapitel werden die Bilanzierungsgrundsätze für den derivativen Geschäfts- oder Firmenwert im Einzelabschluss nach HGB und IFRS detailliert dargestellt und verglichen. Das vierte Kapitel untersucht die praktische Relevanz des Goodwills im Rahmen von Unternehmenskäufen und zeigt anhand von Fallbeispielen die Auswirkungen auf die Bilanzierung auf.
Schlüsselwörter
Derivativer Geschäfts- oder Firmenwert, Goodwill, Bilanzierung, HGB, IFRS, Unternehmenskauf, Wertminderung, Abschreibung, Rechnungslegung, Unternehmensbewertung.
- Citar trabajo
- David Kochar (Autor), 2017, Die Bilanzierung des derivativen Geschäfts- oder Firmenwertes nach HGB und IFRS, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/385388