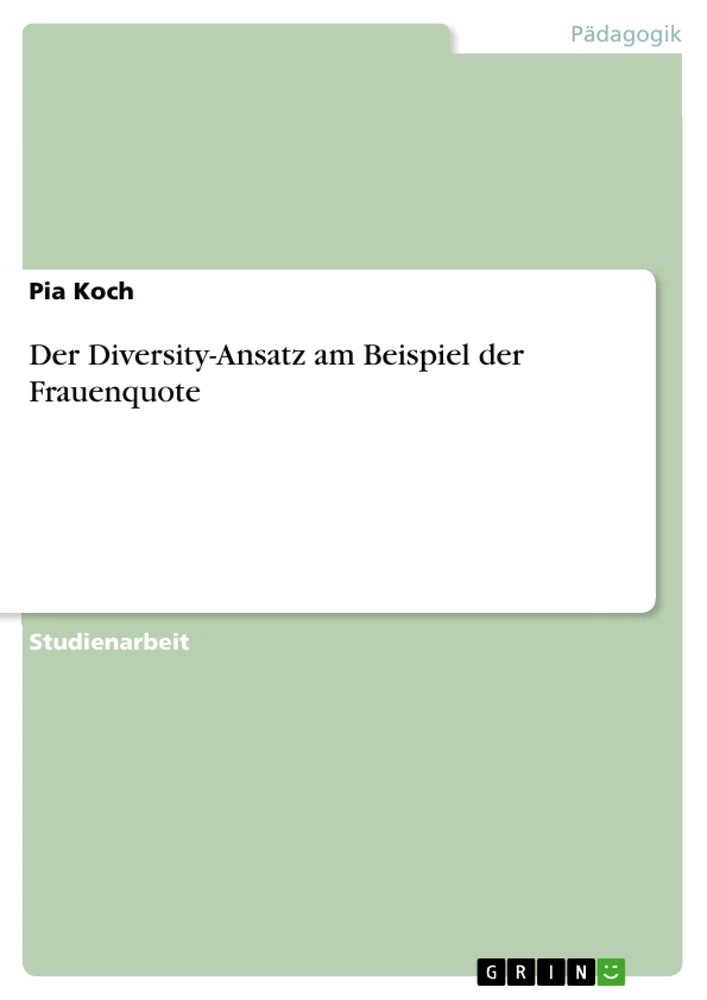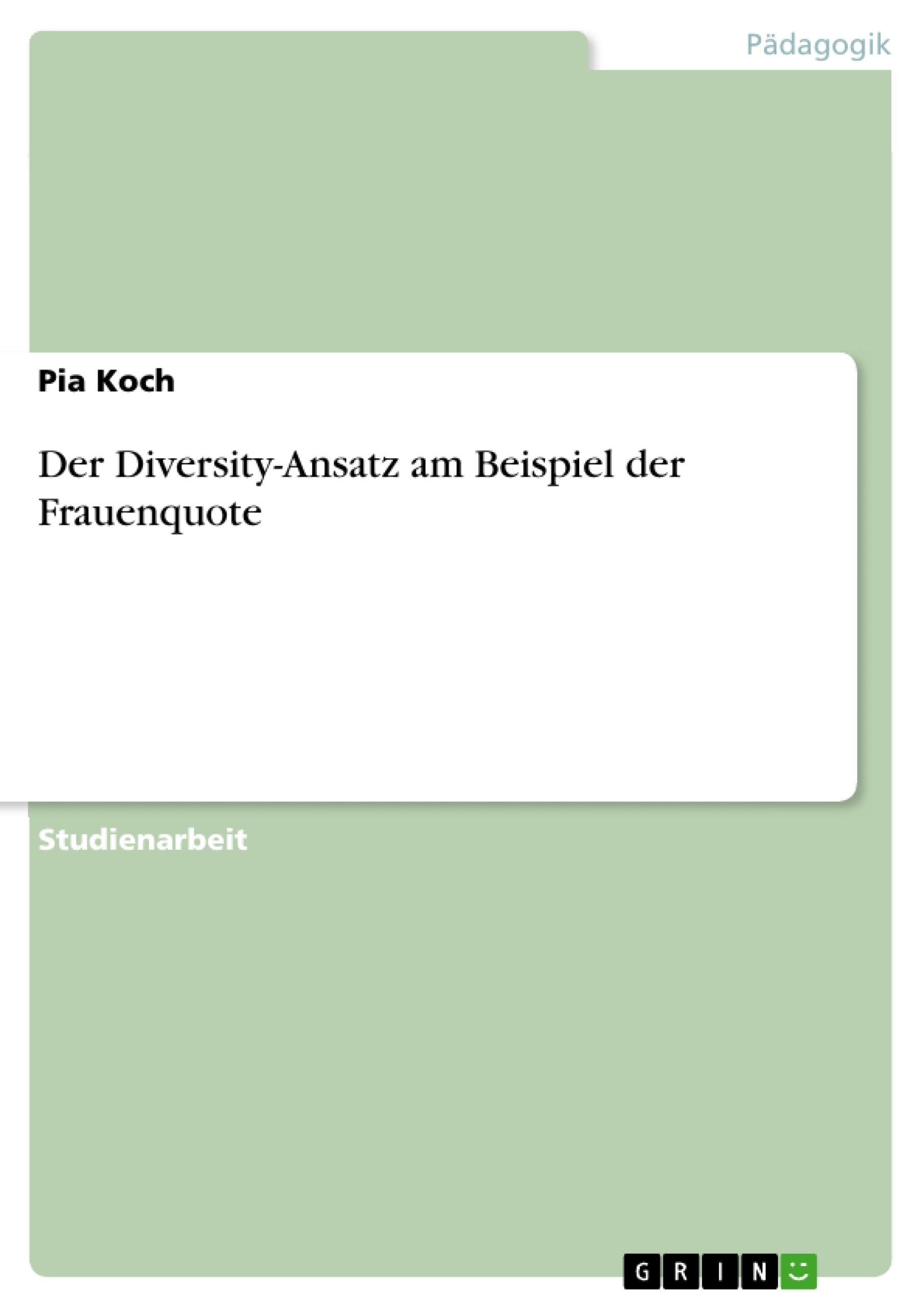Wird der Themenimpulskomplex Gerechtigkeitsindustrie betrachtet, fällt auf, dass dieser Begriff, durch seinen impliziten diffusen Charakter und der auch daraus resultierenden Gegebenheit, unausweichlich definitorischer Ausdifferenzierung bedarf. Folgend wird dementsprechend versucht, über eine logische Herangehensweise auszudifferenzieren, welche Realität der Begriff Gerechtigkeitsindustrie bemüht zu umschreiben. Hierfür wird sich der Wissenschaft der Linguistik bedient, welche wiederum Kategorien bereitstellt, die es ermöglichen, den Begriff Gerechtigkeitsindustrie zuzuordnen und dessen Charakter konkret zu umschreiben.
Auf die definitorische Grundlegung folgt zudem eine Verortung der Diversity Studies im wissenschaftlichen Diskurs. Konkret wird das Thema aufgearbeitet im Rahmen einer fachdidaktischen Ausdifferenzierung innerhalb des Themenkomplex Frauenquote.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Definitorische Grundlegung
- 1.1. Vom Neologismus zum dysphemistischen Charakter des Wortes Gerechtigkeitsindustrie
- 1.2. Der Diversity Ansatz als Kondensation des Begriffs Gerechtigkeitsindustrie
- 1.3. Definitorische Grundlegung - der Begriffe Diversity und Diversity Management
- 1.4. Definition Diversity Dimensionen
- 2. Interdisziplinärer und Disziplinärer Wissenschaftsbereich
- 2.1. Verortung Diversity Studies im wissenschaftlichen Diskurs
- 2.2. Interdisziplinärer Bereich
- 2.2.1. Historische Perspektive
- 2.2.2. Sozialwissenschaftliche Perspektive
- 2.2.3. Rechtliche Perspektive
- 2.3. Disziplinärer Bereich
- 2.3.1. Diversity Management im Human Ressource Management
- 2.3.2. Volkswirtschaftliche Perspektive
- 2.3.3. Ökonomische Perspektive
- 2.3.4. Diversity Management in deutschen Unternehmen
- 3. Fachdidaktische Ausdifferenzierung innerhalb des Themenkomplexes: Frauenquote
- 3.1. Konkretisierung der Lerngruppe
- 3.2. Differenzierung der möglichen Lernbiografien der Lerner
- 3.3. Konkretisierung des Themenkomplexes
- 3.4. Fünf Grundfragen der didaktischen Analyse nach Klafki
- 3.4.1. Gegenwartsbedeutung des Inhaltes für die Zielgruppe
- 3.4.2. Zukunftsdeutung des Inhaltes
- 3.4.3. Exemplarische Bedeutung
- 3.4.4. Struktur der Thematik
- 3.4.5. Zugänglichkeit
- 4. Konkretisierung der Lehr- und Lernsituation für das Themenkomplex: Frauenquote
- 4.1. Legitimation und Einordnung
- 4.2. Angestrebte Lernziele
- 4.3. Sachanalyse Frauenquote
- 4.4. Didaktische Reduktion
- 4.5. Didaktische Strukturierung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert den Neologismus „Gerechtigkeitsindustrie“ und dessen Bezug zum Diversity-Ansatz, speziell am Beispiel der Frauenquote. Ziel ist die fachdidaktische Ausdifferenzierung dieses komplexen Themas für eine Lehr-/Lernsituation. Die Arbeit untersucht den Begriff „Gerechtigkeitsindustrie“ linguistisch und verortet Diversity Studies im wissenschaftlichen Diskurs.
- Linguistische Analyse des Begriffs „Gerechtigkeitsindustrie“
- Verortung von Diversity Studies im wissenschaftlichen Kontext
- Fachdidaktische Aufarbeitung des Themas Frauenquote
- Konkretisierung einer Lehr- und Lernsituation zum Thema Frauenquote
- Didaktische Analyse nach Klafki
Zusammenfassung der Kapitel
1. Definitorische Grundlegung: Dieses Kapitel beginnt mit der Analyse des Begriffs „Gerechtigkeitsindustrie“, eines Neologismus, der aufgrund seines diffusen Charakters einer genauen Definition bedarf. Es wird eine linguistische Herangehensweise gewählt, um den Begriff zu kategorisieren und dessen Bedeutung zu klären. Die Analyse betrachtet die Wortbestandteile „Gerechtigkeit“ und „Industrie“ und untersucht deren Verhältnis zur Realität. Der Abschnitt beleuchtet den dysphemistischen Charakter des Begriffs und setzt ihn in Relation zum Diversity-Ansatz.
2. Interdisziplinärer und Disziplinärer Wissenschaftsbereich: Dieses Kapitel verortet Diversity Studies innerhalb des wissenschaftlichen Diskurses. Es differenziert zwischen interdisziplinären und disziplinären Perspektiven. Der interdisziplinäre Bereich umfasst historische, sozialwissenschaftliche und rechtliche Perspektiven auf Diversity. Der disziplinäre Teil fokussiert auf Diversity Management im Human Ressource Management, volkswirtschaftliche und ökonomische Perspektiven sowie die Umsetzung von Diversity Management in deutschen Unternehmen. Der Kapitel fasst die verschiedenen wissenschaftlichen Zugänge zum Thema zusammen und zeigt deren Relevanz für das Verständnis von Diversity auf.
3. Fachdidaktische Ausdifferenzierung innerhalb des Themenkomplexes: Frauenquote: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die didaktische Aufbereitung des Themas Frauenquote. Es beschreibt die Lerngruppe, differenziert mögliche Lernbiografien und konkretisiert den Themenkomplex. Im Mittelpunkt steht die Anwendung der fünf Grundfragen der didaktischen Analyse nach Klafki: Gegenwarts- und Zukunftsbedeutung, exemplarische Bedeutung, Struktur der Thematik und Zugänglichkeit. Dieses Kapitel legt die Grundlage für den praktischen Unterricht.
4. Konkretisierung der Lehr- und Lernsituation für das Themenkomplex: Frauenquote: Das Kapitel beschreibt die konkrete Gestaltung der Lehr- und Lernsituation zum Thema Frauenquote. Es beinhaltet die Legitimation und Einordnung des Themas, definiert die angestrebten Lernziele und führt eine Sachanalyse der Frauenquote durch. Die didaktische Reduktion und Strukturierung des Stoffes wird detailliert erläutert, um einen effektiven und verständlichen Unterricht zu gewährleisten.
Schlüsselwörter
Gerechtigkeitsindustrie, Diversity, Diversity Management, Frauenquote, fachdidaktische Analyse, Klafki, Neologismus, Interdisziplinarität, ökonomische Perspektive, Sozialwissenschaftliche Perspektive, Rechtliche Perspektive, Human Resource Management.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Gerechtigkeitsindustrie, Diversity und Frauenquote
Was ist der Gegenstand der Arbeit?
Die Arbeit analysiert den Begriff „Gerechtigkeitsindustrie“ im Kontext des Diversity-Ansatzes, insbesondere am Beispiel der Frauenquote. Sie untersucht den Begriff linguistisch, verortet Diversity Studies im wissenschaftlichen Diskurs und entwickelt eine fachdidaktische Aufbereitung des Themas Frauenquote für den Unterricht.
Welche Aspekte der „Gerechtigkeitsindustrie“ werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet den Neologismus „Gerechtigkeitsindustrie“, untersucht seinen dysphemistischen Charakter und setzt ihn in Beziehung zum Diversity-Ansatz. Es wird eine linguistische Analyse der Wortbestandteile und deren Verhältnis zur Realität vorgenommen.
Wie werden Diversity Studies im wissenschaftlichen Diskurs verortet?
Die Arbeit differenziert zwischen interdisziplinären (historische, sozialwissenschaftliche, rechtliche Perspektiven) und disziplinären (Diversity Management im HRM, volkswirtschaftliche, ökonomische Perspektiven, Umsetzung in deutschen Unternehmen) Perspektiven auf Diversity Studies und zeigt deren Relevanz für das Verständnis von Diversity.
Wie wird das Thema Frauenquote fachdidaktisch aufgearbeitet?
Die Arbeit beschreibt die Zielgruppe, differenziert mögliche Lernbiografien und konkretisiert den Themenkomplex „Frauenquote“. Sie wendet die fünf Grundfragen der didaktischen Analyse nach Klafki an (Gegenwarts- und Zukunftsbedeutung, exemplarische Bedeutung, Struktur der Thematik und Zugänglichkeit) um eine geeignete Unterrichtsgestaltung zu entwickeln.
Wie wird eine konkrete Lehr- und Lernsituation zum Thema Frauenquote gestaltet?
Die Arbeit beschreibt die Legitimation und Einordnung des Themas, definiert Lernziele, führt eine Sachanalyse der Frauenquote durch und erläutert die didaktische Reduktion und Strukturierung des Stoffes für einen effektiven Unterricht.
Welche Schlüsselbegriffe sind zentral für die Arbeit?
Zentrale Schlüsselbegriffe sind: Gerechtigkeitsindustrie, Diversity, Diversity Management, Frauenquote, fachdidaktische Analyse, Klafki, Neologismus, Interdisziplinarität, ökonomische Perspektive, sozialwissenschaftliche Perspektive, rechtliche Perspektive, Human Resource Management.
Welche Kapitel beinhaltet die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: 1. Definitorische Grundlegung, 2. Interdisziplinärer und Disziplinärer Wissenschaftsbereich, 3. Fachdidaktische Ausdifferenzierung innerhalb des Themenkomplexes: Frauenquote, und 4. Konkretisierung der Lehr- und Lernsituation für das Themenkomplex: Frauenquote. Jedes Kapitel wird in der Zusammenfassung der Kapitel detailliert beschrieben.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, den Neologismus „Gerechtigkeitsindustrie“ und dessen Bezug zum Diversity-Ansatz, speziell am Beispiel der Frauenquote, zu analysieren und fachdidaktisch für eine Lehr-/Lernsituation aufzubereiten. Weiterhin soll der Begriff „Gerechtigkeitsindustrie“ linguistisch analysiert und Diversity Studies im wissenschaftlichen Diskurs verortet werden.
- Quote paper
- Pia Koch (Author), 2017, Der Diversity-Ansatz am Beispiel der Frauenquote, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/384885