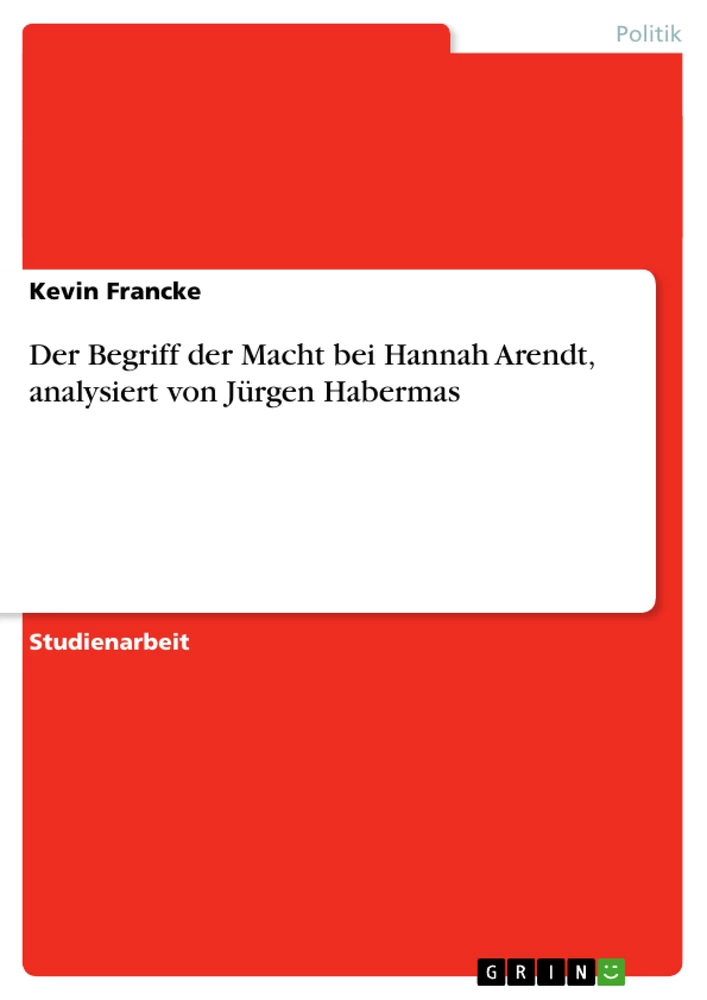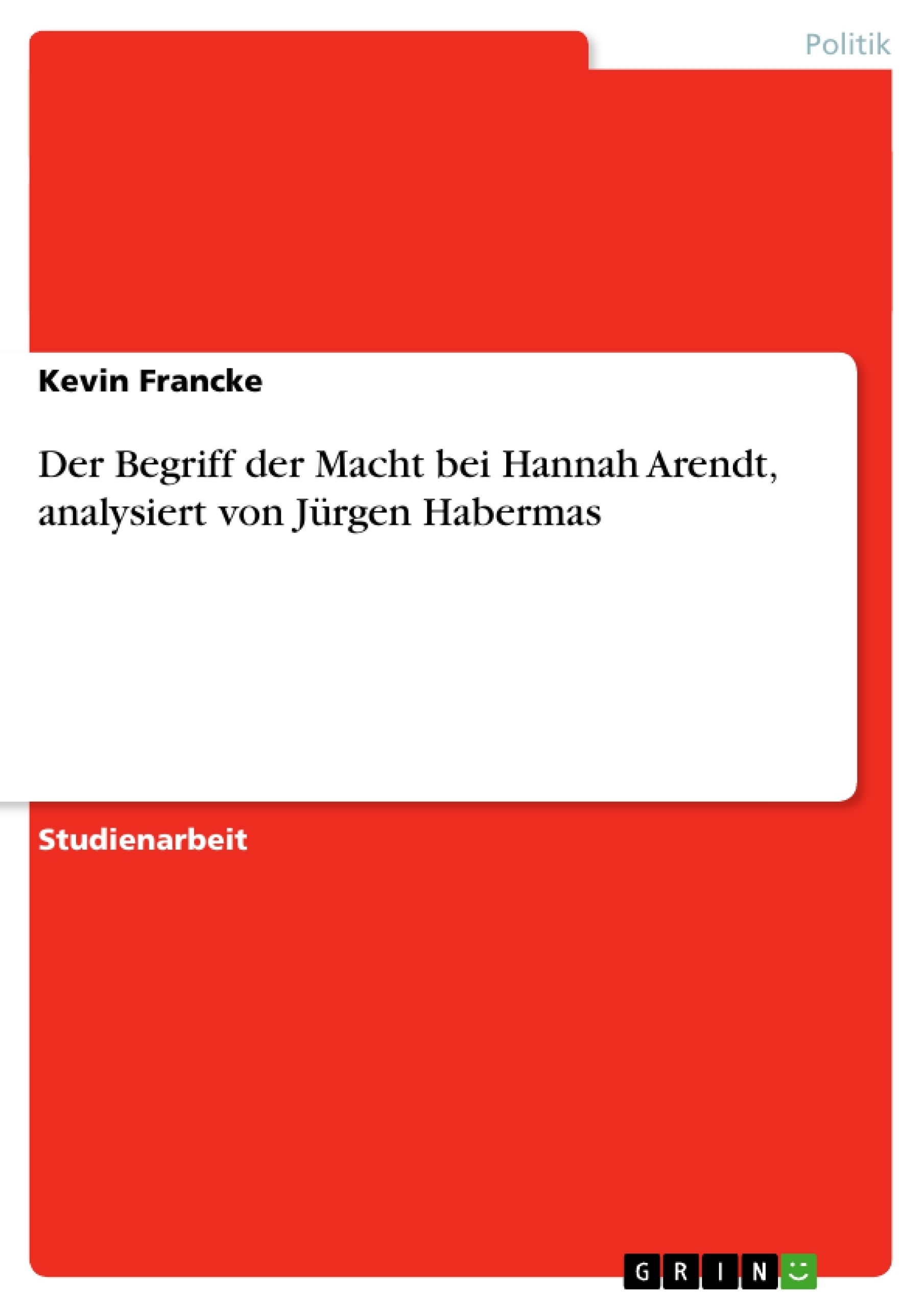Der Begriff der Macht ist ein nicht leicht zu fassender. Nach Hannah Arendt vermischen viele große Denker den Begriff der Macht mit dem der Gewalt1. Die weithin anerkannte Definition von Macht bei Max Weber sieht diese als „Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen, gleichviel worauf diese Chance beruht “2. Weber setzt schon ein Ziel, das es zu erreichen gäbe voraus und argumentiert in eine andere Richtung als Arendt. Zudem bleibt er so ungenau, dass diese Definition ebenso dem Gewaltbegriff Arendt entsprechen könnte. Neben Max Weber zitiert Hannah Arendt zur Veranschaulichung C. W. Mills, der Gewalt als „aufs höchste gesteigerte Macht“ bezeichne 3. Wie wir sehen werden, funktioniert diese Verbindung nach Arendts Definitionen nicht.
Und Jouvenel rechne zum Wesen des Staates den Krieg; bei Arendt sei Staat aber der bloße Überbau aus Gesetzen und Institutionen, welche durch legitime Machtverhältnisse entstanden seien, und daher Gewalt als Wesenseigenschaft von vornherein ausgeschlossen4. Jürgen Habermas hat Arendts Begriff von Macht grundlegender analysiert und kommt zu dem Schluss, dass dieser vor allem normativ gedacht werden muss. Daher kann er nicht empirisch an bestehenden Machtsystemen geprüft werden. Ein Phänomen wie strukturelle Gewalt kann daher in ihrem Verständnis nicht existieren.
Es soll mit dieser Arbeit unter Zuhilfenahme einer Abhandlung zu Macht von Jürgen Habermas Hannah Arendts Begriff der Macht – auch in Abgrenzung zu dem der Gewalt – dargestellt werden. In der Realität wird dieser wohl in der Reinheit nicht anzutreffen sein, was Arendt auch selber zugibt5. Doch mit einer Begriffsdefinition, die das eigentlich Wesentliche der Macht beschreibt, lassen sich deutlicher bestehende Verhältnisse unterscheiden und Missstände in einem politischen System erkennen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Hannah Arendts Machtbegriff
- 2.1. Versuch einer empirischen Prüfung
- 2.2. Sekundärer Zweck der Macht
- 2.3. Kritik an Hannah Arendt
- 3. Kritische Betrachtung seitens Jürgen Habermas
- 3.1. Unterscheidung verschiedener Modelle
- 3.2. Das Element der strukturellen Gewalt
- 3.3. Verortung im Naturrecht
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Hannah Arendts Machtbegriff im Vergleich zu Jürgen Habermas' kritischer Analyse. Ziel ist es, Arendts Verständnis von Macht, insbesondere im Unterschied zu Gewalt, darzustellen und die Grenzen einer rein empirischen Prüfung dieses Begriffs zu beleuchten.
- Arendts Definition von Macht als Selbstzweck und ihre Abgrenzung von Gewalt
- Die Rolle der Gruppenbildung und Konsensfindung in Arendts Machtbegriff
- Habermas' Kritik an Arendts normativem Machtverständnis
- Die Problematik der empirischen Prüfung von Arendts Machtbegriff
- Die Bedeutung von Legitimität und die Folgen von Machtmissbrauch
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Problematik des Machtbegriffs ein und stellt die unterschiedlichen Ansätze von Hannah Arendt und Max Weber gegenüber. Sie hebt die Schwierigkeiten hervor, die sich aus der Vermischung von Macht und Gewalt ergeben, und benennt Jürgen Habermas' kritische Auseinandersetzung mit Arendts Theorie als zentralen Bezugspunkt der Arbeit. Die Einleitung skizziert den Aufbau der Arbeit und betont die Notwendigkeit einer klaren Begriffsdefinition zur Analyse politischer Verhältnisse.
2. Hannah Arendts Machtbegriff: Dieses Kapitel beschreibt Arendts primär normativ gedachte Machtdefinition als Selbstzweck, abgeleitet aus der Übereinstimmung von Meinungen innerhalb einer Gruppe. Es wird betont, dass Macht im Gegensatz zu Gewalt gewaltlos funktioniert und ihre Legitimität aus dem Konsens der Gruppe bezieht. Die Entziehung der Legitimität, zum Beispiel durch die Ablehnung der Meinung des Vertreters durch die Gruppe, führt zum Verlust der Macht. Das Kapitel beleuchtet die Bedingung der Gruppenbildung als Grundlage für Macht und die ausschließliche gewaltlose Natur von Macht.
2.1. Versuch einer empirischen Prüfung: Dieser Abschnitt untersucht die Anwendbarkeit von Arendts Machtbegriff auf reale politische Systeme. Am Beispiel von demokratischen Institutionen wie dem Bundestag wird die Legitimation durch die Anerkennung der Mehrheit des Volkes erläutert. Der Verlust der Legitimität durch mangelnde Anerkennung, beispielsweise durch Widerstand gegen Staatsorgane, wird als Faktor für den Machtverlust beschrieben. Die Arbeit diskutiert auch die Möglichkeit, dass unkontrollierte Macht zu Unterdrückung von Minderheiten führen kann, selbst ohne den Einsatz von offener Gewalt.
3. Kritische Betrachtung seitens Jürgen Habermas: Dieses Kapitel analysiert Habermas' Kritik an Arendts Machtbegriff. Es geht auf die Unterscheidung verschiedener Machtmodelle ein und beleuchtet das Konzept der strukturellen Gewalt, welches in Arendts Verständnis keinen Platz findet. Der Abschnitt diskutiert die Einordnung von Arendts Theorie in den Kontext des Naturrechts und untersucht die Implikationen von Habermas' Kritik für das Verständnis von Macht in der politischen Praxis.
Schlüsselwörter
Macht, Gewalt, Hannah Arendt, Jürgen Habermas, Legitimität, Gruppenbildung, Konsens, empirische Prüfung, normative Theorie, strukturelle Gewalt, Naturrecht, politische Theorie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse des Machtbegriffs bei Hannah Arendt und Jürgen Habermas
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit vergleicht und kontrastiert die Machtkonzepte von Hannah Arendt und Jürgen Habermas. Sie untersucht Arendts Definition von Macht, insbesondere ihre Abgrenzung von Gewalt, und analysiert Habermas' Kritik an Arendts Ansatz.
Welche zentralen Themen werden behandelt?
Zentrale Themen sind Arendts Definition von Macht als Selbstzweck und ihre Abgrenzung von Gewalt, die Rolle von Gruppenbildung und Konsensfindung, Habermas' Kritik an Arendts normativem Machtverständnis, die Problematik der empirischen Prüfung von Arendts Machtbegriff, die Bedeutung von Legitimität und die Folgen von Machtmissbrauch, sowie das Konzept der strukturellen Gewalt bei Habermas.
Wie definiert Hannah Arendt Macht?
Arendt versteht Macht primär als normativen Begriff, der aus der Übereinstimmung von Meinungen innerhalb einer Gruppe entsteht. Macht ist für sie gewaltlos und bezieht ihre Legitimität aus dem Konsens der Gruppe. Der Verlust dieser Legitimität führt zum Machtverlust.
Wie lässt sich Arendts Machtbegriff empirisch prüfen?
Die Arbeit untersucht die Anwendbarkeit von Arendts Machtbegriff auf reale politische Systeme. Am Beispiel demokratischer Institutionen wird die Legitimation durch die Anerkennung der Mehrheit erläutert. Die Schwierigkeit liegt in der Herausforderung, den normativen Charakter von Arendts Theorie mit empirischen Beobachtungen in Einklang zu bringen.
Welche Kritik übt Jürgen Habermas an Arendts Machtbegriff?
Habermas kritisiert Arendts normatives Machtverständnis und hebt die Bedeutung von struktureller Gewalt hervor, die in Arendts Konzept nicht ausreichend berücksichtigt wird. Die Arbeit diskutiert die Einordnung von Arendts Theorie in den Kontext des Naturrechts und die Implikationen von Habermas' Kritik für das Verständnis von Macht in der politischen Praxis.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Schlüsselbegriffe sind Macht, Gewalt, Hannah Arendt, Jürgen Habermas, Legitimität, Gruppenbildung, Konsens, empirische Prüfung, normative Theorie, strukturelle Gewalt, Naturrecht und politische Theorie.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu Hannah Arendts Machtbegriff (inklusive eines Unterkapitels zum Versuch einer empirischen Prüfung), ein Kapitel zur kritischen Betrachtung durch Jürgen Habermas und ein Fazit.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel ist es, Arendts Verständnis von Macht darzustellen, die Grenzen einer rein empirischen Prüfung dieses Begriffs zu beleuchten und die kritische Auseinandersetzung Habermas' damit zu analysieren.
Wie wird der Unterschied zwischen Macht und Gewalt dargestellt?
Die Arbeit betont den fundamentalen Unterschied: Macht basiert auf Konsens und ist gewaltfrei, während Gewalt ein Mittel zur Durchsetzung des Willens gegen den Willen anderer ist.
- Quote paper
- Kevin Francke (Author), 2004, Der Begriff der Macht bei Hannah Arendt, analysiert von Jürgen Habermas, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/38450