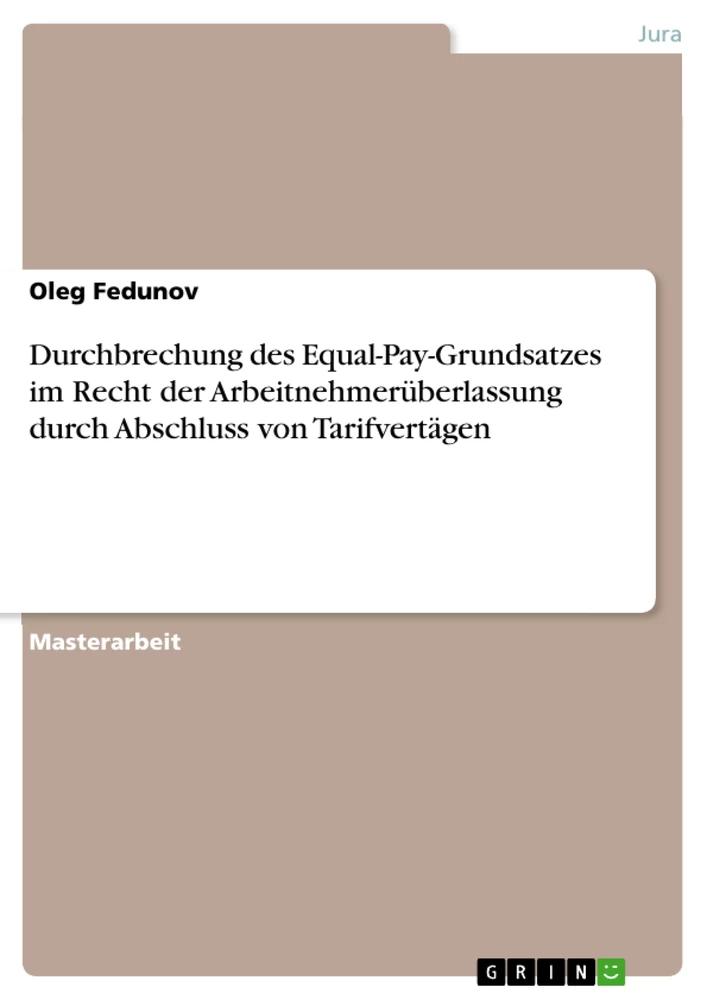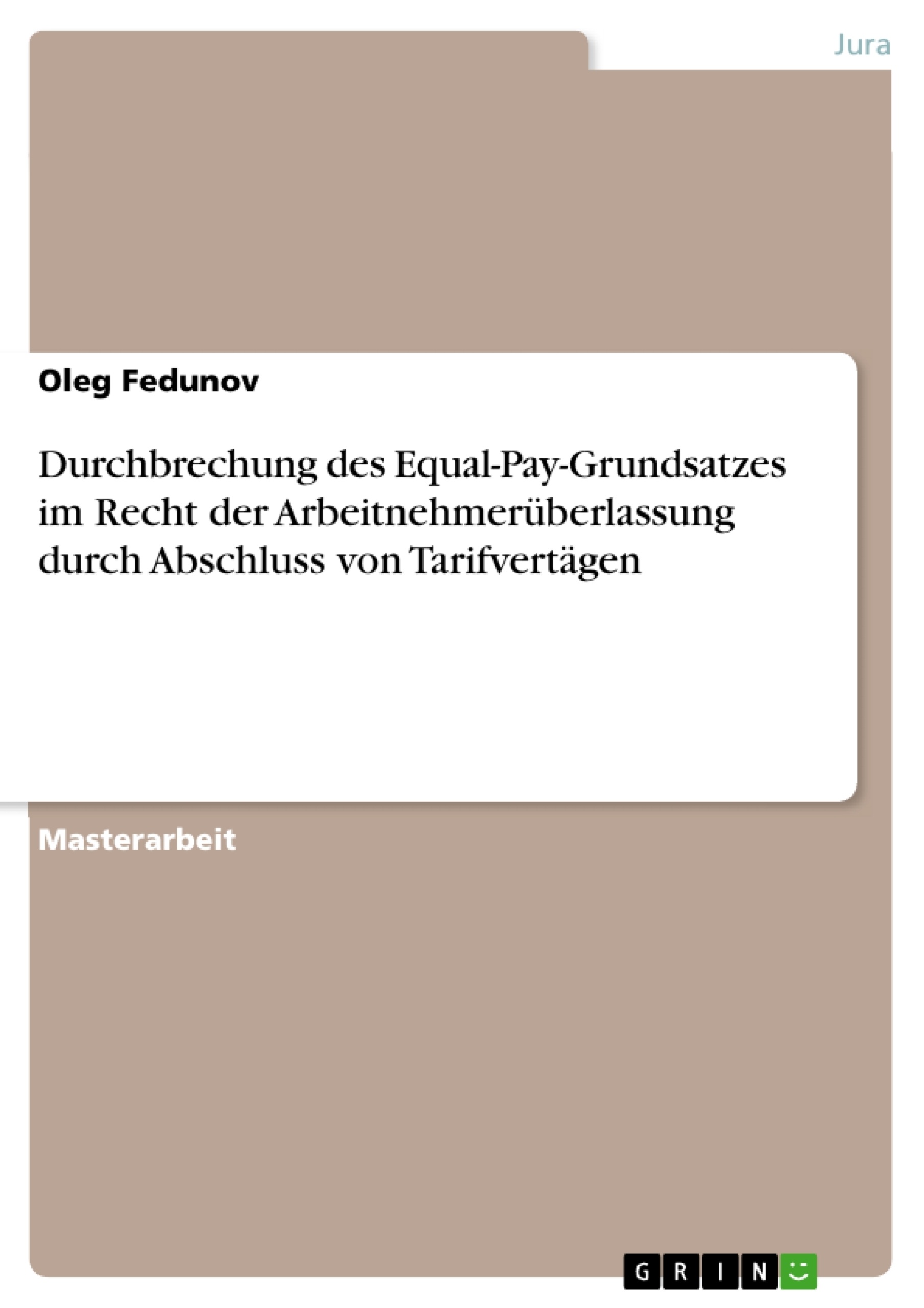Zeitarbeit wird in Deutschland im Gesetz zur Regelung der Arbeitnehmerüberlassung (AÜG) geregelt, das in seinem §1 I eine Legaldefinition dieses Rechtsinstituts enthält.
Danach liegt eine Arbeitnehmerüberlassung vor, wenn ein Verleiher dem Entleiher aufgrund eines Überlassungsvertrages einen Mitarbeiter vorübergehend zur Arbeitsleistung zur Verfügung stellt, welcher mit dem Verleiher in einem Arbeitsverhältnis steht. Die Arbeitgeberstellung wird vom Gesetz ausschließlich dem Verleiher zugewiesen, §1 I S. 3 AÜG. Dem Entleiher fallen dennoch bestimmte Arbeitgeberfunktionen wie das Weisungsrecht (§1 I S. 1 AÜG), die Pflicht zur Beachtung des Arbeitsschutzes (§11 VI AÜG), Ansprüche aus einem innerbetrieblichen Schadensausgleich zu, weswegen ein faktisch gespaltenes Arbeitsverhältnis in Rege steht. Die Lohnzahlungspflicht (§611 I BGB) verbleibt jedoch vollständig beim Verleiher.
Die Arbeitnehmerüberlassung erlebte in ihrer Entwicklung eine Phase strikter Reglementierung, die über mehrere Reformen des AÜG zu einer schrittweise Lockerung der Restriktionen führte. Seit 2003 findet sich im AÜG eine Vorschrift, nach der der Verleiher dem Arbeitnehmer während des Fremdeinsatzes dieselben Arbeitsbedingungen zu gewähren hat, die für vergleichbare Stammarbeitnehmer im Entleiherbetrieb gelten (Equal-Treatment-Grundsatz) und insbesondere das Arbeitsentgelt erfasst (Equal-Pay-Grundsatz). Allerdings kommen die Grundsätze nach dem Gesetz nicht unbedingt und in der Rechtswirklichkeit nur sehr selten zur Anwendung. Die nahezu vollständige Liberalisierung der Zeitarbeit in den 2000er Jahren führte dazu, dass sich das Lohnniveau der Branche immer weiter vom Grundsatz entfernte und letztendlich zu einer Diskussion über „Hungerlöhne“ führte. Neuerdings wird versucht, das Rechtsinstitut mit neuen Schranken zu belegen und somit auch den Löhnen eine Richtung nach oben zu weisen.
Dieser Skizze folgt die Arbeit, die mit der rechtshistorischen Entwicklung der Arbeitnehmerüberlassung beginnend zur Darstellung des Equal-Pay-Grundsatzes führt und mit der Schilderung von Abweichungsmöglichkeiten aufgrund tarifvertraglicher Regelungen innerhalb geltender Schranken abschließt.
Inhaltsverzeichnis
- A. Entwicklungsetappen des Rechtsinstituts Zeitarbeit
- I. Emanzipation von der Arbeitnehmerüberlassung und starke Reglementierung
- II. Sukzessive Lockerung der Beschränkungen
- III. Erstes Gleichstellungskonzept
- IV. Weitgehende Liberalisierung
- V. Zunehmende Reglementierung
- B. Equal Pay
- I. Gleicher Lohn für gleich gute Arbeit
- II. Rückführung auf die Kernfunktion der Leiharbeit
- 1. Zieltauglichkeit
- 2. Vereinbarkeit des §8 I mit höherrangigem Recht aus der Sicht der ,,Rückführungsfunktion"
- a) §8 I und die Tarifautonomie
- b) §8 I und die Berufsfreiheit
- c) §8 I und das Demokratie- bzw. Rechtsstaatprinzip
- d) §8 I und das Gleichheitsgrundrecht
- 3. Auf einen Punkt gebracht
- III. Gleichstellungsgrundsatz und Kernfunktion der Leiharbeit
- IV. Arbeitsentgeltbegriff des §8 I
- C. Abweichung vom Equal Pay durch Tarifverträge
- I. Innenschranken der Tarifmacht
- 1. Tariffähigkeit
- a) Allgemeine Fragen
- b) Tariffähigkeit einer Spitzenorganisation
- 2. Tarifzuständigkeit
- a) Allgemeine Fragen
- b) Tarifzuständigkeit einer Spitzenorganisation
- c) Tarifzuständigkeit einer Tarifgemeinschaft
- 3. Unmittelbare Geltung
- 4. Geltung infolge arbeitsvertraglicher Bezugnahme
- II. Außenschranken der Tarifmacht
- 1. Mindeststundenentgelt
- 2. ,,Drehtür-\" bzw. „,Schlecker-Klausel"
- 3. Begrenzte Ausschlussfrist und tarifliches Equal Pay
- 4. Verbot eines Kettenverleihs
- D. Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich eingehend mit dem Rechtsinstitut der Zeitarbeit, insbesondere im Hinblick auf die Entwicklung des Equal Pay Prinzips. Ziel ist es, die rechtlichen Rahmenbedingungen und die Entwicklung der Regulierung zu analysieren und kritisch zu diskutieren.
- Entwicklung des Rechtsinstituts Zeitarbeit
- Das Prinzip des Equal Pay in der Zeitarbeit
- Tarifverträge und ihre Grenzen im Kontext von Equal Pay
- Rechtliche Schranken der Tarifautonomie
- Konflikte zwischen Equal Pay und der Kernfunktion der Leiharbeit
Zusammenfassung der Kapitel
A. Entwicklungsetappen des Rechtsinstituts Zeitarbeit: Dieses Kapitel zeichnet die historische Entwicklung des Rechtsinstituts Zeitarbeit nach, von den Anfängen bis zur heutigen, stark reglementierten Form. Es beleuchtet die verschiedenen Phasen der Regulierung, von der anfänglichen starken Beschränkung bis hin zur Liberalisierung und der anschließenden Wiederzunahme von Regulierungen. Der Fokus liegt auf den gesellschaftlichen und rechtlichen Faktoren, die diese Entwicklungen beeinflusst haben, und zeigt den Wandel der rechtlichen Rahmenbedingungen auf.
B. Equal Pay: Das Kapitel analysiert das Prinzip des Equal Pay im Kontext der Zeitarbeit. Es untersucht die Frage des gleichen Lohns für gleichwertige Arbeit und beleuchtet die damit verbundenen rechtlichen Herausforderungen. Besonders relevant ist die Diskussion um die Vereinbarkeit von §8 I mit höherrangigem Recht und die Berücksichtigung der Tarifautonomie, der Berufsfreiheit, des Rechtsstaatsprinzips und des Gleichheitsgrundrechts. Die Kernfunktion der Leiharbeit und ihr Verhältnis zum Gleichstellungsgrundsatz werden ebenfalls eingehend untersucht.
C. Abweichung vom Equal Pay durch Tarifverträge: Dieses Kapitel befasst sich mit den Möglichkeiten, vom Equal Pay-Prinzip durch Tarifverträge abzuweichen. Es analysiert sowohl die "Innenschranken" der Tarifmacht (Tariffähigkeit, Tarifzuständigkeit, Unmittelbare Geltung, Geltung infolge arbeitsvertraglicher Bezugnahme) als auch die "Außenschranken" (Mindeststundenentgelt, "Drehtür"-Klauseln, Ausschlussfristen, Verbot von Kettenverleih). Der Fokus liegt auf den Grenzen der Tarifautonomie und der Durchsetzung des Equal Pay-Grundsatzes trotz tariflicher Regelungen.
Schlüsselwörter
Zeitarbeit, Arbeitnehmerüberlassung, Equal Pay, Tarifvertrag, Tarifautonomie, Gleichbehandlung, Gleichstellung, Rechtsstaatsprinzip, §8 I AÜG, Kernfunktion der Leiharbeit, Tarifzuständigkeit, Tariffähigkeit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Entwicklung des Equal Pay Prinzips in der Zeitarbeit
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht umfassend das Rechtsinstitut der Zeitarbeit, insbesondere die Entwicklung und den aktuellen Stand des Equal Pay Prinzips (gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit). Sie analysiert die rechtlichen Rahmenbedingungen, die Entwicklung der Regulierung und kritische Aspekte dieser Thematik.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunktthemen: die historische Entwicklung des Rechtsinstituts Zeitarbeit, das Equal Pay Prinzip im Kontext der Zeitarbeit, die Rolle und Grenzen von Tarifverträgen bei der Durchsetzung von Equal Pay, rechtliche Schranken der Tarifautonomie und Konflikte zwischen Equal Pay und der Kernfunktion der Leiharbeit.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in vier Hauptkapitel: Kapitel A befasst sich mit den Entwicklungsetappen des Rechtsinstituts Zeitarbeit. Kapitel B analysiert das Equal Pay Prinzip, inklusive der Vereinbarkeit von §8 I AÜG mit höherrangigem Recht. Kapitel C untersucht Abweichungen vom Equal Pay durch Tarifverträge, sowohl die "Innenschranken" (Tariffähigkeit, Tarifzuständigkeit etc.) als auch die "Außenschranken" (Mindestlohn, Klauseln etc.) der Tarifautonomie. Kapitel D enthält ein Schlusswort.
Welche Phasen der Entwicklung der Zeitarbeit werden dargestellt?
Kapitel A beschreibt die Entwicklung der Zeitarbeit in verschiedenen Phasen: von der anfänglichen starken Reglementierung über sukzessive Lockerungen, ein erstes Gleichstellungskonzept, weitgehende Liberalisierung bis hin zur wieder zunehmenden Reglementierung. Die gesellschaftlichen und rechtlichen Einflussfaktoren werden beleuchtet.
Wie wird das Equal Pay Prinzip in der Arbeit behandelt?
Kapitel B analysiert das Equal Pay Prinzip im Detail. Es untersucht die Vereinbarkeit von §8 I AÜG (Gesetz über Arbeitnehmerüberlassung) mit höherrangigem Recht (Tarifautonomie, Berufsfreiheit, Rechtsstaatsprinzip, Gleichheitsgrundrecht) und das Verhältnis zwischen dem Gleichstellungsgrundsatz und der Kernfunktion der Leiharbeit. Der Arbeitsentgeltbegriff des §8 I wird ebenfalls erörtert.
Welche Rolle spielen Tarifverträge bei Equal Pay?
Kapitel C befasst sich mit der Möglichkeit, durch Tarifverträge vom Equal Pay Prinzip abzuweichen. Es analysiert die Grenzen der Tarifautonomie sowohl durch "Innenschranken" (z.B. Tariffähigkeit, Tarifzuständigkeit) als auch "Außenschranken" (z.B. Mindestlohn, "Drehtür"-Klauseln). Die Durchsetzung von Equal Pay trotz tariflicher Regelungen steht im Fokus.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Zeitarbeit, Arbeitnehmerüberlassung, Equal Pay, Tarifvertrag, Tarifautonomie, Gleichbehandlung, Gleichstellung, Rechtsstaatsprinzip, §8 I AÜG, Kernfunktion der Leiharbeit, Tarifzuständigkeit, Tariffähigkeit.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die rechtlichen Rahmenbedingungen und die Entwicklung der Regulierung der Zeitarbeit im Hinblick auf Equal Pay zu analysieren und kritisch zu diskutieren.
- Quote paper
- Oleg Fedunov (Author), 2017, Durchbrechung des Equal-Pay-Grundsatzes im Recht der Arbeitnehmerüberlassung durch Abschluss von Tarifvertägen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/384484