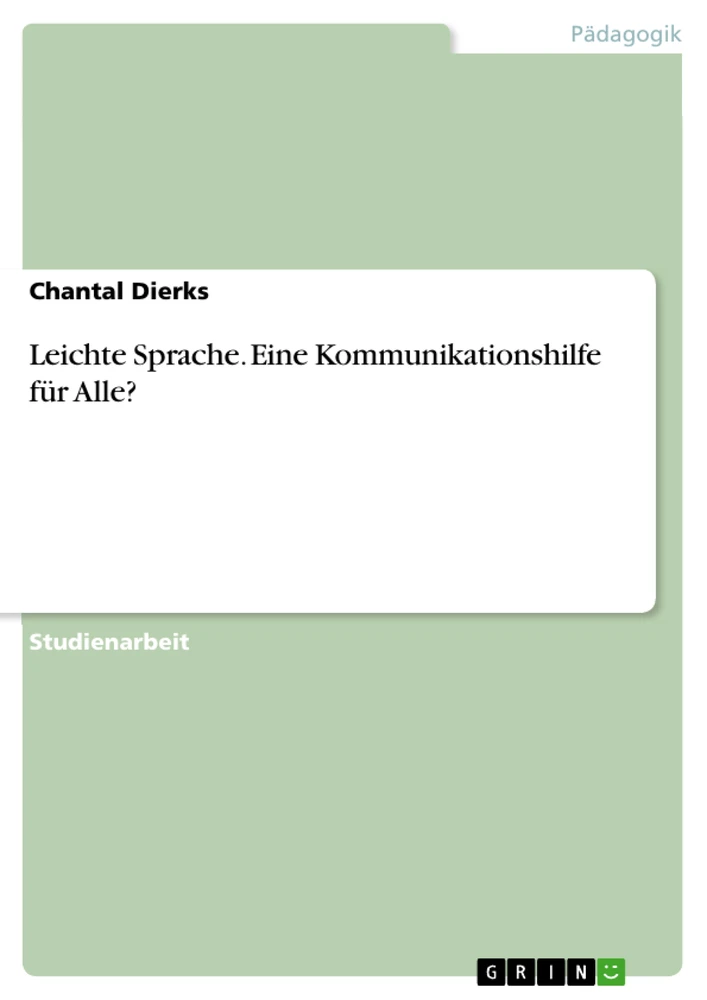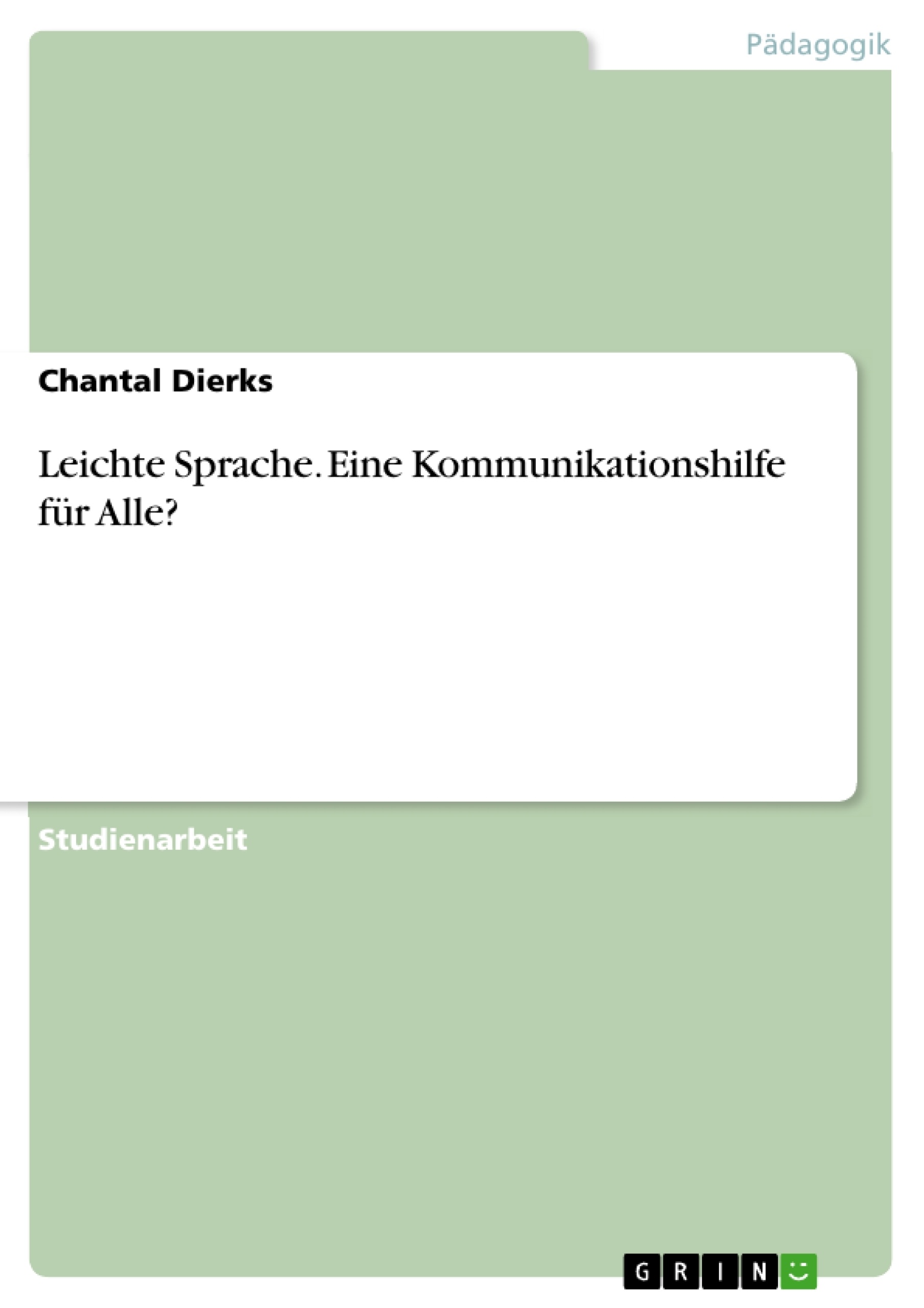Die Hausarbeit beschäftigt sich mit der Leichten Sprache und ihrer Grenzen für alle Rezipienten. Zudem bietet sie eine Anpassung für prälingual Gehörlose an.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Definition von Leichter Sprache
- 2.1 Entwicklung der Leichten Sprache
- 2.2 Regeln der Leichten Sprache
- 2.3 Zielgruppe
- 2.4 Rechtliche Grundlagen
- 3. Kritikpunkte
- 4. Modifikation von Material in Leichter Sprache
- 4.1 Prälingual Gehörlose
- 4.2 Ideen zur Anpassung von Texten in Leichter Sprache für prälingual Gehörlose
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Leichte Sprache als Kommunikationshilfe für Menschen mit Leseschwierigkeiten. Ziel ist es, die Definition, Entwicklung und Regeln der Leichten Sprache zu erläutern und kritische Punkte zu diskutieren. Zusätzlich wird die Adaption von Materialien in Leichter Sprache für prälingual Gehörlose betrachtet.
- Definition und Entwicklung der Leichten Sprache
- Regeln und Kriterien der Leichten Sprache
- Zielgruppen und deren Heterogenität
- Kritische Auseinandersetzung mit der Anwendbarkeit der Leichten Sprache
- Anpassung der Leichten Sprache für prälingual Gehörlose
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt die Herausforderungen der Kommunikation in einer heterogenen Gesellschaft, in der Standardsprache nicht von allen gleichermaßen verstanden wird. Sie hebt die Leichte Sprache als Hilfsmittel zur Teilhabe hervor und benennt die diversen Zielgruppen, die von ihr profitieren sollen, darunter Menschen mit Lernschwierigkeiten, geistigen Behinderungen, Demenz, prälingual Gehörlose und Migranten. Die Einleitung wirft die Frage auf, ob die Leichte Sprache tatsächlich eine einheitliche Lösung für solch eine heterogene Gruppe bieten kann.
2. Definition von Leichter Sprache: Dieses Kapitel definiert die Leichte Sprache als eine verständliche Varietät der deutschen Sprache, die hauptsächlich schriftlich verwendet wird. Es beleuchtet den ungeschützten Status des Begriffs und die daraus resultierenden unterschiedlichen, aber ähnlichen Regelwerke. Die Arbeit hebt das Ziel der Leichten Sprache hervor: die Teilhabe von Menschen mit Leseschwierigkeiten an Gesellschaft und Politik zu ermöglichen. Der Unterschied zur Einfachen Sprache wird erklärt, wobei die Leichte Sprache durch den Gebrauch von Satzellipsen und die Trennung von zusammengesetzten Wörtern gekennzeichnet ist, im Gegensatz zur komplexeren Struktur der Einfachen Sprache.
2.1 Entwicklung der Leichten Sprache: Die Entwicklung der Leichten Sprache wird hier nachgezeichnet, wobei die Schwierigkeit, einen einzelnen Erfinder zu benennen, hervorgehoben wird. Verschiedene Ursprünge in Finnland, anderen europäischen Ländern und den USA (People First) werden genannt. Der Fokus liegt auf der Rolle der Selbstvertreter_innen, die die Leichte Sprache zur Durchsetzung ihrer Rechte einsetzten. Die Entwicklung wird anhand wichtiger Meilensteine, wie der Entstehung erster Zeitungen in Einfacher Sprache und der Gründung von Netzwerken und Vereinen, dargestellt, die sich der Verbreitung und Weiterentwicklung der Leichten Sprache widmeten. Die Bedeutung des „Netzwerk Leichte Sprache“ und der „Hildesheimer Forschungsstelle Leichte Sprache“ wird besonders betont.
2.2 Regeln der Leichten Sprache: Dieses Kapitel beschreibt detailliert die Regeln der Leichten Sprache, basierend auf dem Regelwerk des „Netzwerk Leichte Sprache“. Die sechs Punkte des Regelwerks werden erläutert, einschließlich der Verwendung einfacher und präziser Wörter, der Vermeidung von Fach- und Fremdwörtern, der Erklärung schwieriger Wörter, der konsequenten Verwendung derselben Begriffe und der Trennung von langen Wörtern. Weitere Regeln betreffen den Umgang mit Zahlen, die Vermeidung von Abkürzungen, die Verwendung von aktiven Verben und die Vermeidung von Negationen, Redewendungen und bildlicher Sprache. Beispiele aus dem Regelwerk veranschaulichen die einzelnen Punkte.
3. Kritikpunkte: (Kapitelzusammenfassung fehlt aufgrund der fehlenden Informationen im Text)
4. Modifikation von Material in Leichter Sprache: Dieses Kapitel befasst sich mit der Anpassung von Materialien in Leichter Sprache für prälingual Gehörlose. Es analysiert die spezifischen Herausforderungen, die sich aus den unterschiedlichen Kommunikationsweisen und kognitiven Prozessen ergeben. Im Fokus stehen Ideen, wie Texte in Leichter Sprache so angepasst werden können, dass sie für diese Zielgruppe verständlich und zugänglich sind.
Schlüsselwörter
Leichte Sprache, Inklusion, Kommunikation, Leseschwierigkeiten, Heterogenität, Zielgruppe, Regelwerk, Prälingual Gehörlose, Barrierefreiheit, Teilhabe.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Leichte Sprache und ihre Anpassung für prälingual Gehörlose
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit befasst sich umfassend mit dem Thema Leichte Sprache. Sie definiert Leichte Sprache, beschreibt ihre Entwicklung und Regeln, beleuchtet kritische Punkte und analysiert vor allem die Anpassung von Materialien in Leichten Sprache für prälingual Gehörlose. Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, eine Definition von Leichter Sprache mit Unterkapiteln zur Entwicklung, Regeln, Zielgruppe und rechtlichen Grundlagen, ein Kapitel zu Kritikpunkten, ein Kapitel zur Modifikation für prälingual Gehörlose und ein Fazit. Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter erleichtern den Überblick.
Was ist Leichte Sprache und wie hat sie sich entwickelt?
Leichte Sprache ist eine verständliche Varietät der deutschen Sprache, hauptsächlich schriftlich verwendet, die Menschen mit Leseschwierigkeiten den Zugang zu Informationen ermöglichen soll. Ihre Entwicklung ist vielschichtig und lässt sich nicht auf einen einzelnen Ursprung zurückführen. Sie hat sich aus verschiedenen Initiativen in Finnland, anderen europäischen Ländern und den USA (People First) entwickelt, wobei Selbstvertreter_innen eine wichtige Rolle spielten. Wichtige Meilensteine waren die Entstehung erster Zeitungen in Einfacher Sprache und die Gründung von Netzwerken wie dem „Netzwerk Leichte Sprache“ und der „Hildesheimer Forschungsstelle Leichte Sprache“.
Welche Regeln gelten für Leichte Sprache?
Die Regeln der Leichten Sprache basieren auf dem Regelwerk des „Netzwerk Leichte Sprache“. Sie beinhalten die Verwendung einfacher und präziser Wörter, die Vermeidung von Fach- und Fremdwörtern, die Erklärung schwieriger Wörter, die konsequente Verwendung derselben Begriffe, die Trennung langer Wörter, einen klaren Umgang mit Zahlen, die Vermeidung von Abkürzungen, aktiven Verben und die Vermeidung von Negationen, Redewendungen und bildlicher Sprache.
Wer ist die Zielgruppe der Leichten Sprache?
Die Zielgruppe der Leichten Sprache ist heterogen und umfasst Menschen mit Lernschwierigkeiten, geistigen Behinderungen, Demenz, prälingual Gehörlose und Migranten. Die Arbeit stellt die Frage in den Vordergrund, ob die Leichte Sprache für diese so unterschiedlichen Gruppen eine einheitliche Lösung bieten kann.
Wie wird Leichte Sprache für prälingual Gehörlose angepasst?
Dieses Kapitel analysiert die Herausforderungen der Anpassung von Materialien in Leichter Sprache für prälingual Gehörlose, die sich aus unterschiedlichen Kommunikationsweisen und kognitiven Prozessen ergeben. Es konzentriert sich auf Ideen, wie Texte in Leichter Sprache für diese Zielgruppe verständlicher und zugänglicher gestaltet werden können.
Welche Kritikpunkte werden an der Leichten Sprache geäußert?
Die Arbeit erwähnt Kritikpunkte an der Leichten Sprache, jedoch fehlen im vorliegenden Text die dazugehörigen Ausführungen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter, die die Arbeit prägnant beschreiben sind: Leichte Sprache, Inklusion, Kommunikation, Leseschwierigkeiten, Heterogenität, Zielgruppe, Regelwerk, Prälingual Gehörlose, Barrierefreiheit, Teilhabe.
- Arbeit zitieren
- Chantal Dierks (Autor:in), 2017, Leichte Sprache. Eine Kommunikationshilfe für Alle?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/384473