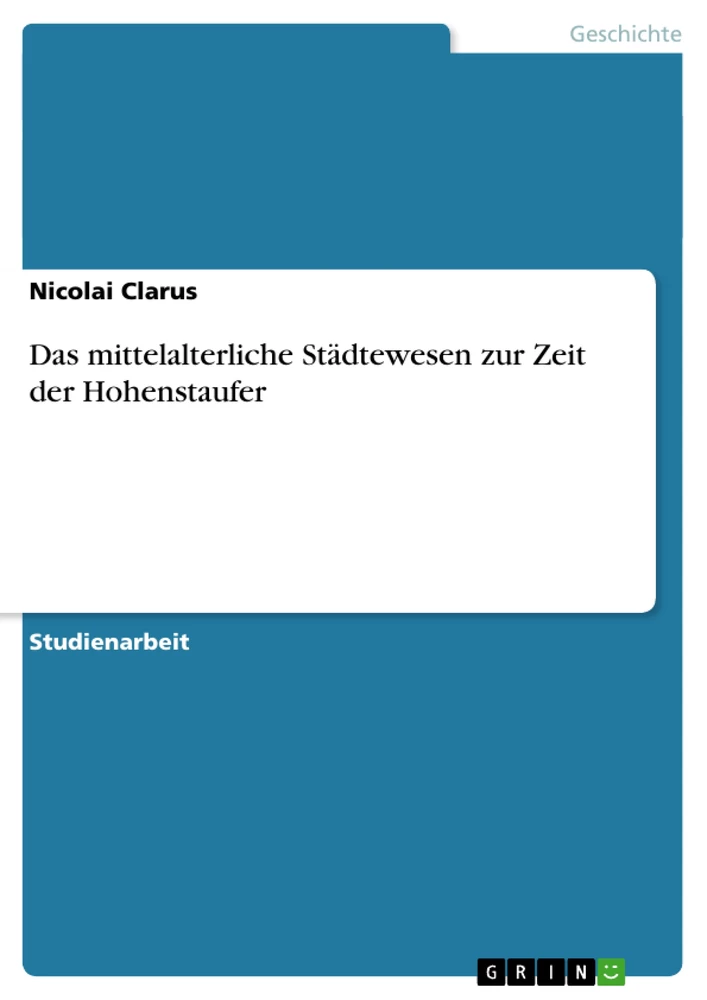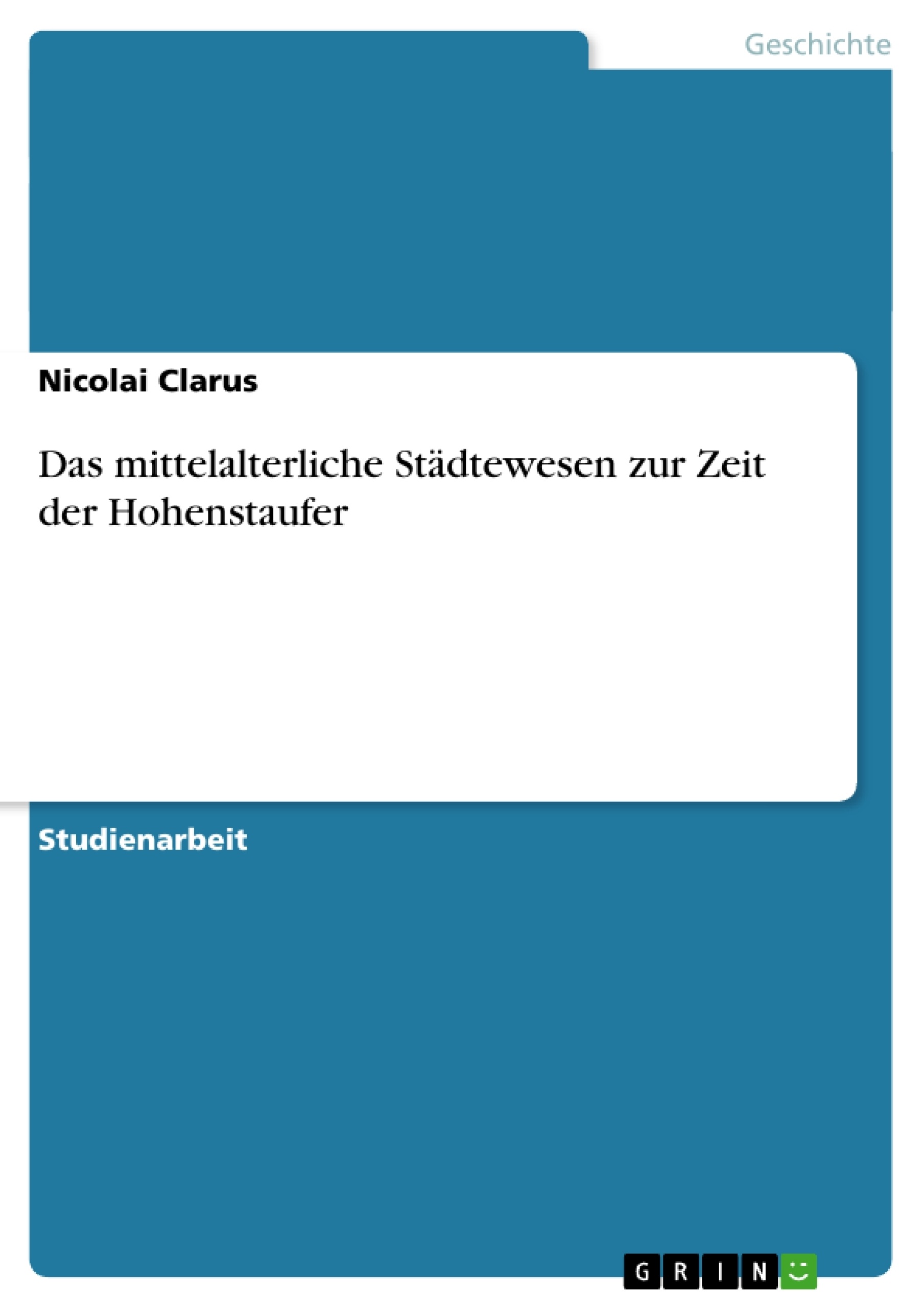Es gibt wohl nur wenige Forschungsbereiche, die sich ihrer Erschließung so sehr zu erwehren vermögen, wie das Thema der Stadt im Mittelalter. Die praktischen Gründe hierfür sind naheliegend: Städte sind dynamische Zentren pulsierenden Lebens, sie überdauern die Jahrhunderte nicht in statischen Zuständen gleich bleibender Größe, Form und Bebauung. Nur in den wenigsten europäischen Städten wird man heute noch Reste der wirklich mittelalterlichen Bebauung vorfinden können. Gebäude verfielen, wurden abgerissen oder renoviert, fielen Bränden und Bombardements zum Opfer. Die Fundamente dieser Gebäude wurden im Laufe der Zeit immer wieder überbaut, so dass zum heutigen Zeitpunkt in den meisten Fällen nichts mehr an das mittelalterliche Stadtbild erinnert.1 Ausgenommen von diesem Prozess sind häufig lediglich die städtischen Sakralbauten, die, obwohl auch sie im Laufe der Jahrhunderte äußerliche und innerliche Veränderungen erfahren haben, zumindest noch im Kern Bauelemente des Mittelalters enthalten und noch immer an derselben Stelle stehen, wie zum Zeitpunkt ihrer Errichtung. Dieser zweite Gesichtspunkt ist es, der für die Erforschung der mittelalterlichen Stadt häufig von unschätzbarem Wert ist, da Kirchenbauten schon im Mittelalter als Repräsentationsbauten einzelner Stadtviertel galten und als solche zumeist im Zentrum der Bebauung situiert waren. Dem Erforscher der mittelalterlichen Stadtstrukturen, sei er nun Archäologe, Bauforscher oder Kunsthistoriker, wird somit zumindest ein erster Ansatzpunkt geliefert. 1 KRUML, Milos: Die mittelalterliche Stadt als Gesamtkunstwerk und Denkmal, Wien: VWGÖ 1992 (Dissertationen der technischen Universität Wien, 51), S. 79; MECKSEPER, Cord: Kleine Kunstgeschichte der deutschen Stadt im Mittelalter, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1982, S. 105.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kontroversen um die mittelalterliche Stadt
- Forschungsansätze
- Fragestellung
- Das mittelalterliche Welt- und Stadtbild
- Stadtgründungen im „staufischen Jahrhundert“
- Elemente der mittelalterlichen Stadt
- Die Stadtgründung in der Praxis
- Städtische Wohnbauten
- Öffentliche Bauten
- Aufstieg und Niedergang mittelalterlicher Städte
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die mittelalterliche Stadt, insbesondere im Kontext des „staufischen Jahrhunderts“, und hinterfragt die verschiedenen methodischen Ansätze ihrer Erforschung. Ziel ist es, herauszufinden, ob sich in der Betrachtung der staufischen Städte eine Programmatik erkennen lässt und ob diese Städte neben ihrer wirtschaftlichen und sozialen Funktion auch als Kunstwerke und Denkmäler des politischen Programms der Herrscher verstanden werden können.
- Methodische Ansätze zur Erforschung mittelalterlicher Städte
- Das mittelalterliche Weltbild und seine Auswirkung auf den Städtebau
- Stadtgründungen im staufischen Jahrhundert und ihre Hintergründe
- Die staufische Stadt als Kunstwerk und politisches Programm
- Wirtschaftliche und soziale Aspekte staufischer Städte
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung erläutert die Herausforderungen der Erforschung mittelalterlicher Städte aufgrund des dynamischen Charakters städtischen Lebens und des Verlusts mittelalterlicher Bebauung. Sie hebt die Bedeutung städtischer Sakralbauten als Forschungsgegenstand hervor und führt in die methodischen Kontroversen der Stadtforschung ein.
Kontroversen um die mittelalterliche Stadt: Dieses Kapitel diskutiert unterschiedliche Forschungsansätze zur mittelalterlichen Stadt, darunter den topographischen, ökonomischen, sozialwissenschaftlichen und historischen Ansatz. Es wird die kontroverse Rolle der kunstgeschichtlichen Betrachtungsweise beleuchtet und die Schwierigkeit, eine einheitliche Definition des Begriffs „mittelalterliche Stadt“ zu finden, hervorgehoben. Die Kapitelfrage, ob in der Betrachtung der staufischen Städte eine Programmatik erkennbar ist, wird eingeführt.
Das mittelalterliche Welt- und Stadtbild: Dieses Kapitel beschreibt das hierarchisch strukturierte Weltbild des Mittelalters und den Gegensatz zwischen der „civitas terrana“ und der „civitas dei“. Es wird gezeigt, wie dieses Weltbild die städtebauliche Gestaltung beeinflusste und das Idealbild einer symmetrischen, von Gott gewollten Ordnung hervorbrachte. Die Stadt wurde als Abbild der „civitas dei“ verstanden, im Gegensatz zur sündigen Stadt Babylon.
Stadtgründungen im „staufischen Jahrhundert“: Dieses Kapitel beleuchtet die Welle von Stadtgründungen im „staufischen Jahrhundert“, wobei zwischen Stadtgründung im eigentlichen Sinne und Stadtrechtsverleihung unterschieden wird. Es werden die ökonomischen Gründe (Übergang zur Geldwirtschaft) und die politischen Gründe (territoriale Erwerbspolitik der Staufer) für diese Entwicklung erörtert. Die Anlage von Städten als strategische Festungen zur Sicherung und Erschließung neuer Gebiete wird hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Mittelalterliche Stadt, Stauferzeit, Stadtgründung, Stadtrechtsverleihung, Stadtforschung, Forschungsansätze, Weltbild, ökonomische Entwicklung, politische Programmatik, Kunstgeschichte, Bevölkerungsstruktur, Städtebau.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Text: Mittelalterliche Städte im Stauferzeitalter
Was ist der Gegenstand dieses Textes?
Der Text befasst sich umfassend mit der mittelalterlichen Stadt, insbesondere im Kontext des „staufischen Jahrhunderts“. Er analysiert verschiedene methodische Ansätze zur Erforschung mittelalterlicher Städte und untersucht, ob in der Betrachtung der staufischen Städte eine politische Programmatik erkennbar ist und ob diese Städte neben ihrer wirtschaftlichen und sozialen Funktion auch als Kunstwerke und Denkmäler des politischen Programms der Herrscher verstanden werden können.
Welche Kapitel umfasst der Text?
Der Text beinhaltet eine Einleitung, ein Kapitel zu den Kontroversen um die Erforschung mittelalterlicher Städte, ein Kapitel zum mittelalterlichen Welt- und Stadtbild, ein Kapitel zu Stadtgründungen im „staufischen Jahrhundert“, sowie Kapitel zu Elementen mittelalterlicher Städte, zur Stadtgründung in der Praxis, städtischen Wohnbauten, öffentlichen Bauten, dem Aufstieg und Niedergang mittelalterlicher Städte und ein Fazit.
Welche Forschungsansätze werden diskutiert?
Der Text diskutiert verschiedene methodische Ansätze zur Erforschung mittelalterlicher Städte, darunter den topographischen, ökonomischen, sozialwissenschaftlichen und historischen Ansatz. Besondere Aufmerksamkeit wird der kontroversen Rolle der kunstgeschichtlichen Betrachtungsweise gewidmet.
Wie wird das mittelalterliche Weltbild dargestellt?
Der Text beschreibt das hierarchisch strukturierte Weltbild des Mittelalters und den Gegensatz zwischen der „civitas terrana“ und der „civitas dei“. Es wird gezeigt, wie dieses Weltbild die städtebauliche Gestaltung beeinflusste und das Idealbild einer symmetrischen, von Gott gewollten Ordnung hervorbrachte. Die Stadt wurde als Abbild der „civitas dei“ verstanden.
Welche Gründe werden für die Stadtgründungen im „staufischen Jahrhundert“ genannt?
Der Text nennt ökonomische Gründe (Übergang zur Geldwirtschaft) und politische Gründe (territoriale Erwerbspolitik der Staufer) für die zahlreichen Stadtgründungen im „staufischen Jahrhundert“. Die Anlage von Städten als strategische Festungen zur Sicherung und Erschließung neuer Gebiete wird hervorgehoben. Der Unterschied zwischen Stadtgründung und Stadtrechtsverleihung wird ebenfalls erläutert.
Welche Aspekte staufischer Städte werden behandelt?
Der Text behandelt wirtschaftliche und soziale Aspekte staufischer Städte, ihre städtebauliche Gestaltung, öffentliche und private Bauten und den Aufstieg und Niedergang dieser Städte. Ein besonderer Fokus liegt auf der Frage, ob die staufischen Städte als Kunstwerke und politische Programme der Herrscher verstanden werden können.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Text?
Schlüsselwörter sind: Mittelalterliche Stadt, Stauferzeit, Stadtgründung, Stadtrechtsverleihung, Stadtforschung, Forschungsansätze, Weltbild, ökonomische Entwicklung, politische Programmatik, Kunstgeschichte, Bevölkerungsstruktur, Städtebau.
Welche Zielsetzung verfolgt der Text?
Ziel des Textes ist es, herauszufinden, ob sich in der Betrachtung der staufischen Städte eine Programmatik erkennen lässt und ob diese Städte neben ihrer wirtschaftlichen und sozialen Funktion auch als Kunstwerke und Denkmäler des politischen Programms der Herrscher verstanden werden können. Der Text untersucht die mittelalterliche Stadt und hinterfragt die verschiedenen methodischen Ansätze ihrer Erforschung.
- Quote paper
- Nicolai Clarus (Author), 2004, Das mittelalterliche Städtewesen zur Zeit der Hohenstaufer, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/38426