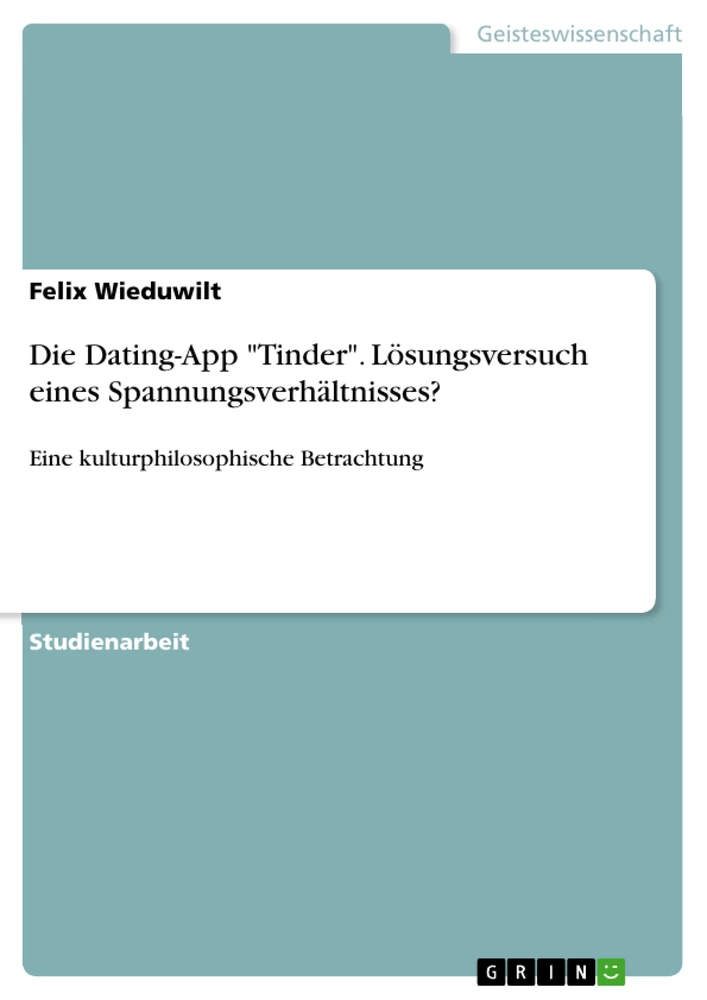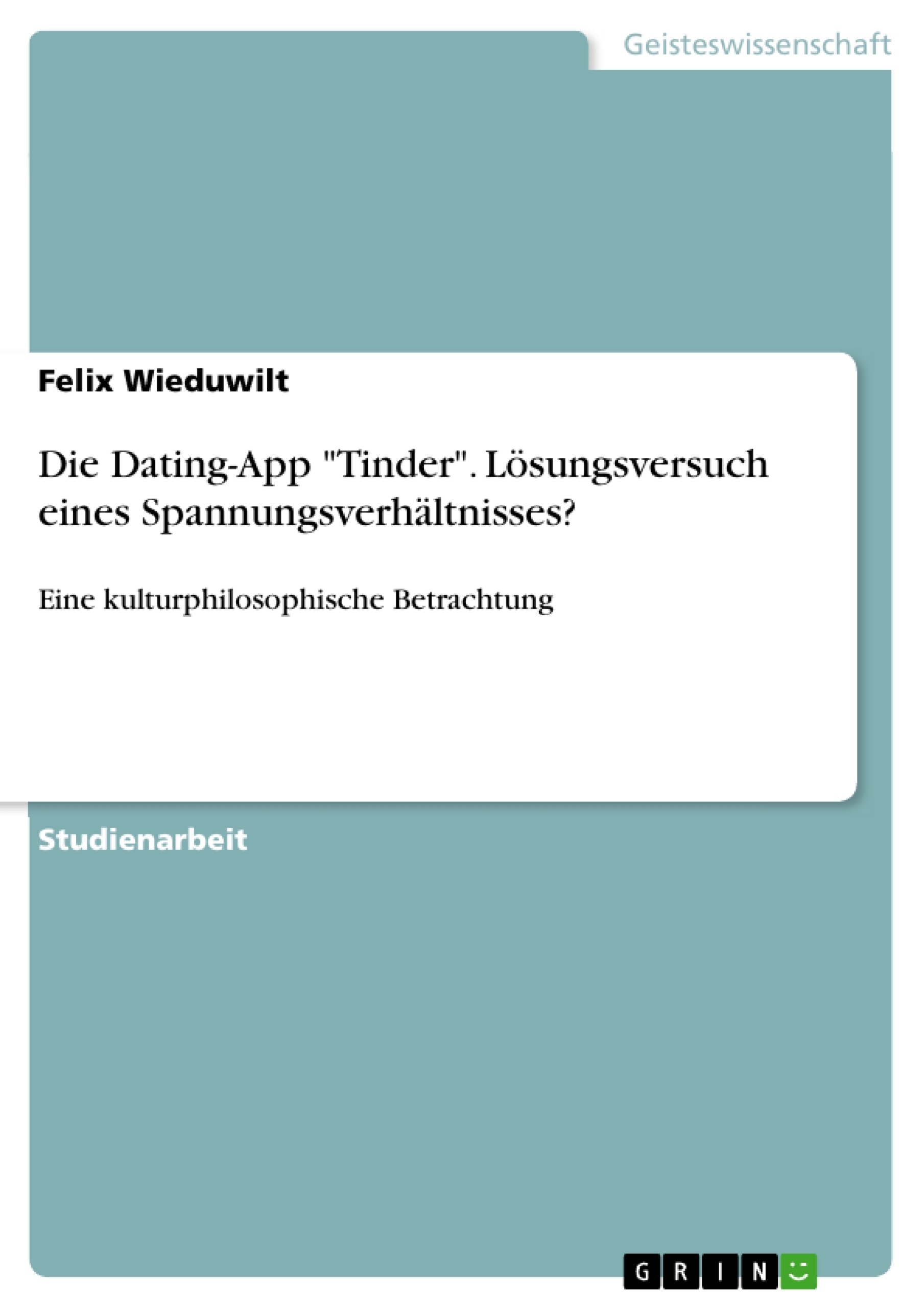Gucken wir uns die globale Gesellschaft an, so fällt ein Fakt besonders auf: es besteht eine konstante Spannung zwischen dem Tabu-Thema Sex und dessen Fetischisierung als Ware. Im Alltag werden wir regelrecht mit der Versuchung nach Sex und Erotik bombardiert, was besonders beim realitätsfernen Bild der Frau sichtbar wird, da sie oft und vielseitig mit üppigen Rundungen und viel Haut auf diversen Medien erscheint. Gleichsam wird jedoch das Thema Sex und Erotik nur zaghaft bis gar nicht nach außen getragen. Das wohl prominenteste Bespiel dieser Ambivalenz ist die Werbung. Es wird zwar mit Sexualität und viel Haut geworben, jedoch gibt es eine Art Aufsicht, die allzu sexistisches Auftreten in der Werbung rügt und abmahnt. Es herrscht ein öffentliches Tabu, welches Sex verbannt - wir müssen selber damit umgehen. Diese Gegenüberstellung ist offensichtlich ein Widerspruch mit sich selbst. Auf der einen Seite werden wir aufgefordert, uns dem hinzugeben und auf der anderen Seite sollen wir darüber nicht reden. Wie können wir mit diesem Spannungsverhältnis als Individuum nun umgehen? Es muss ein Lösungsversuch her. Untersuchungsgegenstand dieses Gedankenspiels soll die App Tinder sein, die sich weltweit großer Beliebtheit erfreut, obwohl ihr Funktionsumfang äußerst begrenzt ist.
Diese Untersuchung soll der Frage nachgehen: Ist Tinder ein Regulator, um die Zerrissenheit zwischen Es, Außenwelt und Über-Ich in der aktuellen globalen Kultur zu balancieren? Tinder soll hier stellvertretend als Beispiel für andere Plattformen und Webseiten angesehen werden, da es augenscheinlich nur einen minimalen Nenner der Dating und Porno-Industrie anbietet, aber gleichsam in vollem Umfang Bedürfnisse befriedigt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Beschreibung von Tinder
- 3. Die globale Kultur
- 4. Triebe und das Ich in der Kultur
- 4.1 Die Ausprägungen des Ichs
- 4.2 Triebe innerhalb der Kultur
- 5. Tinder als Lösungsversuch
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Dating-App Tinder im Kontext der globalen Kultur und der psychoanalytischen Theorien Freuds. Ziel ist es, die Frage zu beantworten, ob Tinder als Regulator des Spannungsverhältnisses zwischen individuellen Trieben, der Außenwelt und dem Über-Ich in der heutigen Gesellschaft fungiert.
- Das Spannungsverhältnis zwischen dem Tabu Sex und seiner Kommerzialisierung in der globalen Kultur.
- Die Funktionsweise und Einordnung von Tinder als Dating-Plattform.
- Die Rolle von Freuds Theorien zu Trieben und Ich-Entwicklung im Verständnis des Tinder-Phänomens.
- Tinder als möglicher Lösungsversuch zur Bewältigung von gesellschaftlichen Konflikten bezüglich Sexualität.
- Die Bedeutung von Bestätigung und Anerkennung in sozialen Medien im Kontext von Tinder.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Spannungsverhältnis zwischen dem gesellschaftlichen Tabu um Sexualität und seiner allgegenwärtigen Kommerzialisierung ein. Sie stellt die Frage, wie Individuen mit diesem Widerspruch umgehen und nennt Tinder als Untersuchungsgegenstand, um zu erforschen, ob die App als ein Mechanismus zur Regulierung dieses Spannungsfeldes dienen kann. Der begrenzte Funktionsumfang von Tinder wird hervorgehoben, und die Arbeit kündigt die bevorstehende Analyse von Tinder im Kontext der globalen Kultur und Freuds psychoanalytischen Theorien an.
2. Beschreibung von Tinder: Dieses Kapitel beschreibt detailliert die Funktionsweise von Tinder. Es beleuchtet die Anmeldung über Facebook, die Auswahl des Geschlechts der gewünschten Partner, die Profilgestaltung mit Bildern und Texten und das "Matching"-System, das auf der Grundlage von Facebook-Interessen funktioniert. Der Vergleich mit einem Katalog, bei dem Nutzer sich Partner regelrecht "aussuchen", wird gezogen. Die potentielle sexuelle Komponente der App und die Bestätigung des Selbstwertgefühls durch Matches werden als wichtige Aspekte hervorgehoben, ebenso wie die Vernachlässigung von Persönlichkeitseigenschaften zugunsten des optischen Eindrucks.
3. Die globale Kultur nach Redner: Dieses Kapitel beschreibt den Einfluss der digitalen Technologisierung auf die globale Kultur, basierend auf Redners Theorie der drei Säulen: Technik, Ethos und Repräsentation. Es erläutert die Bedeutung von Repräsentationen in lokalen und globalen Kulturen und zeigt, wie Objekte und Personen bestimmte Bedeutungen verkörpern können. Die Zerstörung religiöser Symbole wird als Beispiel für die Manipulation von Repräsentationen genannt.
Schlüsselwörter
Tinder, globale Kultur, Sexualität, Freud, Ich, Es, Über-Ich, Triebe, Dating-Apps, soziale Medien, Bestätigung, Anerkennung, Kommerzialisierung, Repräsentation.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Tinder im Kontext der globalen Kultur und der psychoanalytischen Theorien Freuds
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Dating-App Tinder im Kontext der globalen Kultur und der psychoanalytischen Theorien Sigmund Freuds. Der Fokus liegt auf der Frage, ob Tinder als Regulator des Spannungsverhältnisses zwischen individuellen Trieben, der Außenwelt und dem Über-Ich in der heutigen Gesellschaft fungiert.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt das Spannungsverhältnis zwischen dem Tabu Sex und seiner Kommerzialisierung, die Funktionsweise von Tinder als Dating-Plattform, die Rolle von Freuds Triebbegriffen und der Ich-Entwicklung im Verständnis des Tinder-Phänomens, Tinder als möglichen Lösungsversuch gesellschaftlicher Konflikte bezüglich Sexualität und die Bedeutung von Bestätigung und Anerkennung in sozialen Medien im Kontext von Tinder. Die Theorie der globalen Kultur nach Redner wird ebenfalls einbezogen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit umfasst eine Einleitung, eine Beschreibung von Tinder, ein Kapitel zur globalen Kultur nach Redner, ein Kapitel zu Trieben und dem Ich in der Kultur (mit Unterkapiteln zu den Ausprägungen des Ichs und Trieben innerhalb der Kultur) und ein Kapitel, das Tinder als Lösungsversuch betrachtet. Jedes Kapitel wird zusammengefasst.
Was wird in der Einleitung beschrieben?
Die Einleitung stellt das Spannungsfeld zwischen dem gesellschaftlichen Tabu der Sexualität und ihrer Kommerzialisierung dar. Sie präsentiert Tinder als Untersuchungsgegenstand und kündigt die Analyse der App im Kontext der globalen Kultur und Freuds Theorien an.
Wie wird Tinder in der Arbeit beschrieben?
Das Kapitel zur Beschreibung von Tinder beleuchtet die Funktionsweise der App, die Anmeldung über Facebook, die Partnerauswahl, die Profilgestaltung und das Matching-System. Es wird ein Vergleich mit einem Katalog gezogen und die Bedeutung des optischen Eindrucks sowie die Aspekte der sexuellen Komponente und der Selbstwertbestätigung durch Matches hervorgehoben.
Welche Rolle spielt die globale Kultur nach Redner?
Das Kapitel zur globalen Kultur nach Redner analysiert den Einfluss der digitalen Technologisierung auf die globale Kultur anhand von Redners Theorie der drei Säulen (Technik, Ethos, Repräsentation). Es erläutert die Bedeutung von Repräsentationen und zeigt deren Manipulierbarkeit auf.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Tinder, globale Kultur, Sexualität, Freud, Ich, Es, Über-Ich, Triebe, Dating-Apps, soziale Medien, Bestätigung, Anerkennung, Kommerzialisierung, Repräsentation.
Welche konkreten Fragen werden im Laufe der Arbeit beantwortet?
Die zentrale Frage ist, ob Tinder als Regulator des Spannungsverhältnisses zwischen individuellen Trieben, der Außenwelt und dem Über-Ich dient. Zusätzlich werden Fragen zur Funktionsweise von Tinder, zur Rolle von Freuds Theorien und zur Bedeutung von Bestätigung und Anerkennung in diesem Kontext behandelt.
- Arbeit zitieren
- Felix Wieduwilt (Autor:in), 2014, Die Dating-App "Tinder". Lösungsversuch eines Spannungsverhältnisses?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/384210