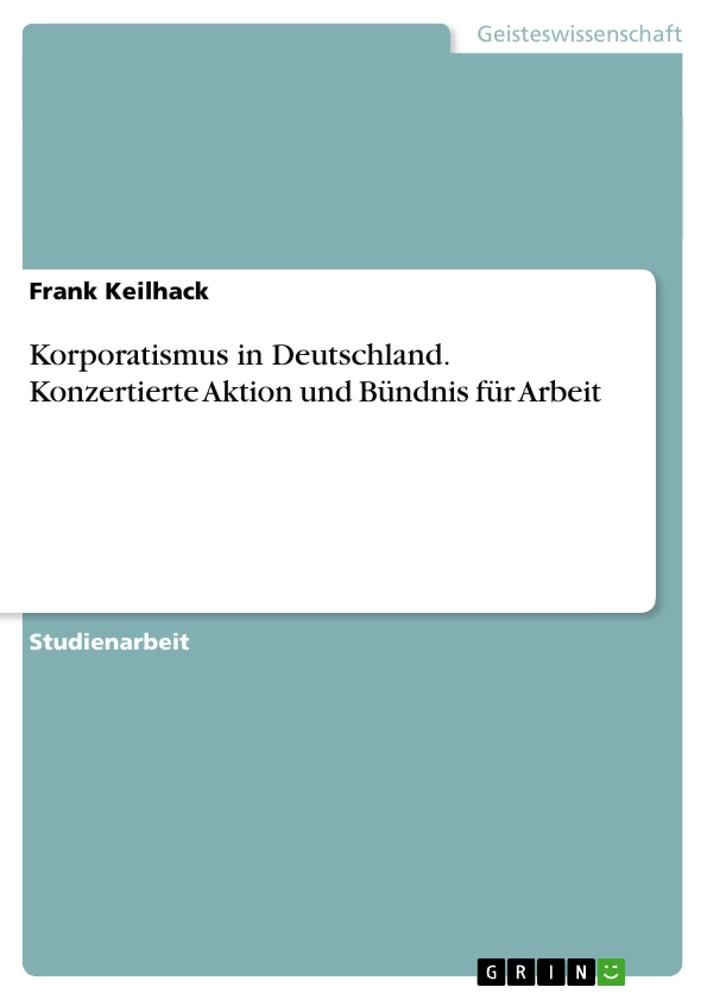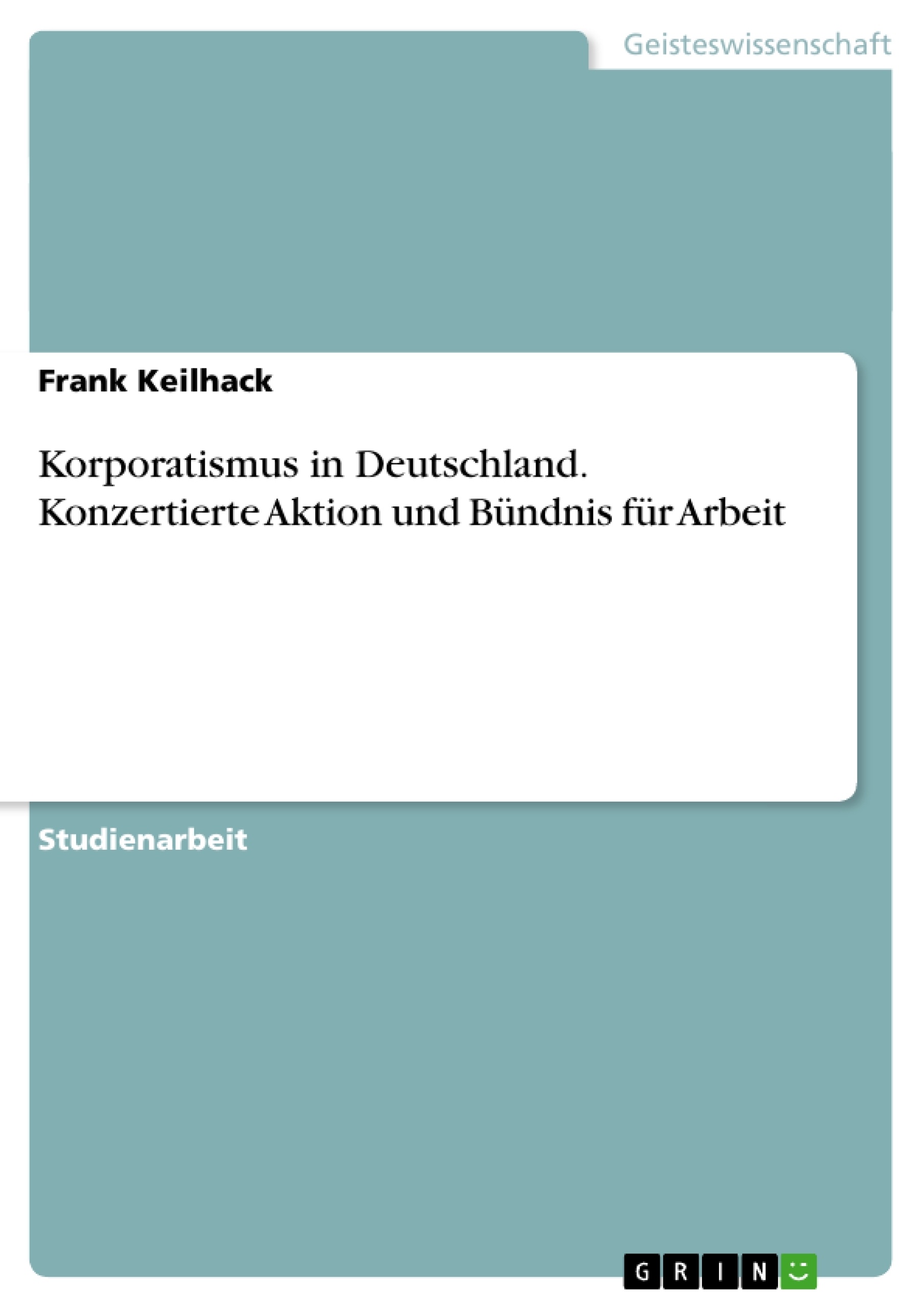Nach der ersten Rezession der bundesdeutschen Geschichte Mitte der 1960er wurde zu deren Überwindung unter anderem die Konzertierte Aktion eingerichtet, ein überwiegend wirtschaftspolitisches Bündnis zwischen Regierung und Verbänden, hier vor allem der Tarifparteien. Eine ähnliche Arena wurde – allerdings unter ganz anderen Umständen als in den 1960ern – auch 1998 mit dem Bündnis für Arbeit eingerichtet. Beide Runden sind Ausdruck von dreiseitigem Korporatismus beziehungsweise dreiseitiger Konzertierung auf der so genannten Makroebene. In dieser Arbeit sollen die beiden tripartistischen Makrokonzertierungen als Beispiele des deutschen Korporatismus beleuchtet werden. Dabei wird es um die Gründe ihres Entstehens, die Teilnehmer und deren Beteiligungshintergrund, die Organisation der Bündnisse, deren Verlauf und Bewertung gehen. Das geschieht vor dem Hintergrund der Entwicklung des Korporatismus in Deutschland und den sich verändernden Rahmenbedingungen – beide Themen werden in der Vorbetrachtung beleuchtet. Ziel ist es, die Konzertierte Aktion und das Bündnis für Arbeit am Ende zusammenfassend gegenüberzustellen und eine Bestandsaufnahme vorzunehmen, die zeigen soll, wie es um den Korporatismus – speziell den auf der Makroebene – in Deutschland im Moment und in Zukunft bestellt ist.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Vorbetrachtungen
- 2.1 Korporatismus in Deutschland
- 2.2 Das Modell Deutschland und dessen Wandel
- 3. Die Konzertierte Aktion 1967-1977
- 3.1 Das „Kind der Krise“
- 3.2 Akteure, Aufbau, Themen und Ziele
- 3.3 Verlauf der Konzertierten Aktion
- 3.4 Das Ende der Konzertierten Aktion / Bewertung
- 4. Das Bündnis für Arbeit 1998-2003
- 4.1 Der Weg von der Konzertierten Aktion zum Bündnis für Arbeit
- 4.2 Akteure, Aufbau, Themen und Ziele
- 4.3 Verlauf des Bündnisses für Arbeit
- 4.4 Das Ende des Bündnisses für Arbeit / Bewertung
- 5. Vergleich / Zusammenfassung / Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Konzertierte Aktion (1967-1977) und das Bündnis für Arbeit (1998-2003) als Beispiele für triparitischen Makrokorporatismus in Deutschland. Die Zielsetzung besteht darin, die Entstehungsgründe, beteiligten Akteure, Organisation, den Verlauf und die Bewertung beider Bündnisse zu analysieren und im Kontext der Entwicklung des deutschen Korporatismus und sich verändernder Rahmenbedingungen zu betrachten. Abschließend soll ein Vergleich beider Konzertierungen erfolgen und eine Bestandsaufnahme des Makrokorporatismus in Deutschland erstellt werden.
- Der deutsche Korporatismus und seine Entwicklung
- Die Konzertierte Aktion: Entstehung, Verlauf und Bewertung
- Das Bündnis für Arbeit: Entstehung, Verlauf und Bewertung
- Vergleich der beiden Konzertierungsmodelle
- Das „Modell Deutschland“ und seine Veränderungen als Einflussfaktor
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die Konzertierte Aktion und das Bündnis für Arbeit als Beispiele für triparitischen Makrokorporatismus in Deutschland vor. Sie beschreibt die Zielsetzung der Arbeit, welche darin besteht, beide Bündnisse hinsichtlich ihrer Entstehungsgründe, beteiligten Akteure, Organisation, Verlauf und Bewertung zu analysieren und im Kontext der Entwicklung des deutschen Korporatismus zu betrachten. Der Fokus liegt auf einem abschließenden Vergleich und einer Bestandsaufnahme des Makrokorporatismus in Deutschland.
2. Vorbetrachtungen: Dieses Kapitel beleuchtet zunächst den Begriff Korporatismus im deutschen Kontext, differenziert zwischen verschiedenen Ebenen (Makro-, Meso- und Mikroebene) und diskutiert die Einordnung Deutschlands als korporatistisches Land. Es wird die Rolle der Sozialdemokratie beim Ausbau von Korporatismus auf verschiedenen Ebenen hervorgehoben und die besonderen Charakteristika des deutschen Korporatismus im Vergleich zu anderen Ländern erörtert. Anschließend wird das „Modell Deutschland“ mit seinen spezifischen Rahmenbedingungen (politisches System, Föderalismus, Exportorientierung) vorgestellt, die als Einflussfaktoren für die beiden betrachteten Konzertierungen gelten.
3. Die Konzertierte Aktion 1967-1977: Dieses Kapitel behandelt die Konzertierte Aktion als Reaktion auf die Rezession Mitte der 1960er Jahre. Es analysiert die beteiligten Akteure (Regierung, Verbände, Tarifparteien), den Aufbau, die Ziele und den Verlauf der Aktion. Die Bedeutung der Konzertierten Aktion als wirtschaftspolitisches Instrument zur Bewältigung der Krise und die Gründe für ihr Ende werden eingehend diskutiert. Die Kapitel beschreiben die jeweiligen Strategien, die Erfolge, sowie die Kritikpunkte und die letztendliche Auflösung des Systems.
4. Das Bündnis für Arbeit 1998-2003: Dieses Kapitel widmet sich dem Bündnis für Arbeit, das unter deutlich anderen Umständen als die Konzertierte Aktion entstand. Der Weg von der Konzertierten Aktion zum Bündnis für Arbeit wird nachvollzogen, und die spezifischen Akteure, der Aufbau, die Ziele und der Verlauf werden analysiert. Die Kapitel untersuchen den Kontext der Entstehung, die Erfolge sowie die Schwierigkeiten und den Grund für dessen Beendigung. Ein besonderer Fokus liegt auf den Veränderungen im „Modell Deutschland“ und deren Einfluss auf das Bündnis für Arbeit.
Schlüsselwörter
Korporatismus, Konzertierte Aktion, Bündnis für Arbeit, triparitischer Makrokorporatismus, Modell Deutschland, Sozialpartnerschaft, Wirtschaftspolitik, Tarifparteien, Gewerkschaften, Globalisierung, Strukturwandel, Verhandlungsdemokratie, Föderalismus.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Analyse der Konzertierten Aktion und des Bündnisses für Arbeit
Was ist der Gegenstand dieser Analyse?
Diese Arbeit analysiert die Konzertierte Aktion (1967-1977) und das Bündnis für Arbeit (1998-2003) als Beispiele für triparitischen Makrokorporatismus in Deutschland. Der Fokus liegt auf der Entstehung, den beteiligten Akteuren, der Organisation, dem Verlauf und der Bewertung beider Bündnisse im Kontext der Entwicklung des deutschen Korporatismus und sich verändernder Rahmenbedingungen. Ein abschließender Vergleich beider Modelle und eine Bestandsaufnahme des Makrokorporatismus in Deutschland bilden den Abschluss.
Welche Themen werden behandelt?
Die Analyse behandelt folgende Themenschwerpunkte: den deutschen Korporatismus und seine Entwicklung, die Entstehung, den Verlauf und die Bewertung der Konzertierten Aktion, die Entstehung, den Verlauf und die Bewertung des Bündnisses für Arbeit, einen Vergleich der beiden Konzertierungsmodelle und den Einfluss des „Modell Deutschland“ und seiner Veränderungen auf die beiden Bündnisse.
Welche Akteure waren an der Konzertierten Aktion und dem Bündnis für Arbeit beteiligt?
Beide Bündnisse umfassten Akteure aus Regierung, Verbänden und Tarifparteien. Die genaue Zusammensetzung und die Rollen der einzelnen Akteure werden in den jeweiligen Kapiteln der Analyse detailliert untersucht. Es wird auf die Unterschiede in der Zusammensetzung und den Rollen der Akteure in beiden Phasen eingegangen.
Wie unterscheidet sich die Konzertierte Aktion vom Bündnis für Arbeit?
Die Analyse vergleicht die beiden Bündnisse hinsichtlich ihrer Entstehungsgründe, Ziele, Organisation, Verlauf und Bewertung. Die Unterschiede werden im Kontext der jeweiligen historischen und wirtschaftlichen Bedingungen sowie der Entwicklung des „Modell Deutschland“ erklärt. Besondere Aufmerksamkeit wird den Veränderungen im deutschen Korporatismus und deren Einfluss auf die Gestaltung und den Erfolg der beiden Initiativen gewidmet.
Was ist der deutsche Korporatismus und seine Rolle in der Analyse?
Die Analyse beleuchtet den deutschen Korporatismus, differenziert zwischen verschiedenen Ebenen (Makro-, Meso- und Mikroebene) und diskutiert die Einordnung Deutschlands als korporatistisches Land. Die Rolle der Sozialdemokratie beim Ausbau von Korporatismus wird hervorgehoben, und die besonderen Charakteristika des deutschen Korporatismus im Vergleich zu anderen Ländern werden erörtert. Die Entwicklung des Korporatismus bildet den Kontext für die Analyse der Konzertierten Aktion und des Bündnisses für Arbeit.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Analyse?
Die Analyse schließt mit einem Vergleich der Konzertierten Aktion und des Bündnisses für Arbeit und einer Bestandsaufnahme des Makrokorporatismus in Deutschland. Es werden die Stärken und Schwächen beider Modelle beleuchtet und deren Relevanz für die aktuelle wirtschafts- und sozialpolitische Situation diskutiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Analyse?
Schlüsselwörter sind: Korporatismus, Konzertierte Aktion, Bündnis für Arbeit, triparitischer Makrokorporatismus, Modell Deutschland, Sozialpartnerschaft, Wirtschaftspolitik, Tarifparteien, Gewerkschaften, Globalisierung, Strukturwandel, Verhandlungsdemokratie, Föderalismus.
- Quote paper
- Frank Keilhack (Author), 2004, Korporatismus in Deutschland. Konzertierte Aktion und Bündnis für Arbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/38416