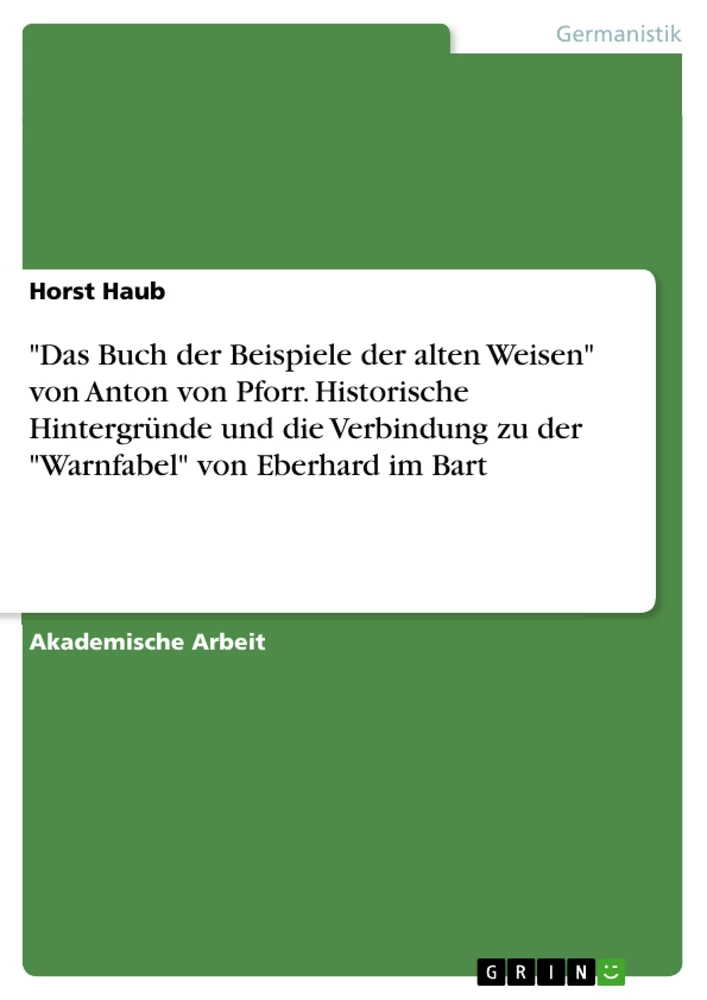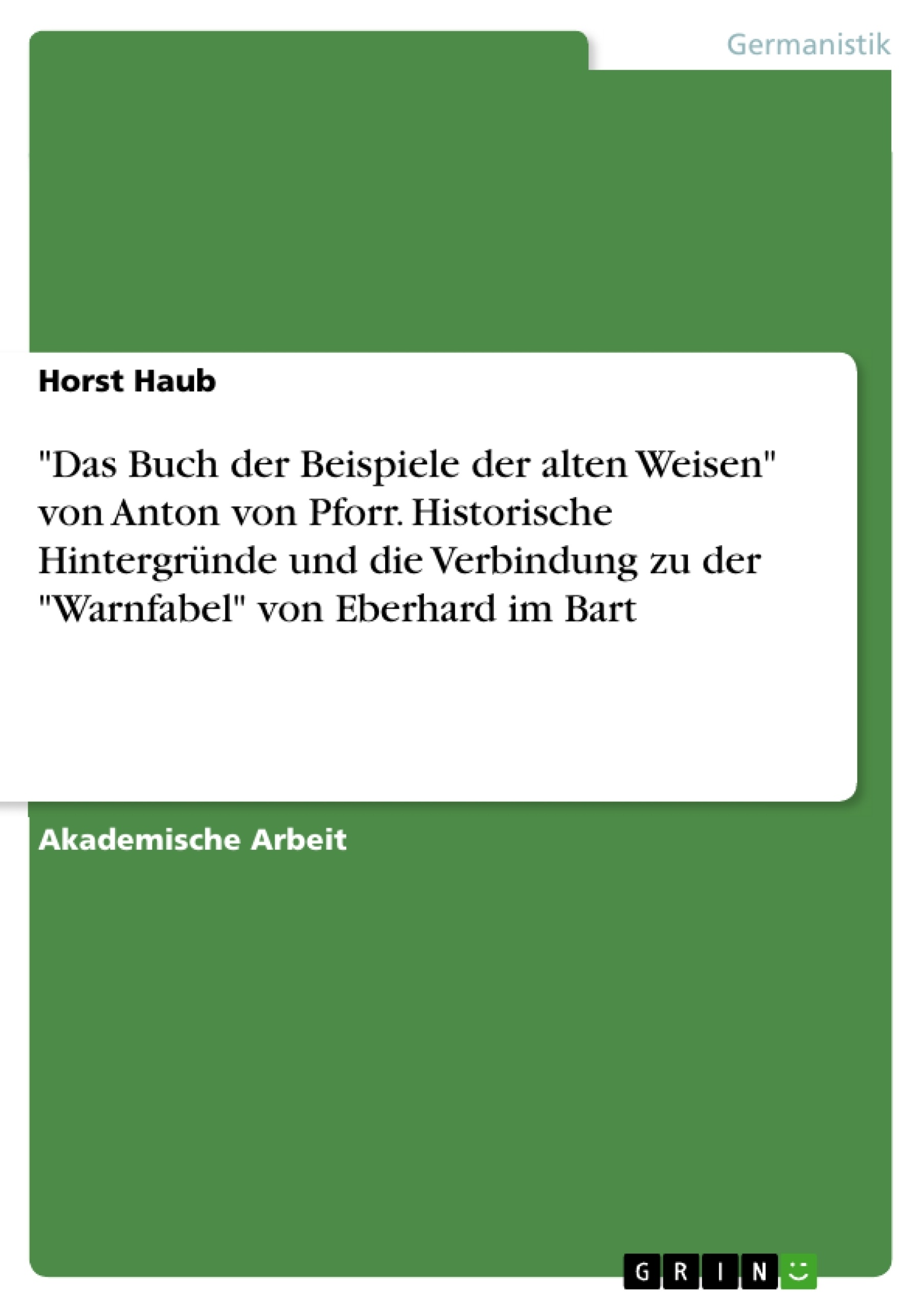Zu Beginn der 1470er Jahre wird von Anton von Pforr "Das Buch der Beispiele der alten Weisen" angefertigt. Es handelt sich dabei weitgehend um die Übersetzung des indischen Pancatantra aus den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung. Diesen Text überträgt Pforr aus einer lateinischen Vorlage ins Deutsche. Kann man davon ausgehen, dass der gelehrte Abkömmling eines Breisacher Patriziergeschlechts den Auftrag zu dieser Übersetzung von dem württembergischen Fürsten Eberhard im Bart und dessen Mutter Mechthild von Rottenburg erhielt, so stellt sich doch die Frage, wie es zu diesem lebhaften Interesse an dem indischen Fabelbuch kommen konnte. Ist dieses Interesse doch durch die Herstellung mehrerer aufwendig illuminierter Handschriften sowie zweier Drucke, zu Beginn der 1480er Jahre, ebenfalls in fürstlichem Auftrag, gut dokumentiert.
Entgegen der geäußerten Vermutung, der ursprüngliche Anlass für das Übersetzungsprojekt und die Herstellung einer mit Bildern versehenen Handschrift lasse sich nicht mehr rekonstruieren, wird hier versucht eben diese Frage durch Rückgriff auf verfügbare historische Informationen zu beantworten. Eine Intrige an einem der württembergischen Höfe wird so fassbar, deren starke Ähnlichkeit mit den im "Buch der Beispiele" erzählten höfischen Intrigen offenbar Anton von Pforr motivierte, ein Übersetzungsprojekt in Angriff zu nehmen. Intrigant, Intrigenopfer und andere Mitglieder des Hofes in der historischen Realität können so benannt werden und die Absicht, die für die Herstellung der ersten Handschrift verantwortlich war, kann so verständlich werden.
In den bereits vorliegenden ausführlichen Interpretationen des BdB wird das Interesse am Werk mit einem sich entwickelnden neuzeitlichen Geist in Verbindung gebracht, dem Bedürfnis durch nüchtern illusionslose Erzählungen ein ungeschminkt realistisches Bild von den gesellschaftlichen Verhältnissen geboten zu bekommen, wie dieses später von Machiavelli entworfen wird. Das Maß an Skrupellosigkeit, Gewalttätigkeit und erfolgreicher Intrige, welche das Fabelbuch bietet, könnte eine solche Deutung nahelegen. Diese Studie kommt jedoch zu einem anderen Ergebnis. Das BdB wird von den Initiatoren der Übersetzung als Zeugnis für verworfen brutale gesellschaftliche Verhältnisse verstanden. Dem BdB kommt somit die Funktion zu ein abschreckendes Beispiel zu sein, als Warnung zu dienen und Aufforderung zu sein, die eigenen kulturellen Standards zu verteidigen.
Inhaltsverzeichnis
- Vorbemerkung
- Einleitung
- Aufforderung zu Freundschaft und Bündnis
- Eine Welt voller Betrug, Gewalt und Tod
- Vize-Herrscher und Rat im Buch der Beispiele
- Vize-Herrscher und Rat im historischen Württemberg-Urach
- Spuren einer Hof-Intrige in der historischen Realität
- Die Vorrede des Anton von Pforr
- Das Directorium Vitae Humanae und seine Übersetzung durch Anton von Pforr
- Fiktionalität im BdB und höfische Realität
- Mögliches Szenarium der Hof-Intrige nach Pforr
- Der literarisch denunzierte 'üble Vetter'
- Zum Bildprogramm der Handschrift Cod. Pal. Germ. 466
- Tugendhafter Adel und Gewalttäter
- Indisches Buch und württembergische Identität
- Zur Bildüberlieferung der BdB-Handschriften und Drucke
- Spätere Rezipienten und adlige Öffentlichkeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Studie widmet sich der Analyse des „Buchs der Beispiele der alten Weisen“ (BdB), das in der Zeit Maximilians I. von Anton von Pforr übersetzt und vom württembergischen Grafen Eberhard im Barte gefördert wurde. Die Arbeit untersucht die Hintergründe, die Entstehung, die Rezeption und die Funktion des Werks im historischen Kontext.
- Das Interesse Eberhards im Barte am BdB und seine Rolle bei der Übersetzung und Verbreitung des Werks.
- Die historische und politische Situation im Württemberg des späten 15. Jahrhunderts, die das Werk beeinflusst haben könnte.
- Die literarischen und kulturellen Beziehungen zwischen Ost und West, die durch das BdB vermittelt werden.
- Die Rezeption des BdB in der adligen Öffentlichkeit und die Bedeutung des Werks für die Zeit.
- Die Interpretation des BdB als Fürstenspiegel, als Sammlung von Weisheitslehren oder als Mittel zur politischen Kommunikation.
Zusammenfassung der Kapitel
- Vorbemerkung: Die Studie wird in den Kontext von ähnlichen Arbeiten über Texte aus der Zeit Maximilians I. eingeordnet. Die vorliegende Arbeit untersucht die Funktion und Bedeutung des BdB im Kontext des volkssprachlichen literarischen Diskurses des Adels.
- Einleitung: Das Interesse Eberhards im Barte am BdB wird anhand von Handschriften, Drucken und der Rolle Antons von Pforr als Übersetzer beleuchtet.
- Aufforderung zu Freundschaft und Bündnis: Die Untersuchung des BdB als Werk, das Freundschaft und Bündnisse propagiert, und die Analyse seiner Bedeutung im Kontext der politischen Beziehungen der Zeit.
- Eine Welt voller Betrug, Gewalt und Tod: Die Analyse des Themas Betrug, Gewalt und Tod im BdB und seine Bedeutung für das Verständnis der historischen Realität.
- Vize-Herrscher und Rat im Buch der Beispiele: Die Darstellung von Vize-Herrschern und Ratgebern im BdB und die Analyse ihrer Rolle in der Geschichte Württembergs.
- Vize-Herrscher und Rat im historischen Württemberg-Urach: Die Untersuchung der konkreten historischen Figuren und Ereignisse, die im BdB reflektiert werden.
- Spuren einer Hof-Intrige in der historischen Realität: Die Analyse von möglichen Anspielungen auf eine Hof-Intrige im BdB und die Suche nach deren historischen Hintergrund.
- Die Vorrede des Anton von Pforr: Die Analyse der Vorrede des Übersetzers und die Rolle, die sie im Kontext des BdB spielt.
- Das Directorium Vitae Humanae und seine Übersetzung durch Anton von Pforr: Die Untersuchung der Beziehung zwischen dem BdB und dem „Directorium Vitae Humanae“ als Vorlage.
- Fiktionalität im BdB und höfische Realität: Die Frage nach dem Grad der Fiktionalität im BdB und dem Verhältnis zur höfischen Realität.
- Mögliches Szenarium der Hof-Intrige nach Pforr: Die Rekonstruktion eines möglichen Szenarios der im BdB angedeuteten Hof-Intrige.
- Der literarisch denunzierte 'üble Vetter': Die Analyse der Figur des „üble Vetter“ im BdB und die Interpretation seiner Bedeutung im Kontext der politischen und sozialen Beziehungen.
- Zum Bildprogramm der Handschrift Cod. Pal. Germ. 466: Die Untersuchung des Bildprogramms der Handschrift und die Analyse seiner Verbindung zum Text.
- Tugendhafter Adel und Gewalttäter: Die Darstellung von tugendhaftem Adel und Gewalttätern im BdB und die Analyse ihrer Bedeutung im Kontext der Zeit.
- Indisches Buch und württembergische Identität: Die Auseinandersetzung mit der Frage, wie das BdB mit der Identität Württembergs verknüpft ist.
- Zur Bildüberlieferung der BdB-Handschriften und Drucke: Die Analyse der Bildüberlieferung des BdB und die Entwicklung des Werks in verschiedenen Ausgaben.
Schlüsselwörter
Die Studie konzentriert sich auf die Analyse des „Buchs der Beispiele der alten Weisen“ (BdB) von Anton von Pforr, das im Kontext der politischen und kulturellen Situation des späten 15. Jahrhunderts in Württemberg entstanden ist. Schlüsselbegriffe sind: Eberhard im Barte, Anton von Pforr, Fürstenspiegel, Weisheit, Freundschaft, Bündnis, Hof-Intrige, politische Kommunikation, literarische Beziehungen, Ost und West, Bildprogramm, Bildüberlieferung, Württembergische Identität.
- Quote paper
- Horst Haub (Author), 2017, "Das Buch der Beispiele der alten Weisen" von Anton von Pforr. Historische Hintergründe und die Verbindung zu der "Warnfabel" von Eberhard im Bart, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/383956