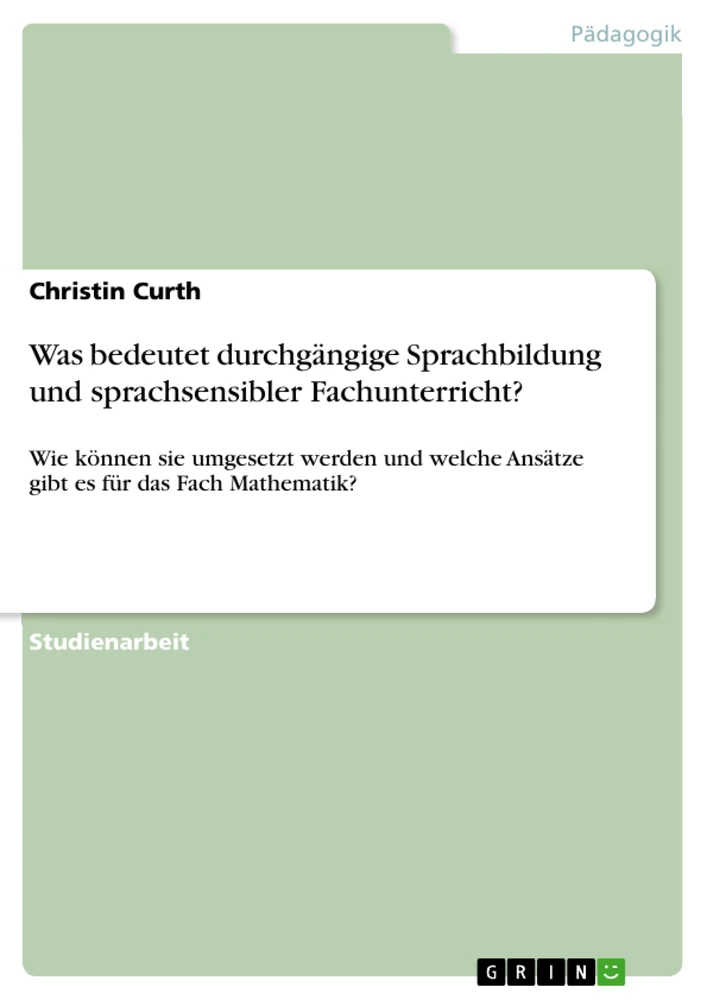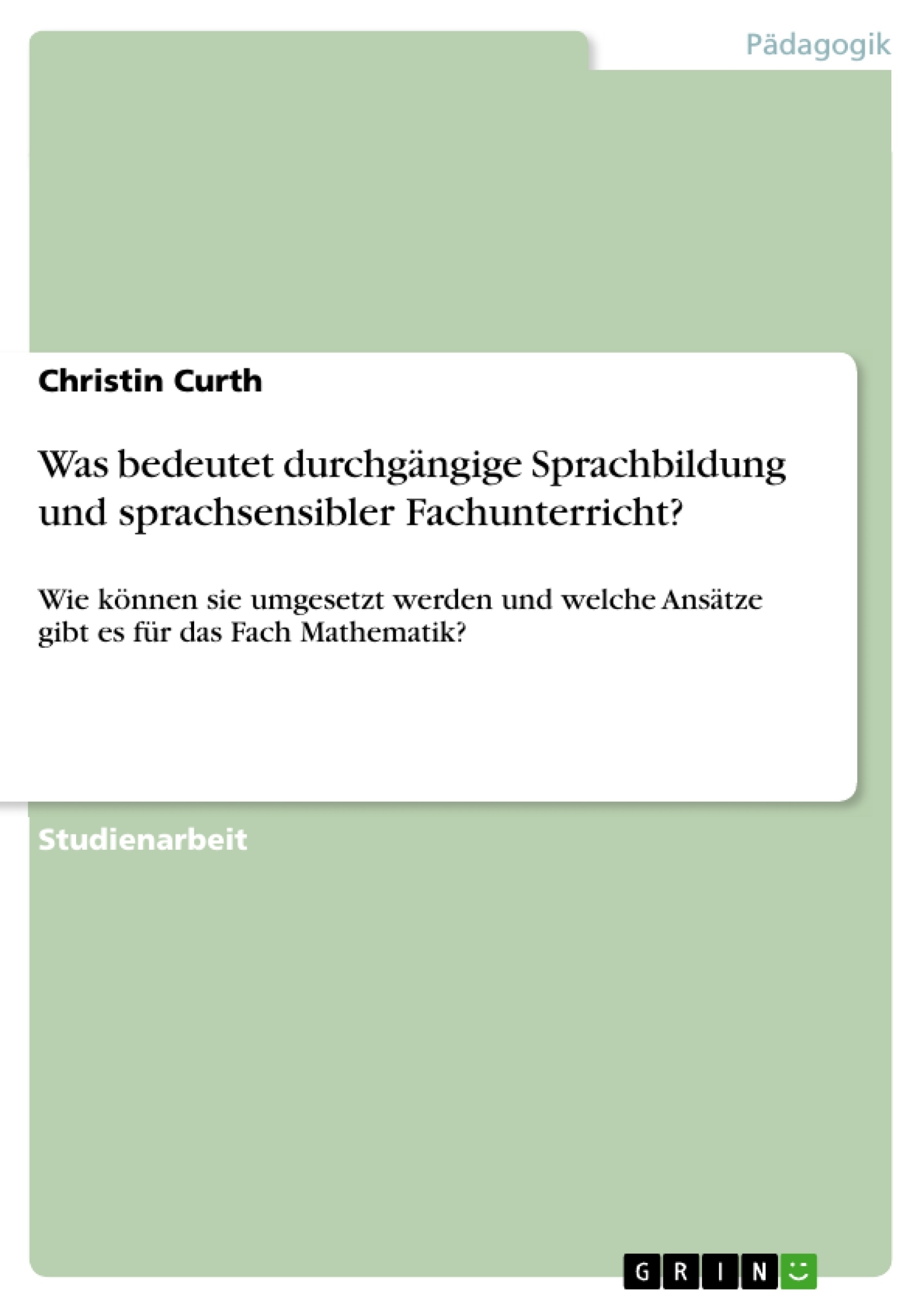Wo immer heutzutage Kinder zusammen unterrichtet oder betreut werden, sei es in Gruppen im Kindergarten oder Schulklassen, finden wir eine Vielfalt an sprachlichen Fähigkeiten. Einige Schülerinnen und Schüler kommen aus einem sprachlich reichen Elternhaus, andere wiederum haben eine geringere sprachliche Entwicklung, in dem weniger darauf geachtet wird. Weiterhin gibt es Kinder, die nur deutschsprachig aufwachsen, andere in denen eine oder sogar mehrere weitere Sprachen eine Rolle spielen. Oder auch welche, die in der Umgebung eines Dialektes oder einer Mundart leben. Es gibt viele sprachlichen Fähigkeiten, die Kinder und Jugendliche als Voraussetzung zum Lernen mitbringen. Diese sind von den sprachlichen Umständen abhängig, in denen sie leben und ihre Sprache entwickeln. Das Zusammenwirken zahlreicher sprachlicher Lebensumstände, welche in der heutigen Gesellschaft ganz normal und üblich ist, führt zu sprachlicher Heterogenität in Lerngruppen. Jede Schule muss garantieren, dass allen SuS ein „positives Recht auf die Entfaltung desjenigen Sprachbesitzes durch Unterricht zukommt, den sie aus der eigenen täglichen Lebenspraxis mitbringen.“ Die Lehrkraft hat demzufolge die Aufgabe, sich am Können der SuS zu orientieren, eine transparente Hinführung zur Anwendbarkeit der sprachlichen Inhalte zu präsentieren und sie sollte die Bildungssprache vorbildlich beherrschen. In der nun folgenden Arbeit möchte ich zuerst einige fachliche Begriffe klären. Alltags, Fach und Bildungssprache sind wichtige Register, welche im Unterricht eine wesentliche Rolle spielen. In diesem Zusammenhang ist es selbstverständlich, dass ich im Anschluss an die konzeptionelle Mündlichkeit und Schriftlichkeit anknüpfe, welche auch in den Begriffserklärungen erwähnt wurde. Danach folgen die Problematik und die sprachlichen Anforderungen der Schule mit einigen Beispielen aus dem Mathematikunterricht. Im nächsten Schritt werde ich auf die durchgängige Sprachbildung und das Programm FörMig näher eingehen. Zu dieser Sprachbildung darf ein sprachsensibler Fachunterricht nicht fehlen. Deswegen werde ich im letzten Abschnitt darauf eingehen und einige Beispiele aufzeigen, wie man Mathematikunterricht angemessen aufbereiten könnte um den SuS das Sprach und Fachlernen interessanter zu gestalten.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Begriffserklärung
- 2.1 Alltagssprache - Fachsprache - Bildungssprache
- 2.1.1 Alltagssprache
- 2.1.2 Fachsprache
- 2.1.3 Bildungssprache
- 2.2 Konzeptionelle Mündlichkeit und Schriftlichkeit
- 2.1 Alltagssprache - Fachsprache - Bildungssprache
- 3 Problematik und sprachliche Anforderungen
- 3.1 Sprachprobleme im Fachunterricht
- 3.2 Sprachliche Anforderungen der Schule
- 3.3 Beispiele aus dem Mathematikunterricht
- 3.3.1 Beispiel 1
- 3.3.2 Beispiel 2
- 4 Durchgängige Sprachbildung
- 4.1 Horizontale und vertikale Schnittstellen
- 4.2 Qualitätsmerkmale
- 5 Sprachsensibler Fachunterricht
- 5.1 Ziele des sprachsensiblen Fachunterrichts
- 5.2 Sprachsensibler Fachunterricht am Beispiel Mathematik
- 5.2.1 Beispiel 1
- 5.2.2 Beispiel 2
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem Konzept der durchgängigen Sprachbildung und des sprachsensiblen Fachunterrichts, insbesondere in Bezug auf den Mathematikunterricht. Sie untersucht die Herausforderungen, die sich aus der sprachlichen Heterogenität in Lerngruppen ergeben, und beleuchtet die Rolle der Bildungssprache im schulischen Kontext.
- Bedeutung und Abgrenzung von Alltagssprache, Fachsprache und Bildungssprache
- Sprachliche Anforderungen im Fachunterricht, insbesondere in Mathematik
- Umsetzung von durchgängiger Sprachbildung im schulischen Kontext
- Ziele und Methoden des sprachsensiblen Fachunterrichts
- Praxisbeispiele für die Gestaltung sprachsensiblen Mathematikunterrichts
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der sprachlichen Heterogenität in Lerngruppen ein und hebt die Bedeutung der Bildungssprache im Unterricht hervor. Kapitel 2 erläutert die verschiedenen sprachlichen Register und ihre Bedeutung im schulischen Kontext. Die Problematik und die sprachlichen Anforderungen im Fachunterricht werden in Kapitel 3 näher beleuchtet. Kapitel 4 behandelt das Konzept der durchgängigen Sprachbildung und geht auf die Qualitätsmerkmale ein. Kapitel 5 widmet sich dem sprachsensiblen Fachunterricht, seinen Zielen und Methoden, und präsentiert praxisrelevante Beispiele aus dem Mathematikunterricht.
Schlüsselwörter
Durchgängige Sprachbildung, Sprachsensibler Fachunterricht, Bildungssprache, Alltagssprache, Fachsprache, Mathematikunterricht, Sprachliche Heterogenität, Lernförderung, Inklusion, Sprachliche Anforderungen.
- Quote paper
- Christin Curth (Author), 2017, Was bedeutet durchgängige Sprachbildung und sprachsensibler Fachunterricht?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/383637