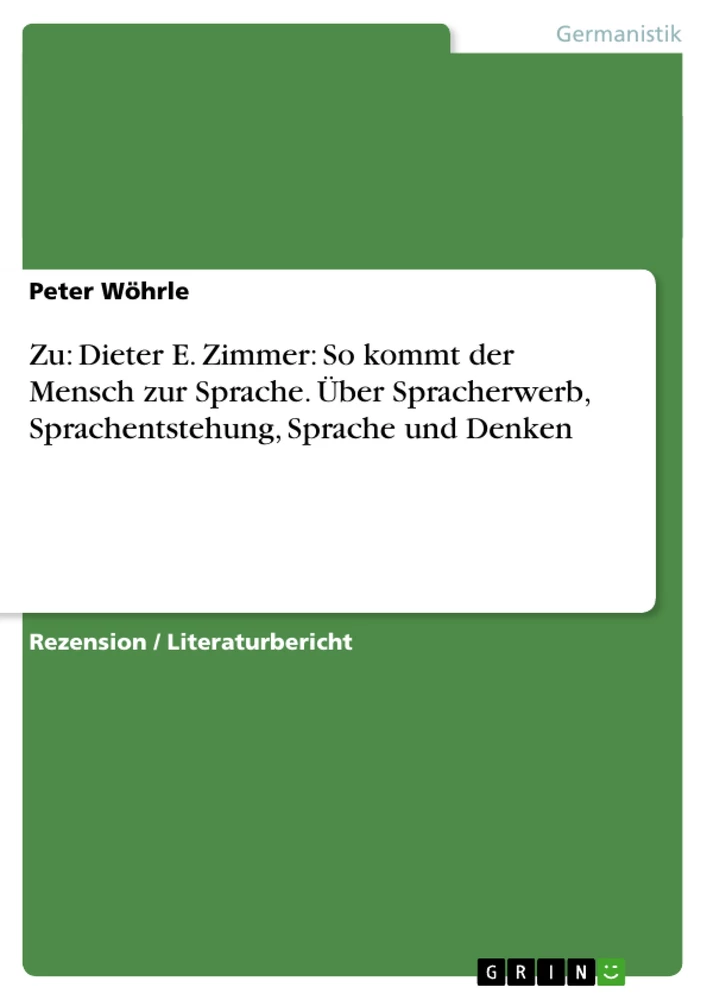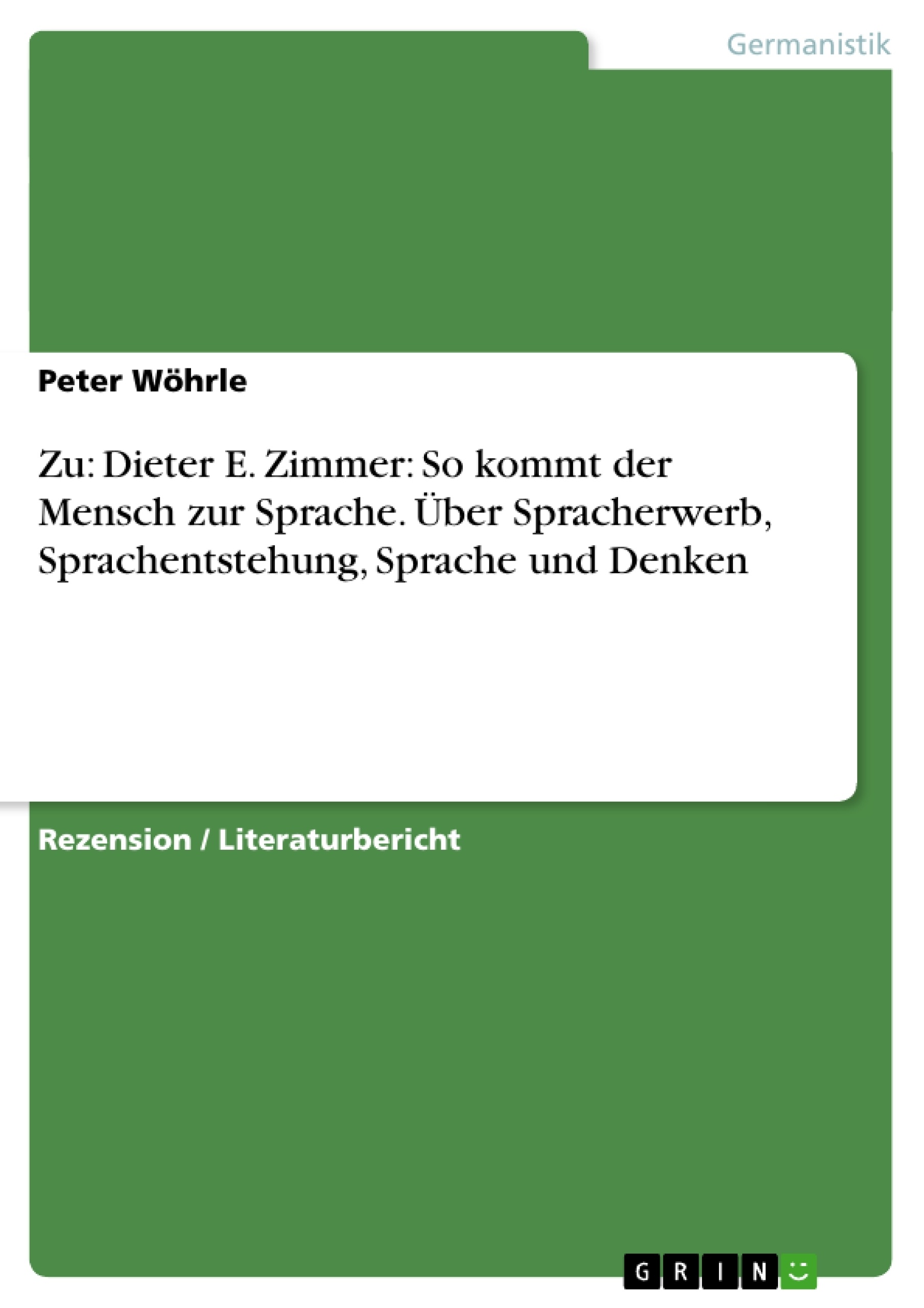Dieter E. Zimmer nimmt sich einiges vor: Gleich drei zentrale Themen der Linguistik möchte er in seinem Buch „So kommt der Mensch zur Sprache“ behandeln. Zum einen beschäftigt er sich mit dem Spracherwerb des Kindes, zum anderen mit der Sprachentstehung in der Menschheitsgeschichte. Außerdem findet in seine Darstellung das umfassende Thema des Zusammenhangs zwischen Sprache und Denken Eingang. Wer sich dieser Aufgabe stellt, sollte sich aber auch der Gefahren eines solch umfangreichen Unterfangens bewusst sein: Denn diese drei Themen in einem Buch zusammenzufassen, erscheint nur dann sinnvoll, wenn zw ischen ihnen Interdependenzen aufgezeigt werden können, d.h. wenn es gelingt, die einzelnen Teilbereiche gegenseitig zu erhellen. Das Inhaltsverzeichnis erregt aber einen entgegengesetzten Verdacht: Einzelne Überschriften ohne Bezifferung lassen vermuten, dass hier keine schlüssige Argumentation vorgeführt werden wird, sondern ein bloßes Nebeneinander von Ergebnissen. Auch der „Untertitel“ verstärkt diesen Verdacht: „Über Spracherwerb, Sprachentstehung, Sprache & Denken“. Das lapidare „Über“ deutet schon den anekdotischen Charakter des Buches an. Solche Vermutungen werden aber vielleicht relativiert durch die Tatsache, dass Zimmer nicht den unbedingten Anspruch hat, einen fachwissenschaftlichen Beitrag zu leisten, der sich an die Linguisten dieser Welt wendet. Zimmers Buch richtet sich an ein anderes Publikum: Insbesondere der Laie als Nicht-Linguist soll hier angesprochen werden, wie der Klappentext schon verrät. Dennoch bleibt es eine Grundfrage, inwiefern hier die Vermittlung der drei Themenbereiche gelingt und inwiefern das Buch für den Laien respektive den Linguisten nützlich ist. Zimmer stellt – wie sich bei genauerer Betrachtung noch he rausstellen wird – keine eigene wegweisende Theorie zu den Themen auf, sondern beschränkt sich darauf, verschiedene Forschungsergebnisse und -richtungen gegeneinander abzuheben; insofern trägt er also nichts Neues zur Forschung bei, sondern lediglich schon Gedachtes und Geprüftes zusammen, um so den Forschungsstand darzustellen.
Inhaltsverzeichnis
- Wie kommt der Mensch zur Sprache
- Die Sprache, die den Kindern zuwächst
- Behaviorismus
- Interaktionismus
- Nativismus
- Kognitivismus
- Der lange Weg zum Satz
- Die Grammatik der Sprache
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Buch „So kommt der Mensch zur Sprache“ von Dieter E. Zimmer hat zum Ziel, dem Laien drei zentrale linguistische Themen verständlich zu vermitteln: Spracherwerb, Sprachentstehung und den Zusammenhang zwischen Sprache und Denken. Es wird nicht der Anspruch auf eine originäre wissenschaftliche Theorie erhoben, sondern der aktuelle Forschungsstand dargestellt.
- Ontogenetischer Spracherwerb
- Phylogenetischer Spracherwerb
- Zusammenhang zwischen Sprache und Denken
- Vergleich verschiedener Theorien des Spracherwerbs (Behaviorismus, Interaktionismus, Nativismus, Kognitivismus)
- Die Rolle der Generativen Transformationsgrammatik und der Psycholinguistik
Zusammenfassung der Kapitel
Wie kommt der Mensch zur Sprache: Dieses Kapitel beginnt mit der Anekdote des ägyptischen Königs Psammetich und seiner Versuche, die natürliche Sprache von Kindern zu erforschen. Zimmer vergleicht den ontogenetischen (individuellen) und phylogenetischen (historischen) Spracherwerb und diskutiert frühere, als spekulativ eingestufte Sprachursprungstheorien. Der Fokus verlagert sich schnell auf den ontogenetischen Spracherwerb, wobei der Zusammenhang zum phylogenetischen nur implizit behandelt wird. Die Kapitel dient als Einleitung, die verschiedene Forschungsansätze ankündigt und deren Zusammenhänge andeutet.
Die Sprache, die den Kindern zuwächst: Hier werden verschiedene Theorien des ontogenetischen Spracherwerbs – Behaviorismus, Interaktionismus, Nativismus und Kognitivismus – gegenübergestellt. Der Schwerpunkt liegt auf der Frage nach dem angeborenen Wissen und dem Einfluss der Umwelt. Zimmer beschreibt die typische Entwicklung des Spracherwerbs vom Lautstadium zu Holophrasen und Mehrwortsätzen. Er diskutiert kritisch den Behaviorismus und die nativistischen Ansätze Chomskys, hebt aber auch die Bedeutung genetischer Voraussetzungen hervor. Der Kognitivismus und der Interaktionismus werden als alternative Erklärungsmodelle präsentiert, wobei die Bedeutung einer kindgerechten Sprachumgebung betont wird. Die universelle Abfolge im Spracherwerb wird als ein wichtiger Aspekt herausgestellt.
Der lange Weg zum Satz: Dieses Kapitel behandelt den Zusammenhang zwischen Sprache und Denken und stellt die Generative Transformationsgrammatik Chomskys und die Psycholinguistik gegenüber. Zimmer erläutert die Transformationsgrammatik als eine implizite Theorie der Sprachstruktur, betont aber ihre mangelnde „psychische Realität“. Im Gegensatz dazu präsentiert er die Psycholinguistik als empirische Wissenschaft, die sich mit den psychischen Prozessen bei der Satzbildung befasst. Anhand von Sprechfehlern werden die Stadien der Satzplanung untersucht. Obwohl die Psycholinguistik als wissenschaftlich fundierter dargestellt wird, schließt Zimmer einen Widerspruch zur Transformationsgrammatik nicht aus, indem er andeutet, dass die Tiefenstruktur der Transformationsgrammatik mit den frühen Planungsschritten der Psycholinguistik übereinstimmen könnte.
Schlüsselwörter
Spracherwerb, Sprachentstehung, Sprache und Denken, Ontogenese, Phylogenese, Behaviorismus, Interaktionismus, Nativismus, Kognitivismus, Generative Transformationsgrammatik, Psycholinguistik, Universalgrammatik.
Häufig gestellte Fragen zu "So kommt der Mensch zur Sprache" von Dieter E. Zimmer
Was ist der Inhalt des Buches "So kommt der Mensch zur Sprache"?
Das Buch behandelt drei zentrale linguistische Themen: Spracherwerb (Ontogenese und Phylogenese), Sprachentstehung und den Zusammenhang zwischen Sprache und Denken. Es stellt verschiedene Theorien des Spracherwerbs vor und vergleicht sie, ohne eine eigene Theorie zu entwickeln. Der Fokus liegt auf der verständlichen Darstellung des aktuellen Forschungsstands für ein nicht-fachkundiges Publikum.
Welche Theorien des Spracherwerbs werden im Buch behandelt?
Das Buch vergleicht ausführlich den Behaviorismus, den Interaktionismus, den Nativismus (insbesondere Chomskys Ansatz) und den Kognitivismus als Erklärungsmodelle für den Spracherwerb. Es wird die jeweilige Perspektive auf angeborenes Wissen und den Einfluss der Umwelt beleuchtet.
Wie wird der Zusammenhang zwischen Sprache und Denken dargestellt?
Der Zusammenhang zwischen Sprache und Denken wird im Kapitel "Der lange Weg zum Satz" erörtert. Hier werden die Generative Transformationsgrammatik Chomskys und die Psycholinguistik gegenübergestellt. Während die Transformationsgrammatik als implizite Theorie der Sprachstruktur beschrieben wird, wird die Psycholinguistik als empirische Wissenschaft hervorgehoben, die die psychischen Prozesse der Satzbildung untersucht. Der mögliche Zusammenhang zwischen der Tiefenstruktur der Transformationsgrammatik und den frühen Planungsschritten der Psycholinguistik wird angedeutet.
Welche Entwicklungsstufen des Spracherwerbs werden beschrieben?
Die Entwicklung des Spracherwerbs wird vom Lautstadium über Holophrasen bis hin zu Mehrwortsätzen beschrieben. Die universelle Abfolge im Spracherwerb wird als wichtiger Aspekt hervorgehoben.
Wie wird die Sprachentstehung im Buch behandelt?
Die Sprachentstehung wird im ersten Kapitel ("Wie kommt der Mensch zur Sprache") im Kontext des ontogenetischen und phylogenetischen Spracherwerbs behandelt. Es werden frühere, als spekulativ eingestufte Theorien erwähnt, der Fokus liegt jedoch auf dem ontogenetischen Spracherwerb, wobei der Zusammenhang zum phylogenetischen nur implizit behandelt wird. Die Anekdote des ägyptischen Königs Psammetich dient als einleitendes Beispiel.
Welche Rolle spielen die Generative Transformationsgrammatik und die Psycholinguistik im Buch?
Die Generative Transformationsgrammatik und die Psycholinguistik werden als gegensätzliche Ansätze zur Erklärung der Sprachstruktur und der Satzbildung dargestellt. Die Transformationsgrammatik wird als implizite Theorie beschrieben, während die Psycholinguistik als empirische Wissenschaft präsentiert wird, die sich mit den psychischen Prozessen der Satzbildung befasst.
Welche Schlüsselbegriffe sind für das Verständnis des Buches wichtig?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Spracherwerb, Sprachentstehung, Sprache und Denken, Ontogenese, Phylogenese, Behaviorismus, Interaktionismus, Nativismus, Kognitivismus, Generative Transformationsgrammatik, Psycholinguistik, Universalgrammatik.
Für wen ist das Buch geeignet?
Das Buch richtet sich an Laien, die sich auf verständliche Weise über die wichtigsten linguistischen Theorien zum Spracherwerb und zur Sprachentstehung informieren möchten.
- Quote paper
- Peter Wöhrle (Author), 2002, Zu: Dieter E. Zimmer: So kommt der Mensch zur Sprache. Über Spracherwerb, Sprachentstehung, Sprache und Denken, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/38329