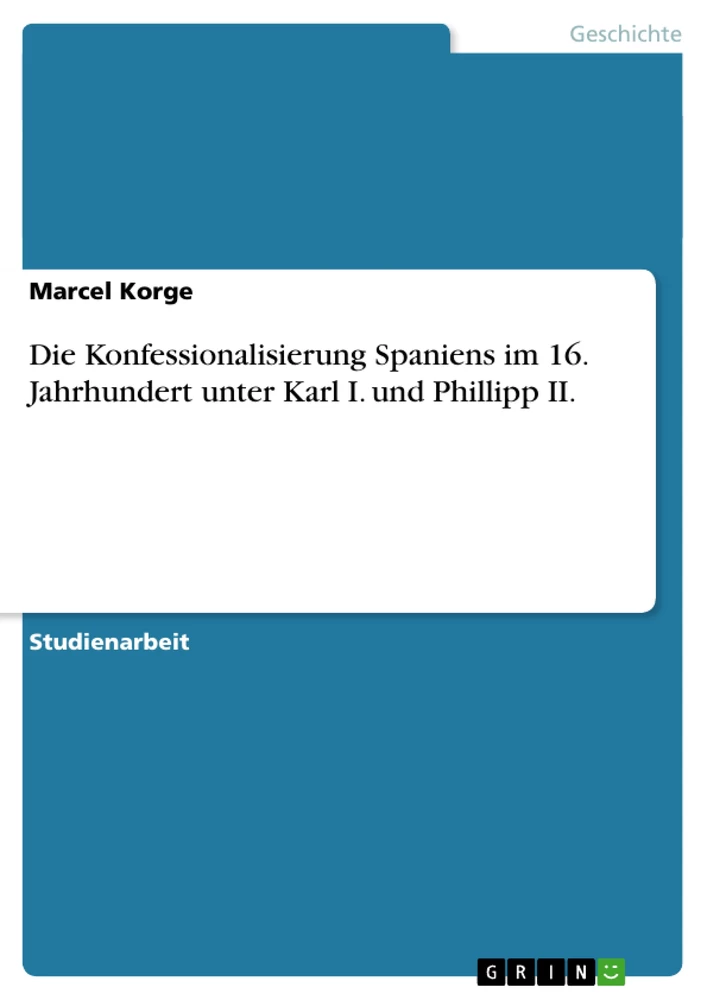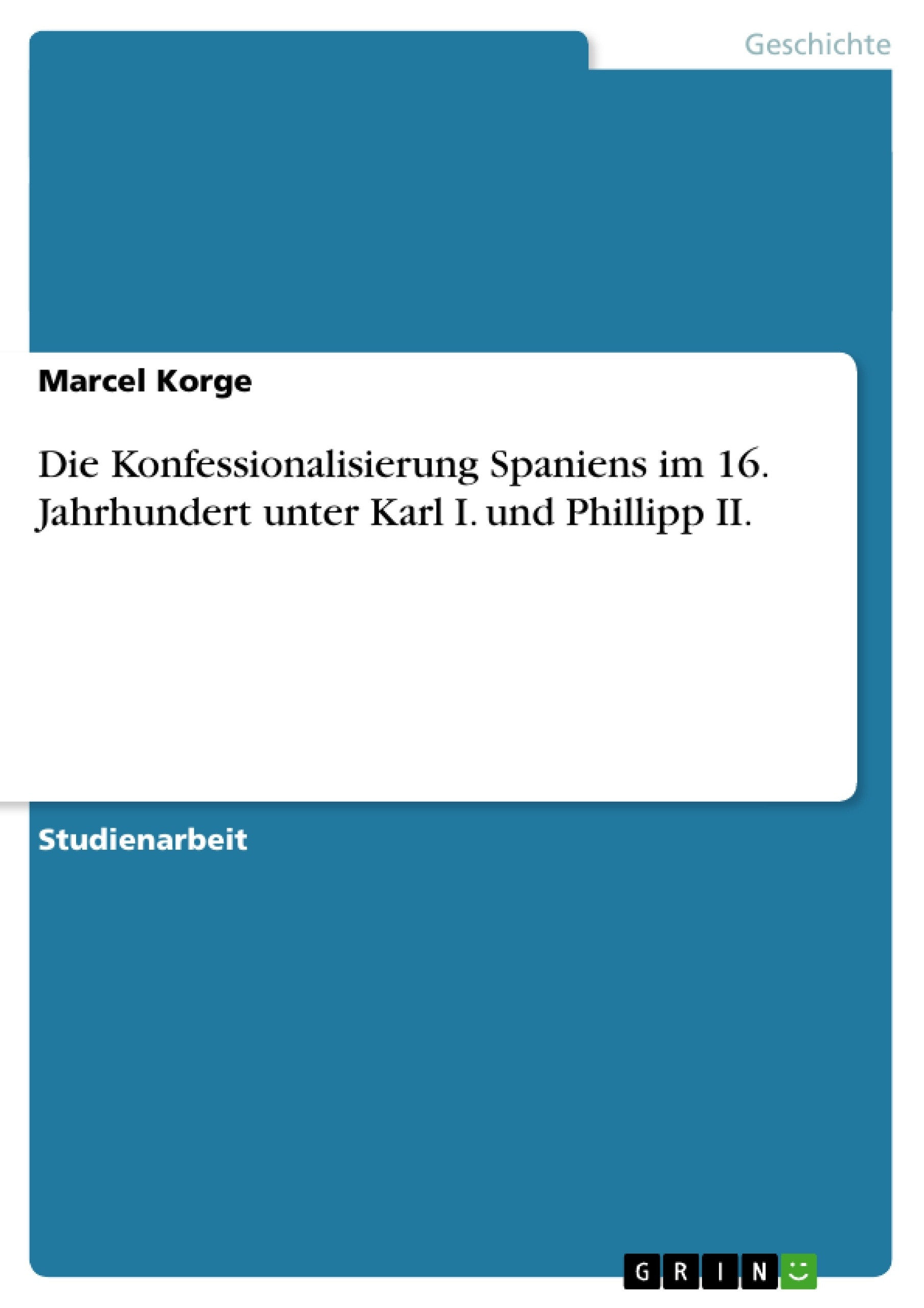Die Jahre von 1555 bis zum Vorabend des Dreißigjährigen Krieges werden im Allgemeinen als Zeitalter der Konfessionalisierung bezeichnet. Eine ältere Terminologie verwandte Begriffe wie konfessionelles Zeitalter oder Zeitalter der Glaubensspaltung und Glaubenskriege und wollte dadurch auf das Ende der mittelalterlichen christlichen Religionseinheit, welche so aber nie absoluten Bestand hatte, ebenso wie auf die sich anschließenden mehr oder weniger gewaltsamen Auseinandersetzungen für den eigenen Glaubens hinweisen. Insbesondere Spanien wurde dabei oft geradezu als Sperrspitze der katholischen Gegenreformation gesehen.
Deshalb stellt sich diese Hausarbeit die Aufgabe, die Entwicklung der Konfessionalisierung im Spanien des 16. Jahrhunderts zu charakterisieren. Welche spezifischen Eigenheiten sind hervorzuheben, welche Entwicklungen ausgehend vom Ende des 15. Jahrhunderts sind in der Religionspolitik zu verzeichnen? Das Augenmerk wird hierbei auf die Bedeutung der spanischen Könige Karl I., der zugleich als Karl V. römisch-deutscher König und Kaiser war, und Philipp II. gelegt werden.
Besonders stütze ich mich bei der vorliegenden Arbeit auf die Werke von Henry Kamen sowie von John Huxtable Elliott . Während speziell Kamen bestimmten Vorurteilen gegenüber der spanischen Gesellschaft als solcher entgegentritt, bestechen Elliotts Werke durch die Beleuchtung der Hintergründe des religionspolitischen Handelns. Daneben scheint es mir ebenfalls angebracht, ausdrücklich auf das Werk von Wolfgang Otto zu verweisen, der die Wurzeln der Stärke des spanischen Katholizismus in das Mittelalter verweist.
Nach einer Einleitung folgen im 2. Kapitel Vorbemerkungen zumeist terminologischer Art, um den Gegenstand der Arbeit abzugrenzen. Es schließt sich die eigentliche Untersuchung an, die im Spätmittelalter ansetzt, um die tiefsitzenden Weichenstellungen für das 16. Jahrhundert aufzuzeigen. In den folgenden beiden Kapiteln werden die Regierungszeiten Karl I. und Philipps II. untersucht, wobei besonderes Augenmerk auf den Umgang mit den nichtkatholischen Minderheiten gelegt wird. Bevor ein Fazit die erarbeiteten Ergebnisse abschließend zusammenfasst, wird im 6. Kapitel noch einmal auf die Gefahr einer Legendenbildung aufmerksam gemacht, die gerade bei einem religionspolitischen Thema droht. Das Literaturverzeichnis bildet den Abschluss der vorliegenden Hausarbeit.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Vorbemerkungen
- Der „Spanien“-Begriff
- Konfessionalisierung
- Das spanische Weltreich
- Spanien zu Ende des 15. Jahrhunderts
- Katholizismus und Stärkung der Monarchie
- Der Umgang mit Andersdenkenden: Wider alle Nichtchristen
- Spanien unter Karl I. (V.) (1516-1556)
- Universalmonarchie und Selbstverständnis
- Der Umgang mit Andersdenkenden: Von der Duldung zur Verfolgung
- Spanien unter Philipp II. (1556-1598)
- Das Vermächtnis des Vaters
- Herrschaftskonzentration
- Der Umgang mit Andersdenkenden
- Das Ziel der religiösen Einheit Spaniens
- Ketzer und Nichtchristen
- Die Jesuiten
- Das Bild Spaniens: Die Schwarze Legende
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit zielt darauf ab, die Entwicklung der Konfessionalisierung im Spanien des 16. Jahrhunderts zu beleuchten. Sie untersucht die spezifischen Eigenheiten und Entwicklungen der Religionspolitik, ausgehend vom Ende des 15. Jahrhunderts, mit besonderem Fokus auf die Herrschaft der Könige Karl I. und Philipp II.
- Die Bedeutung des Katholizismus und die Stärkung der Monarchie im späten 15. Jahrhundert
- Die Entwicklung des Umgangs mit Andersdenkenden, von der Duldung zur Verfolgung
- Die Rolle der spanischen Könige Karl I. und Philipp II. bei der Durchsetzung der Religionspolitik
- Die Herausbildung des spanischen Nationalstaates und die Bedeutung der Konfessionalisierung für diesen Prozess
- Die Entstehung der „Schwarzen Legende“ und ihre Auswirkungen auf das Bild Spaniens.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den historischen Kontext der Konfessionalisierung im 16. Jahrhundert skizziert und den Fokus auf Spanien lenkt. Im zweiten Kapitel werden terminologische Vorbemerkungen getroffen, um den Gegenstand der Arbeit abzugrenzen. Hierbei werden insbesondere die Begriffe „Spanien“, „Konfessionalisierung“ und „spanisches Weltreich“ definiert. Das dritte Kapitel beleuchtet die Situation Spaniens im späten 15. Jahrhundert, mit besonderem Augenmerk auf die Bedeutung des Katholizismus und die Stärkung der Monarchie. Es werden die verschiedenen Traditionen und Rechtssysteme der iberischen Halbinsel beleuchtet, die den späteren Prozess der Staatsbildung beeinflussten.
Im vierten und fünften Kapitel werden die Regierungszeiten Karl I. und Philipp II. untersucht, wobei das Augenmerk auf den Umgang mit nichtkatholischen Minderheiten gelegt wird. Die Hausarbeit beleuchtet die Entwicklung von der Duldung zur Verfolgung und zeigt die Rolle der spanischen Könige bei der Durchsetzung der Religionspolitik auf. Dabei werden verschiedene Aspekte, wie das Ziel der religiösen Einheit Spaniens, die Verfolgung von Ketzer und Nichtchristen sowie die Rolle der Jesuiten behandelt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit der Konfessionalisierung in Spanien im 16. Jahrhundert, insbesondere unter den Herrschern Karl I. und Philipp II. Es werden Themen wie Katholizismus, Monarchie, Religionspolitik, Andersdenkende, Staatsbildung, „Schwarze Legende“, und die Rolle der Jesuiten behandelt. Die Arbeit befasst sich auch mit den historischen Begriffen „Spanien“ und „Konfessionalisierung“ im Kontext der frühneuzeitlichen Geschichte.
- Citar trabajo
- Marcel Korge (Autor), 2004, Die Konfessionalisierung Spaniens im 16. Jahrhundert unter Karl I. und Phillipp II., Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/38307