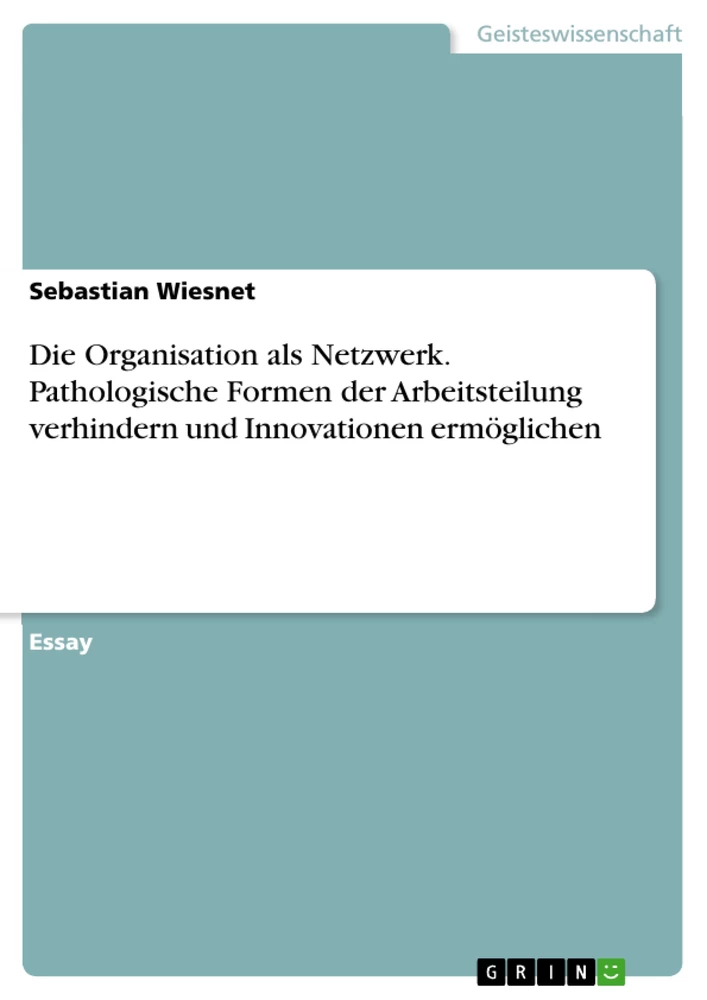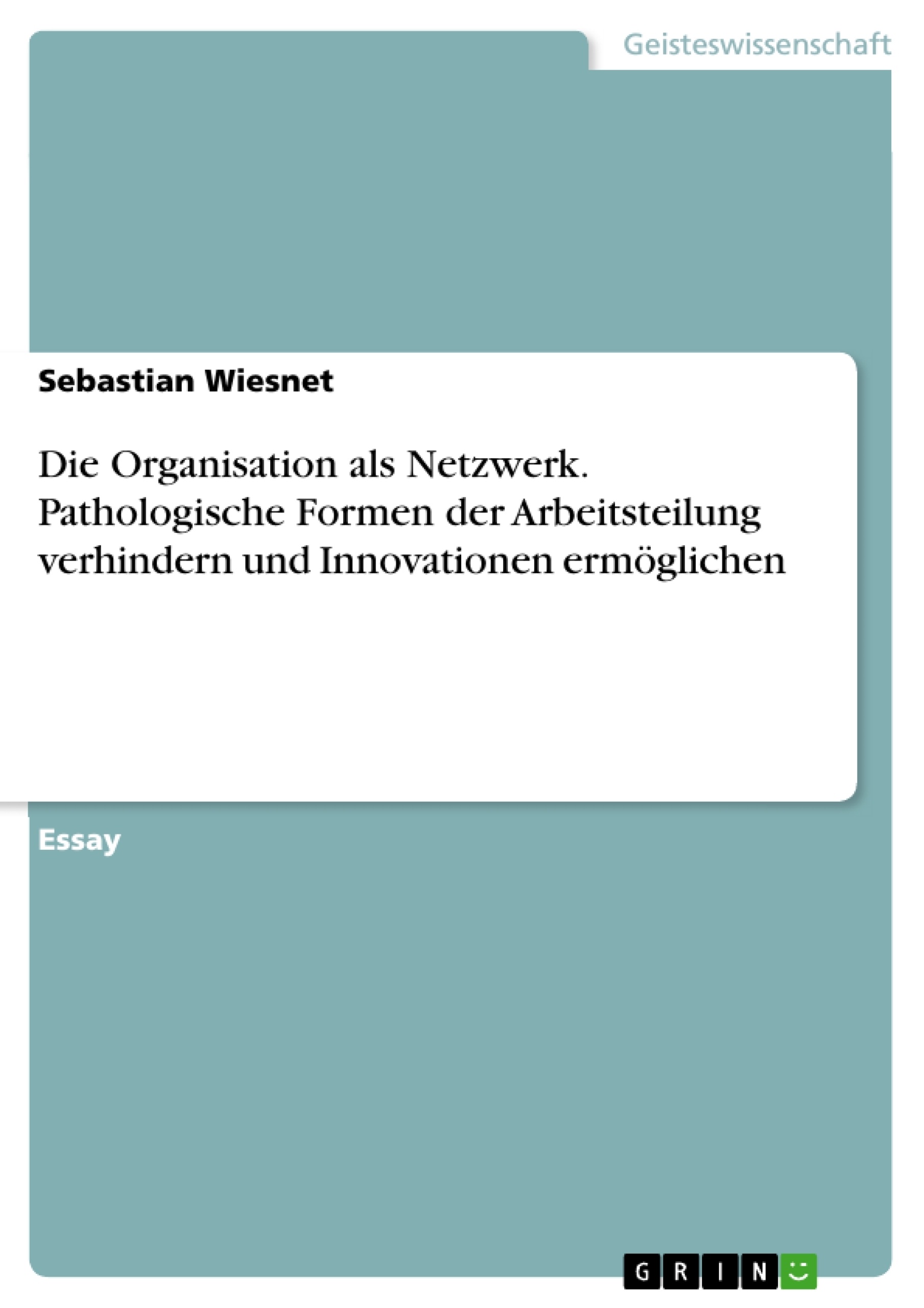Entwicklung und Implementierung von Innovationen in einer Organisation sind umso wahrscheinlicher, je reibungsloser die innerbetrieblichen Arbeitsprozesse vonstatten gehen und je größer das Vertrauen und die Solidarität unter den Mitarbeitern ist. (vgl. Powell 1990, S. 305; Heidenreich 2004, S. 105 (207)) Es gibt viele Störquellen, die Unruhe und Chaos in eine Organisation bringen können. Eine davon stellt die suboptimale Organisation der Arbeit dar, genauer gesagt der Arbeitsteilung. Durkheim benennt drei Formen der Arbeitsteilung, die zu Anomie, Konflikt und mangelnder Solidarität führen. (vgl. Durkheim 1992, S. 421-465)
Ziel dieser Arbeit ist es, Durkheims pathologische Formen der Arbeitsteilung mit der Netzwerktheorie zu verbinden und der Frage nachzugehen, wie ein intraorganisationales Netzwerk beschaffen sein muss, damit einerseits anormale Arbeitsteilung verhindert und (dadurch) andererseits Innovationen in einer Organisation ermöglicht werden.
Dazu werden die entsprechenden Ausführungen Durkheims umrissen (Kap. 1), die Netzwerktheorie skizziert und die unterschiedliche Bedeutung von starken und schwachen Bindungen hinsichtlich der Möglichkeit von Innovationen herausgearbeitet. Anschließend wird versucht, zentrale (und globale) Gesichtspunkte eines innovationsfreundlichen intraorganisationalen Netzwerks zu bestimmen (Kap. 4). Ergänzend dazu soll Kapitel 4 das Verständnis dafür schärfen, dass eine Organisation nicht nur per se ein Netzwerk darstellen, sondern auch Teil eines umfassenderen Netzwerks sein sollte.
Inhaltsverzeichnis
- Durkheims pathologische Formen der Arbeitsteilung
- Das Netzwerk - unterschiedliche Bedeutung starker und schwacher Bindungen
- Die Organisation als Netzwerk
- Die Organisation als Teil eines Netzwerkes
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit verbindet Durkheims pathologische Formen der Arbeitsteilung mit der Netzwerktheorie. Ziel ist es zu untersuchen, wie ein intraorganisationales Netzwerk beschaffen sein muss, um anormale Arbeitsteilung zu verhindern und Innovationen zu ermöglichen. Dies beinhaltet die Analyse der Bedeutung starker und schwacher Bindungen im Netzwerk.
- Durkheims pathologische Formen der Arbeitsteilung
- Netzwerktheorie und die Bedeutung von starken und schwachen Bindungen
- Intraorganisationale Netzwerke und die Vermeidung pathologischer Arbeitsteilung
- Intraorganisationale Netzwerke und die Förderung von Innovationen
- Organisationen als Teil eines umfassenderen Netzwerks
Zusammenfassung der Kapitel
Durkheims pathologische Formen der Arbeitsteilung: Dieses Kapitel beschreibt Durkheims drei pathologische Formen der Arbeitsteilung: anomische, erzwungene und dysfunktionale Arbeitsteilung. Die anomische Arbeitsteilung entsteht durch fehlende Regulierung der Beziehungen zwischen Mitarbeitern, was zu Isolation und mangelnder Solidarität führt. Die erzwungene Arbeitsteilung resultiert aus einem Übermaß an Regeln und starren Hierarchien, die den Aufstieg behindern und Unzufriedenheit hervorrufen. Die dysfunktionale Arbeitsteilung entsteht durch eine ungerechte Koordination von Aufgaben, die zu Über- oder Unterforderung führt. Der Fokus liegt auf der anomischen Arbeitsteilung, da sie den Ansatzpunkt für die Netzwerktheorie bietet. Die fehlende Regulierung und der daraus resultierende Mangel an Kontakt und gemeinsamem Referenzpunkt werden als zentrale Probleme herausgestellt.
Das Netzwerk – unterschiedliche Bedeutung starker und schwacher Bindungen: Dieses Kapitel skizziert die Netzwerktheorie, wobei der methodische Individualismus im Vordergrund steht. Es wird die unterschiedliche Beschaffenheit von Bindungen zwischen Akteuren (Individuen) innerhalb einer Organisation beleuchtet. Starke Bindungen, charakterisiert durch häufige Kommunikation, Vertrautheit und Solidarität, führen zu einem dichten Netzwerk mit schnellen Informationsflüssen, jedoch auch zu einem Risiko der Abschottung und Lernunfähigkeit. Schwache Bindungen hingegen ermöglichen den Zugang zu neuen Informationen und fördern die Anpassungsfähigkeit. Der graduelle Unterschied zwischen starken und schwachen Bindungen wird erläutert und die Bedeutung dieser Unterscheidung für die Innovationsfähigkeit des Netzwerks hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Pathologische Arbeitsteilung, Netzwerktheorie, starke und schwache Bindungen, Innovation, Solidarität, Anomie, Intraorganisationales Netzwerk, Arbeitsteilung, Organisation.
Häufig gestellte Fragen zu: Durkheims pathologische Arbeitsteilung und Netzwerktheorie
Was ist das zentrale Thema dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen Durkheims pathologischen Formen der Arbeitsteilung und der Netzwerktheorie. Das Hauptziel ist es zu verstehen, wie ein intraorganisationales Netzwerk gestaltet sein muss, um anomische Arbeitsteilung zu verhindern und Innovationen zu fördern.
Welche pathologischen Formen der Arbeitsteilung nach Durkheim werden behandelt?
Die Arbeit beschreibt Durkheims drei pathologische Formen: anomische, erzwungene und dysfunktionale Arbeitsteilung. Der Fokus liegt dabei auf der anomischen Arbeitsteilung, die durch fehlende Regulierung und mangelnde Solidarität gekennzeichnet ist und den Ausgangspunkt für die Netzwerkbetrachtung bildet.
Welche Rolle spielt die Netzwerktheorie?
Die Netzwerktheorie dient als analytisches Werkzeug, um die Auswirkungen der Netzwerkstruktur auf die Arbeitsteilung zu untersuchen. Es wird die Bedeutung starker und schwacher Bindungen innerhalb des intraorganisationalen Netzwerks analysiert.
Was ist der Unterschied zwischen starken und schwachen Bindungen im Netzwerk?
Starke Bindungen sind durch häufige Kommunikation, Vertrautheit und Solidarität gekennzeichnet und führen zu schnellen Informationsflüssen. Schwache Bindungen ermöglichen hingegen den Zugang zu neuen Informationen und fördern die Anpassungsfähigkeit. Die Arbeit betont die Bedeutung beider Bindungstypen für die Innovationsfähigkeit und Vermeidung pathologischer Arbeitsteilung.
Wie kann ein intraorganisationales Netzwerk anomische Arbeitsteilung verhindern und Innovation fördern?
Die Arbeit untersucht, wie die richtige Balance zwischen starken und schwachen Bindungen im intraorganisationalen Netzwerk dazu beitragen kann, anomische Arbeitsteilung zu vermeiden und Innovationen zu ermöglichen. Ein gut ausbalanciertes Netzwerk mit ausreichend starken Bindungen für Kohäsion und schwachen Bindungen für den Zugang zu neuen Informationen ist ideal.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit beinhaltet Kapitel zu Durkheims pathologischen Formen der Arbeitsteilung, der Bedeutung starker und schwacher Bindungen in Netzwerken, intraorganisationalen Netzwerken und deren Einfluss auf pathologische Arbeitsteilung und Innovation, sowie Organisationen als Teil größerer Netzwerke.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Pathologische Arbeitsteilung, Netzwerktheorie, starke und schwache Bindungen, Innovation, Solidarität, Anomie, Intraorganisationales Netzwerk, Arbeitsteilung, Organisation.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Beziehung zwischen Durkheims Theorie der pathologischen Arbeitsteilung und der Netzwerktheorie aufzuzeigen und praktische Implikationen für die Gestaltung intraorganisationaler Netzwerke zu entwickeln, um Innovation zu fördern und negative Auswirkungen anomischer Arbeitsteilung zu minimieren.
- Quote paper
- Sebastian Wiesnet (Author), 2005, Die Organisation als Netzwerk. Pathologische Formen der Arbeitsteilung verhindern und Innovationen ermöglichen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/38252