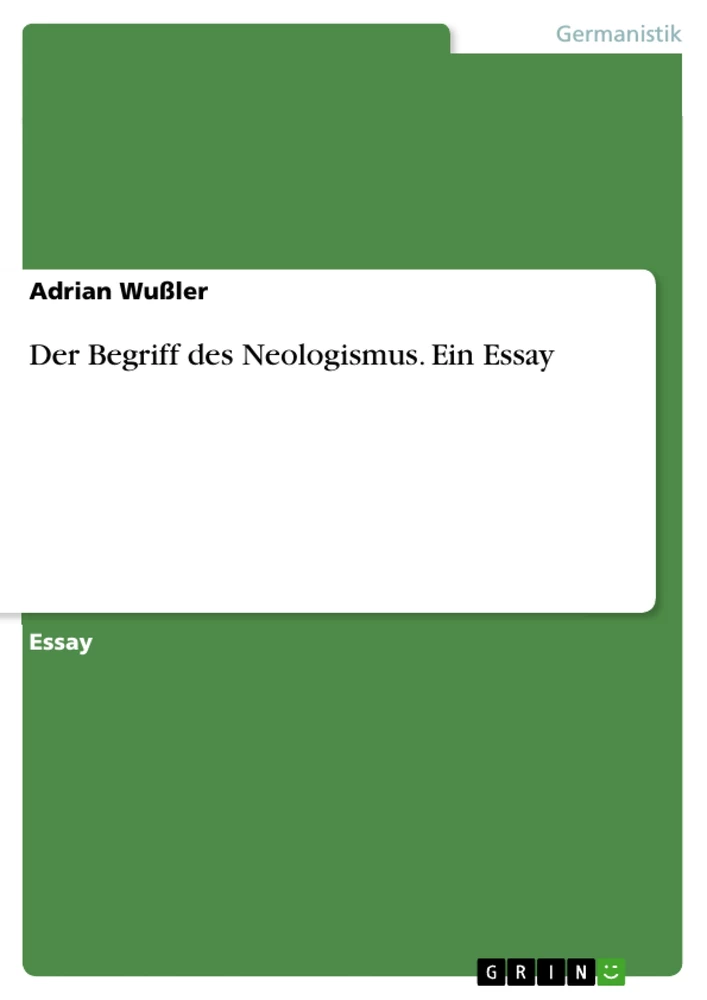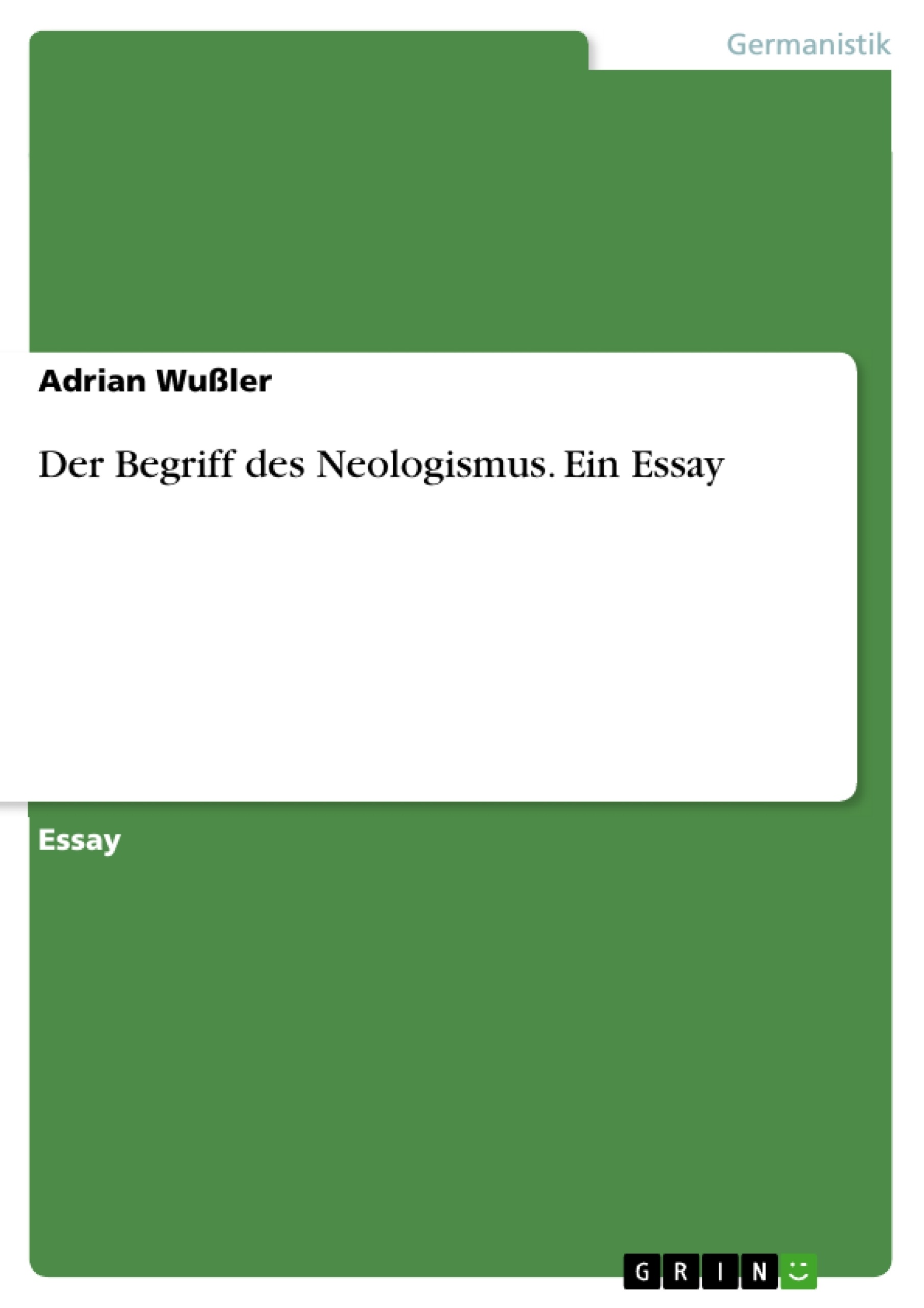Was ist ein Neologismus? Der Ausdruck besteht aus zwei Teilen; dem alt- sowie neugriechischen Wort νέος neos "neu" und λόγος logos "Wort". Wenn man diesen Fachbegriff germanisiert, kommt man der eigentlichen Bedeutung des Wortes sehr nahe. Von einem "Neuwort" bzw. einem "neuen Wort" ist die Rede. Schlichtweg handelt es sich um ein lexikalisches Zeichen, das zu einer bestimmten Zeit von der ansässigen Bevölkerung als "neu" empfunden wurde oder bereits vorhanden war, aber eine neue Bedeutung erhalten hat.
Somit kann man feststellen, dass die Mitglieder der Gruppe der Wörter, die man als Neologismen bezeichnet, ständig varieren. Abhängig von Zeit und Raum werden neue Wörter als Wortneuschöpfungen bezeichnet, während sich andere Wörter bereits etabliert haben und ihren Weg in das Wörterbuch finden, wodurch sie in einem sich erweiternden Wortschatz aufgenommen werden. Somit steht jeder Text, der sich mit Neologismen beschäftigt, in der potentiellen Gefahr beim Publikationsdatum schon nicht mehr aktuell zu sein.
Das rührt daher, dass viele dieser Neubildungen sehr kurzlebig sind und nur kurze Zeit in nennenswertem Gebrauch, was vor allem beim jugendlichen Anteil der Bevölkerung zu beobachten ist. Dank Hermann Paul (1880/1909) und Willhelm Wilmanns (1899,1), wird seit dem späten 19. Jahrhundert der Ausdruck Neologismus zunehmend differenziert. So unterscheidet man mittlerweile zwischen Neuschöpfung (auch: Wortneuschöpfung, Urschöpfung, Wortneubildung oder Wortschöpfung) und Wortbildung.
Bei der Neuschöpfung handelt es sich um ein komplett neugebildetes Wort, das im Gegensatz zur Wortbildung nicht aus bereits bekannten Morphemen hergeleitet ist und in der Sprache (noch) nicht als bedeutungstragende Elemente enthalten sind, sondern lautlich neu entwickelt wurde.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Was ist ein Neologismus?
- 2. Neuschöpfungen, die keinen Bezug zu bereits bekannten Morphemen haben
- 3. Semantische Verfahren, Syntaktische Verfahren und Morphologisch-strukturelle Verfahren
- 4. Beobachtung der zeitlichen Markierungen bei 8500 Stichwörtern
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Essay untersucht den Begriff des Neologismus in der deutschen Sprache. Er beleuchtet die Entstehung neuer Wörter, differenziert zwischen verschiedenen Arten der Wortbildung und analysiert die Rolle gesellschaftlicher Faktoren in diesem Prozess.
- Definition und Entwicklung des Begriffs "Neologismus"
- Unterscheidung zwischen Neuschöpfung und Wortbildung
- Analyse verschiedener Wortbildungsverfahren (semantisch, syntaktisch, morphologisch-strukturell)
- Einfluss gesellschaftlicher und sprachlicher Entwicklungen auf die Entstehung von Neologismen
- Rolle von Fremdwörtern und Anglizismen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Was ist ein Neologismus?: Das Kapitel definiert den Begriff "Neologismus" als "Neuwort" oder "neues Wort", das zu einer bestimmten Zeit als neu empfunden wird oder ein bereits vorhandenes Wort mit neuer Bedeutung ist. Es betont den dynamischen Charakter von Neologismen und deren Variabilität über Zeit und Raum. Die Arbeit von Hermann Paul und Wilhelm Wilmanns zur Differenzierung des Begriffs im späten 19. Jahrhundert wird erwähnt, sowie die Unterscheidung zwischen Neuschöpfung und Wortbildung. Das Kapitel legt den Grundstein für die weitere Untersuchung der verschiedenen Arten der Wortbildung.
2. Neuschöpfungen, die keinen Bezug zu bereits bekannten Morphemen haben: Dieses Kapitel widmet sich der Neuschöpfung von Wörtern ohne Bezug zu bestehenden Morphemen. Es stellt fest, dass diese Methode in der heutigen Zeit unbedeutend ist, im Gegensatz zur Wortbildung. Die Bedeutung der Onomatopoesie als Methode zur Wortneuschöpfung in frühen Sprachentwicklungsphasen wird diskutiert, unter Einbeziehung von Beispielen wie "knallen" oder "klirren". Der kreative Aspekt dieser Methode und ihre Verwendung durch Kinder werden hervorgehoben, bevor der Fokus auf das heutzutage gebräuchlichere Verfahren der Wortbildung gelenkt wird.
3. Semantische Verfahren, Syntaktische Verfahren und Morphologisch-strukturelle Verfahren: Dieses Kapitel differenziert die Wortbildung in drei Unterarten: das semantische, das syntaktische und das morphologisch-strukturelle Verfahren. Das semantische Verfahren beschreibt die Veränderung der Bedeutung eines Wortes bei gleichbleibendem Klang (z.B. "Küchenmaschine"). Das syntaktische Verfahren beinhaltet die Veränderung des Wortstamms und damit der Wortart (z.B. "merkeln"). Das morphologisch-strukturelle Verfahren greift direkt in die Wortstruktur ein durch Kürzung, Erweiterung oder andere Veränderungen. Das Kapitel veranschaulicht die komplexen Abhängigkeiten innerhalb des Sprachsystems und die Rolle dominanter Wörter bei der Bildung neuer Wörter.
4. Beobachtung der zeitlichen Markierungen bei 8500 Stichwörtern: Der letzte analysierte Abschnitt untersucht die zeitlichen Veränderungen im deutschen Wortschatz anhand von 8500 Stichwörtern. Es wird festgestellt, dass die Anteile von neu hinzugekommenen und zurückweichenden Wörtern sich die Waage halten. Die Bedeutung von fremdsprachigen Einflüssen, insbesondere Anglizismen, wird hervorgehoben, zusammen mit Beispielen wie "Chip", "Shop" oder "Pop". Der Einfluss von Globalisierung und anglo-amerikanischer Dominanz auf den deutschen Wortschatz wird diskutiert, ebenso wie die kurzlebige Natur von Modewörtern wie "power walking" oder "superfood". Die Adaption neuer Bedeutungen aus dem Englischen wird als Teil des semantischen Verfahrens der Wortbildung erläutert.
Schlüsselwörter
Neologismus, Wortbildung, Neuschöpfung, Onomatopoesie, Semantische Verfahren, Syntaktische Verfahren, Morphologisch-strukturelle Verfahren, Anglizismen, Fremdwörter, Wortsemantik, Sprachwandel, deutsche Sprache.
Häufig gestellte Fragen zum Essay: Neologismen in der deutschen Sprache
Was ist der Gegenstand dieses Essays?
Der Essay befasst sich umfassend mit dem Thema Neologismen in der deutschen Sprache. Er untersucht die Entstehung neuer Wörter, differenziert zwischen verschiedenen Arten der Wortbildung und analysiert den Einfluss gesellschaftlicher Faktoren auf diesen Prozess.
Welche Arten der Wortbildung werden behandelt?
Der Essay unterscheidet drei Hauptverfahren der Wortbildung: semantische Verfahren (Bedeutungsänderung bei gleichbleibendem Klang), syntaktische Verfahren (Wortartänderung durch Veränderung des Wortstamms) und morphologisch-strukturelle Verfahren (direkte Veränderung der Wortstruktur durch Kürzung, Erweiterung etc.). Zusätzlich wird die Neuschöpfung von Wörtern ohne Bezug zu bestehenden Morphemen behandelt, die jedoch als heutzutage unbedeutend eingestuft wird.
Welche Rolle spielen Fremdwörter und Anglizismen?
Der Essay hebt die Bedeutung fremdsprachiger Einflüsse, insbesondere von Anglizismen, auf den deutschen Wortschatz hervor. Es werden Beispiele für die Adaption englischer Wörter und die Entstehung neuer Bedeutungen im Deutschen diskutiert, sowie der Einfluss von Globalisierung und anglo-amerikanischer Dominanz auf den Sprachwandel.
Wie wird der Begriff "Neologismus" definiert?
Der Essay definiert "Neologismus" als "Neuwort" oder "neues Wort", das zu einer bestimmten Zeit als neu empfunden wird oder ein bereits vorhandenes Wort mit neuer Bedeutung darstellt. Es wird betont, dass Neologismen einen dynamischen Charakter haben und sich über Zeit und Raum verändern.
Welche Kapitel umfasst der Essay und worum geht es in jedem Kapitel?
Der Essay gliedert sich in vier Kapitel: Kapitel 1 definiert den Begriff "Neologismus" und legt den Grundstein für die weitere Untersuchung. Kapitel 2 behandelt die Neuschöpfung von Wörtern ohne Bezug zu bestehenden Morphemen. Kapitel 3 differenziert die Wortbildung in semantische, syntaktische und morphologisch-strukturelle Verfahren. Kapitel 4 analysiert zeitliche Veränderungen im deutschen Wortschatz anhand von 8500 Stichwörtern und untersucht den Einfluss von Anglizismen und Globalisierung.
Welche konkreten Beispiele werden im Essay genannt?
Der Essay enthält zahlreiche Beispiele, darunter Onomatopoesie wie "knallen" und "klirren", semantische Beispiele wie "Küchenmaschine", syntaktische Beispiele wie "merkeln", Anglizismen wie "Chip", "Shop" und "Pop", sowie Modewörter wie "power walking" und "superfood".
Welche Methode wurde zur Analyse der zeitlichen Veränderungen verwendet?
Die zeitlichen Veränderungen im deutschen Wortschatz wurden anhand einer Analyse von 8500 Stichwörtern untersucht. Dabei wurde der Anteil neu hinzugekommener und zurückweichender Wörter verglichen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Essay?
Schlüsselwörter sind: Neologismus, Wortbildung, Neuschöpfung, Onomatopoesie, Semantische Verfahren, Syntaktische Verfahren, Morphologisch-strukturelle Verfahren, Anglizismen, Fremdwörter, Wortsemantik, Sprachwandel, deutsche Sprache.
- Quote paper
- Adrian Wußler (Author), 2017, Der Begriff des Neologismus. Ein Essay, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/382029