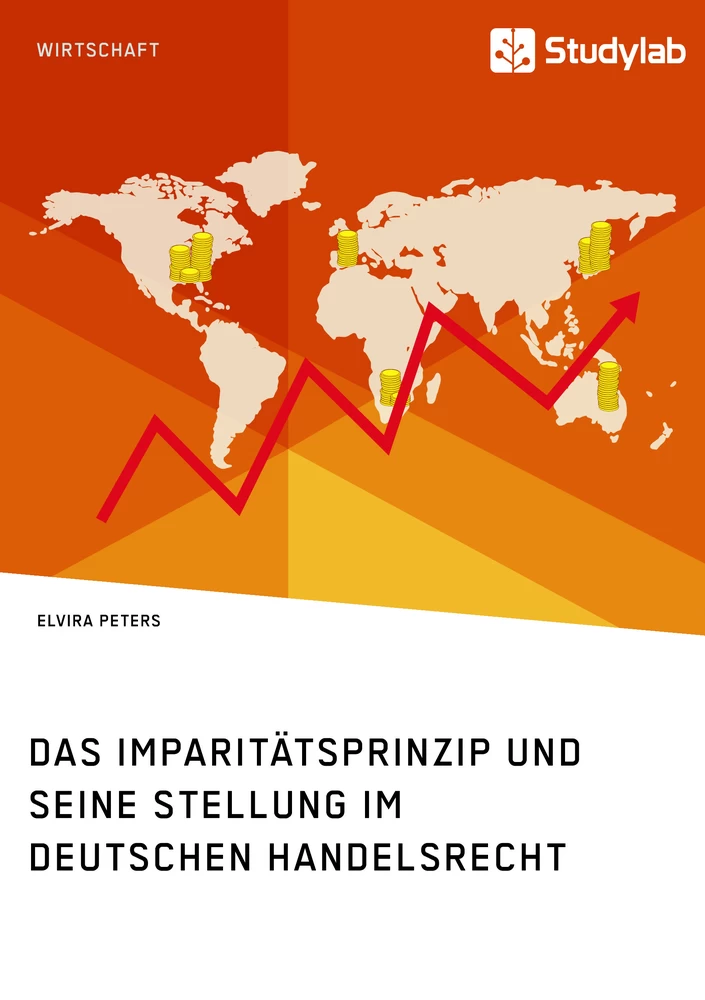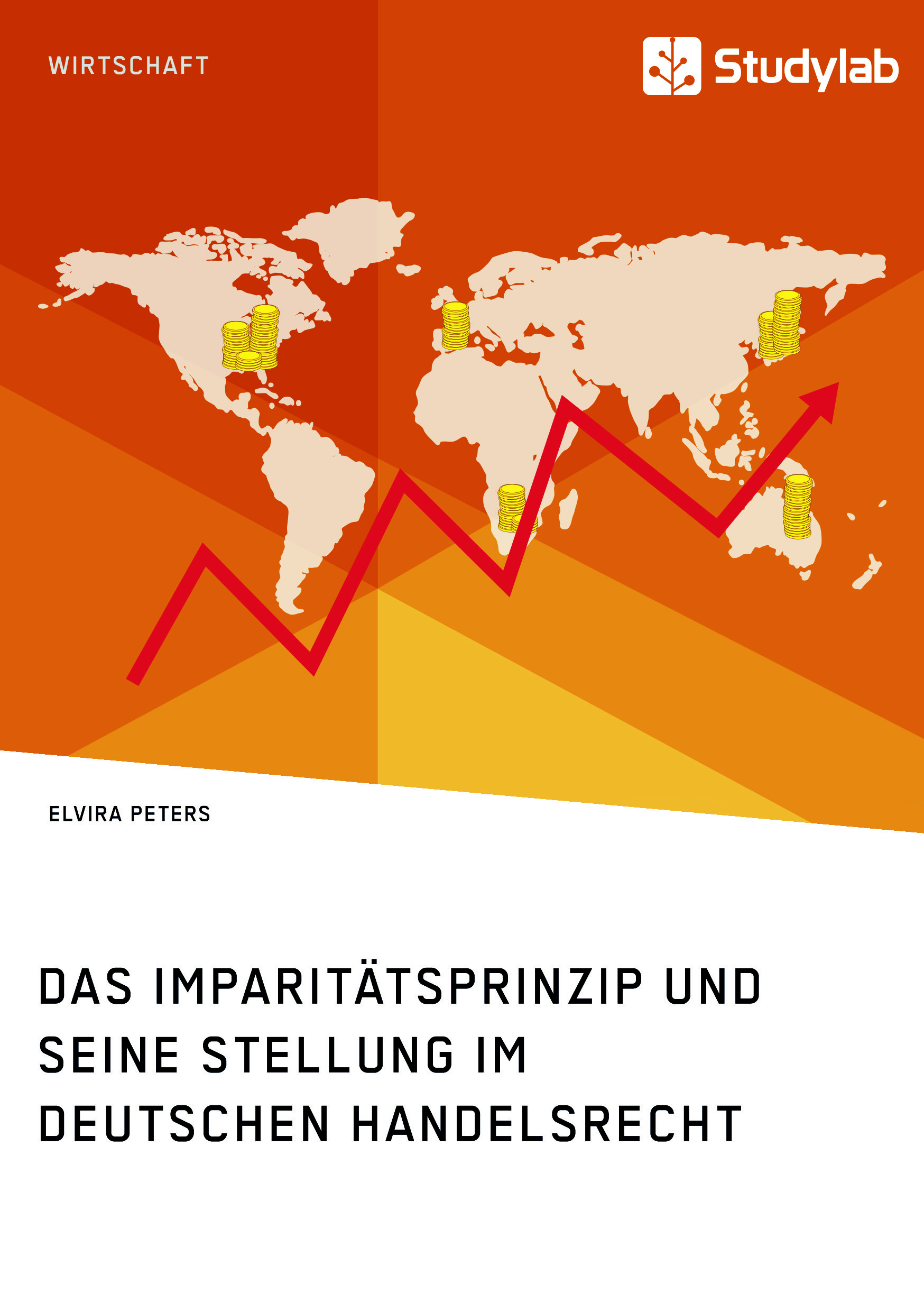Schon seit Jahrhunderten dienen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) als Grundpfeiler des Handelsrechts. Sie vervollständigen die Einzelvorschriften, dienen dazu, etwaige Regelungslücken des Bilanzrechts zu schließen und bieten dem Bilanzierenden im Zweifel eine Entscheidungsgrundlage.
Ein GoB mit langer Tradition ist das Imparitätsprinzip. Dieses verlangt, dass Gewinne erst zum Zeitpunkt ihrer tatsächlichen Realisierung erfasst werden, während für die Bilanzierung der Risiken und Verluste der Zeitpunkt ihrer Vorhersehbarkeit und Verursachung entscheidend ist.
Elvira Peters unternimmt in dieser Publikation eine kritische Analyse jenes Grundsatzes in Hinblick auf seine gegenwärtige Stellung im deutschen Handelsrecht. Die Autorin geht dabei auch der Frage nach, welche Tendenzen und Auswirkungen sich aus den letzten Gesetzesänderungen auf die Stellung und weitere Entwicklung des Imparitätsprinzips ableiten lassen.
Aus dem Inhalt:
- Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung;
- Handelsrecht;
- Imparitätsprinzip;
- Niederstbewertung;
- Jahresabschluss.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Definitorische Grundlagen
- 2.1 Begriff der GoB
- 2.2 Zwecke des Jahresabschlusses
- 2.3 Grundsatz des Imparitätsprinzips
- 2.4 Auslegung des Imparitätsprinzips
- 3 Imparitätsprinzip im System der GoB
- 3.1 Imparitätsprinzip im GoB-System nach Leffson und Moxter
- 3.2 Imparitätsprinzip im GoB-System nach Beatge
- 4 Ausprägungen des Imparitätsprinzips
- 4.1 Niederstwertprinzip im Anlagevermögen
- 4.2 Niederstwertprinzip im Umlaufvermögen
- 4.3 Höchstwertprinzip
- 4.4 Drohverlustrückstellungen
- 5 Beurteilung der gesetzlichen Reformen auf die Stellung des Imparitätsprinzips
- 6 Zusammenfassung und abschließende Beurteilung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Imparitätsprinzip im deutschen Handelsrecht. Ziel ist es, die definitorischen Grundlagen, die Stellung im System der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) und verschiedene Ausprägungen des Prinzips zu beleuchten. Weiterhin wird die Auswirkung gesetzlicher Reformen auf die Stellung des Imparitätsprinzips analysiert.
- Definitorische Klärung des Imparitätsprinzips und seiner Zwecke
- Stellung des Imparitätsprinzips innerhalb des GoB-Systems
- Untersuchung verschiedener Ausprägungen des Imparitätsprinzips (z.B. Niederstwertprinzip)
- Analyse der Auswirkungen gesetzlicher Reformen
- Gesamtbewertung der Bedeutung des Imparitätsprinzips im deutschen Handelsrecht
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Diese Einleitung führt in das Thema des Imparitätsprinzips im deutschen Handelsrecht ein und skizziert den Aufbau und die Zielsetzung der Arbeit. Sie umreißt die Bedeutung des Prinzips für die Erstellung eines ordnungsgemäßen Jahresabschlusses und stellt die zentralen Fragestellungen der Arbeit vor, die im weiteren Verlauf detailliert untersucht werden.
2 Definitorische Grundlagen: Dieses Kapitel legt die notwendigen Begrifflichkeiten fest. Es definiert den Begriff der GoB, erläutert die Zwecke eines Jahresabschlusses und beschreibt den Grundsatz des Imparitätsprinzips detailliert. Die verschiedenen Interpretationsmöglichkeiten des Imparitätsprinzips werden diskutiert und kritisch beleuchtet, um ein fundiertes Verständnis der theoretischen Basis zu schaffen, auf der die weitere Analyse aufbaut. Dies beinhaltet eine Auseinandersetzung mit der Literatur und verschiedenen Auffassungen zu dem Prinzip.
3 Imparitätsprinzip im System der GoB: Dieses Kapitel analysiert die Integration des Imparitätsprinzips in das System der GoB. Es vergleicht und kontrastiert unterschiedliche Auffassungen, wie das Imparitätsprinzip von verschiedenen Autoren wie Leffson und Moxter oder Beatge in das GoB-System eingeordnet wird. Die verschiedenen Perspektiven werden gegenübergestellt und kritisch bewertet, um die Komplexität und die unterschiedlichen Interpretationen des Imparitätsprinzips im Kontext der GoB aufzuzeigen. Der Fokus liegt darauf, die unterschiedlichen Positionen und deren Auswirkungen auf die Praxis zu beleuchten.
4 Ausprägungen des Imparitätsprinzips: Dieses Kapitel befasst sich mit den verschiedenen konkreten Ausprägungen des Imparitätsprinzips in der Praxis. Es beschreibt detailliert das Niederstwertprinzip im Anlage- und Umlaufvermögen sowie das Höchstwertprinzip und die Anwendung bei Drohverlustrückstellungen. Für jede Ausprägung werden die jeweiligen Regelungen, deren Anwendungsbereiche und die damit verbundenen Herausforderungen und Problemfelder erläutert. Die Kapitel beschreibt auch die Begründung und die Auswirkungen dieser Prinzipien auf die Bilanzierung.
5 Beurteilung der gesetzlichen Reformen auf die Stellung des Imparitätsprinzips: In diesem Kapitel wird der Einfluss von gesetzlichen Reformen auf die Stellung des Imparitätsprinzips untersucht. Es analysiert, wie sich Änderungen im Handelsrecht auf die Anwendung und die Bedeutung des Prinzips ausgewirkt haben. Der Fokus liegt auf der Bewertung der Auswirkungen dieser Reformen auf die Praxis der Bilanzierung und die damit verbundenen Herausforderungen. Die Analyse berücksichtigt sowohl die Intention der Gesetzgeber als auch die praktische Umsetzung.
Schlüsselwörter
Imparitätsprinzip, Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB), Jahresabschluss, Niederstwertprinzip, Höchstwertprinzip, Handelsrecht, gesetzliche Reformen, Bilanzierung, Anlagevermögen, Umlaufvermögen, Drohverlustrückstellungen.
FAQ: Imparitätsprinzip im deutschen Handelsrecht
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht das Imparitätsprinzip im deutschen Handelsrecht. Sie beleuchtet die definitorischen Grundlagen, die Stellung im System der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) und verschiedene Ausprägungen des Prinzips. Zusätzlich wird die Auswirkung gesetzlicher Reformen auf die Stellung des Imparitätsprinzips analysiert.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: die definitorische Klärung des Imparitätsprinzips und seiner Zwecke; die Stellung des Imparitätsprinzips innerhalb des GoB-Systems; die Untersuchung verschiedener Ausprägungen des Imparitätsprinzips (z.B. Niederstwertprinzip); die Analyse der Auswirkungen gesetzlicher Reformen; und die Gesamtbewertung der Bedeutung des Imparitätsprinzips im deutschen Handelsrecht.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit umfasst folgende Kapitel: Kapitel 1 (Einleitung): Einführung in das Thema und die Zielsetzung der Arbeit. Kapitel 2 (Definitorische Grundlagen): Definition der GoB, Zwecke des Jahresabschlusses, detaillierte Beschreibung des Imparitätsprinzips und Diskussion verschiedener Interpretationen. Kapitel 3 (Imparitätsprinzip im System der GoB): Analyse der Integration des Imparitätsprinzips in das GoB-System, Vergleich verschiedener Auffassungen von Autoren wie Leffson & Moxter und Beatge. Kapitel 4 (Ausprägungen des Imparitätsprinzips): Detaillierte Beschreibung des Niederstwertprinzips (Anlage- und Umlaufvermögen), des Höchstwertprinzips und der Anwendung bei Drohverlustrückstellungen. Kapitel 5 (Beurteilung der gesetzlichen Reformen): Untersuchung des Einflusses gesetzlicher Reformen auf die Stellung des Imparitätsprinzips und deren Auswirkungen auf die Bilanzierung. Kapitel 6 (Zusammenfassung und abschließende Beurteilung): Zusammenfassung der Ergebnisse und abschließende Bewertung der Bedeutung des Imparitätsprinzips.
Was sind die Schlüsselwörter der Arbeit?
Die Schlüsselwörter der Arbeit sind: Imparitätsprinzip, Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB), Jahresabschluss, Niederstwertprinzip, Höchstwertprinzip, Handelsrecht, gesetzliche Reformen, Bilanzierung, Anlagevermögen, Umlaufvermögen, Drohverlustrückstellungen.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, das Imparitätsprinzip im deutschen Handelsrecht umfassend zu untersuchen und ein tiefes Verständnis seiner definitorischen Grundlagen, seiner Stellung im GoB-System, seiner verschiedenen Ausprägungen und der Auswirkungen gesetzlicher Reformen darauf zu vermitteln.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Studierende der Wirtschaftswissenschaften, insbesondere der Betriebswirtschaftslehre, sowie für Fachleute im Bereich Rechnungswesen und Wirtschaftsprüfung, die sich mit den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung und der Bilanzierung auseinandersetzen.
- Quote paper
- Elvira Peters (Author), 2016, Das Imparitätsprinzip und seine Stellung im deutschen Handelsrecht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/381396