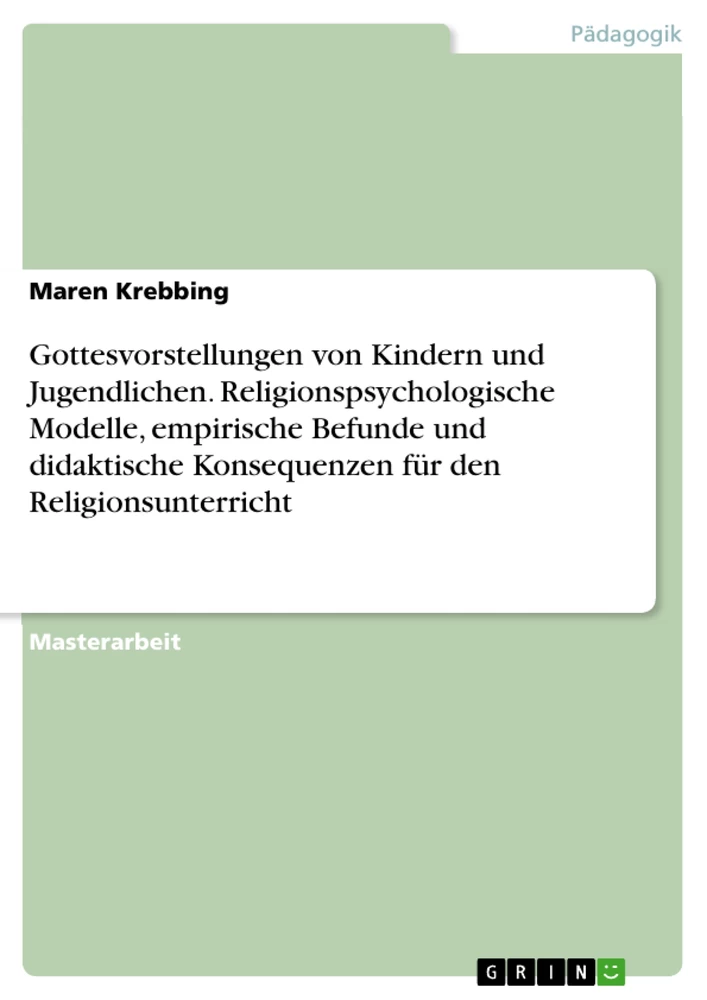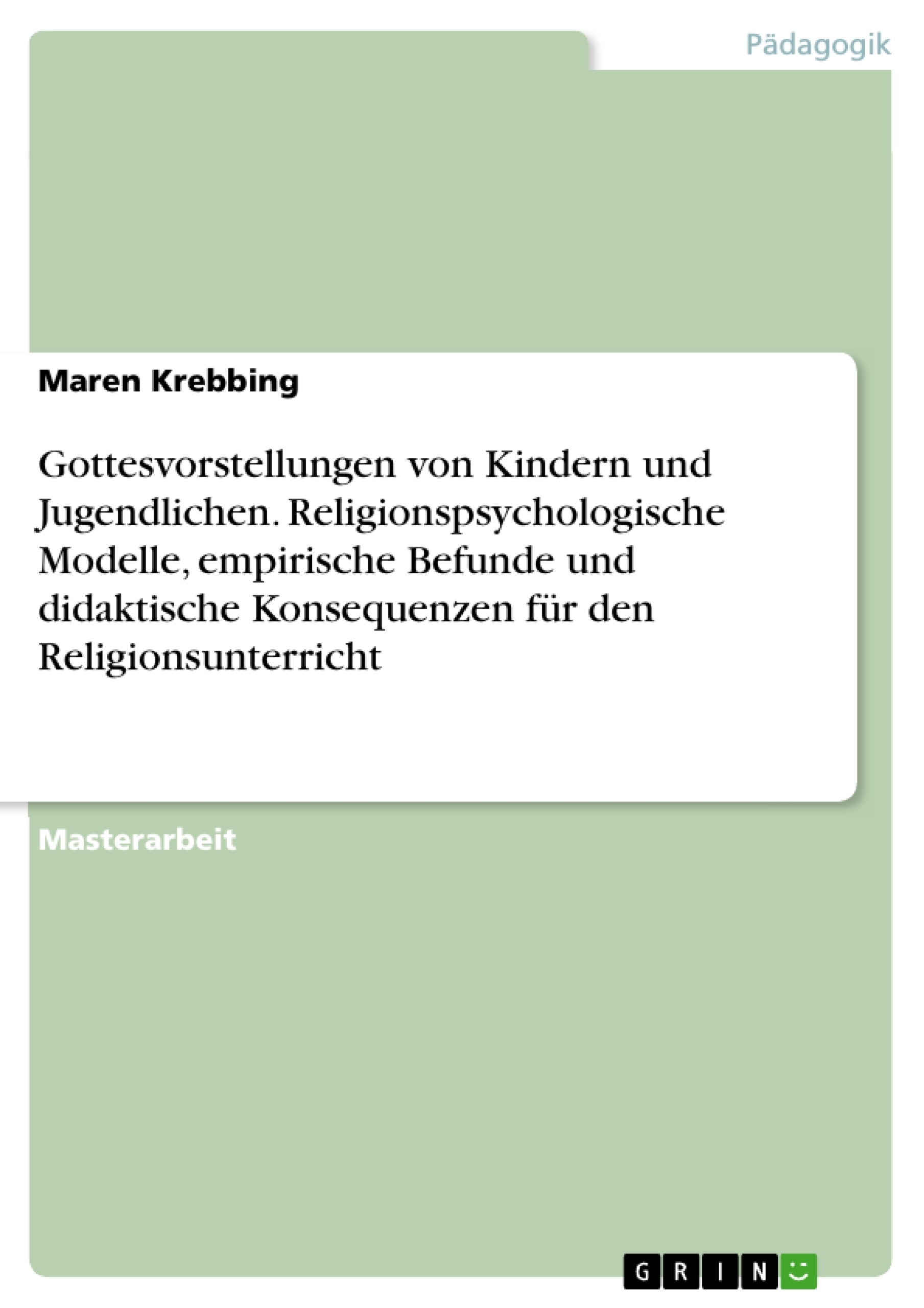Im ersten Teil dieser Arbeit soll zunächst erläutert werden, wie Gottesvorstellungen definiert und in Bezug zu anderen Begriffen abgegrenzt werden können. Im weiteren Schritt soll geklärt werden, welche Bedeutung religiöse Sozialisation für die Entwicklung von Gottesvorstellungen bei Kindern und Jugendlichen hat.
Hierzu werden bedeutsame Lernorte der religiösen Sozialisation wie beispielsweise die Familie, Kirche und Schule mit ihren jeweiligen Aufgaben erläutert.
Der dritte Teil dieser Arbeit beschäftigt sich mit Gottesvorstellungen von Kindern und Jugendlichen aus theoretischer und praktischer Sicht. Hierzu werden neben traditionellen Modellen aus der Entwicklungspsychologie auch neuere empirische Untersuchungen herangezogen. In der Entwicklungspsychologie wird seit längerer Zeit die religiöse Entwicklung von Menschen untersucht. Dabei wurden bereits verschiedene Stufenmodelle entwickelt, die genau diese Entwicklung darstellen. Da die jeweiligen Entwicklungsstufen einen Einfluss auf die Veränderungen in den Gottesvorstellungen haben können, werde ich in dieser Arbeit auf die Stufenmodelle von James W. Fowler sowie von Fritz Oser und Paul Gmünder eingehen. In den letzten 20 Jahren wurden zudem immer wieder empirische Untersuchungen gemacht, die die Gottesvorstellungen von Kindern und Jugendlichen darstellen.
Aus diesem Grund werden auch aus diesen ausgewählte Untersuchungen von Arnold et al., Hanisch, Bucher und Klein erläutert und kritisch reflektiert. Im weiteren Schritt werden in Bezug auf die Ergebnisse der Untersuchungen religionspädagogische Konsequenzen für den Religionsunterricht aufgezeigt. In diesem Teil der Arbeit stellt sich die Frage, welche Aufgaben Religionsunterricht in Bezug auf die Begleitung der Kinder und Jugendlichen hat, welche Rolle die Lehrperson einnimmt und inwieweit die Kindertheologie zur religionspädagogischen Begleitung beitragen kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Gottesvorstellungen
- Definition
- Verhältnis von Gottesvorstellung, Gottesbild und Gottesbeziehung
- Gottesbilder und religiöse Sozialisation
- Kind und Glaube
- Lernorte religiöser Sozialisation
- Familie
- Kirche
- Schule
- Empirische Befunde der Glaubensentwicklung und Gottesvorstellungen von Kindern und Jugendlichen
- Modelle aus der Entwicklungspsychologie
- Entwicklungsstufen nach James W. Fowler
- Entwicklungsstufen des religiösen Urteils nach Oser/ Gmünder
- Parallelen und Unterschiede der Stufenmodelle
- Anfragen und kritische Diskussion
- Ergebnisse empirischer Untersuchungen zu Gottesvorstellungen
- Ursula Arnold/ Helmut Hanisch/ Gottfried Orth
- Anton A. Bucher
- Helmut Hanisch
- Stefanie Klein
- Zusammenfassung der Forschungsergebnisse und kritische Diskussion
- Religionspädagogische Konsequenzen für den Religionsunterricht
- Die Bedeutung der Ergebnisse für den Religionsunterricht
- Aufgaben von Religionsunterricht angesichts religiöser Pluralität
- Aufgaben einer religionspädagogischen Begleitung bei der Entwicklung des Gottesbildes von Kindern und Jugendlichen
- Die Rolle der Lehrperson und die Bedeutung der eigenen Gottesvorstellung
- Kinder- und Jugendtheologie - Möglichkeiten und Grenzen
- Entwicklung der Kinder- und Jugendtheologie
- Theologie von, für und mit Kindern und Jugendlichen
- Methoden
- Grenzen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Gottesvorstellungen von Kindern und Jugendlichen und analysiert deren Entwicklung im Hinblick auf die religionspädagogischen Konsequenzen für den Religionsunterricht. Die Arbeit beleuchtet die unterschiedlichen Ansätze in der Entwicklungspsychologie und empirischen Forschung und stellt deren Bedeutung für den Religionsunterricht dar.
- Die Entwicklung von Gottesvorstellungen bei Kindern und Jugendlichen
- Die Rolle der religiösen Sozialisation in der Familie, Kirche und Schule
- Die Bedeutung empirischer Untersuchungen für die religionspädagogische Praxis
- Die Aufgaben des Religionsunterrichts im Umgang mit der Vielfalt von Gottesvorstellungen
- Das Konzept der Kinder- und Jugendtheologie als Ansatz zur Förderung theologischen Denkens
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Thematik der Gottesvorstellungen von Kindern und Jugendlichen im Kontext des Religionsunterrichts vor und gibt einen Überblick über die Struktur der Arbeit. Kapitel 2 beleuchtet die Definition des Begriffs "Gottesvorstellung" und setzt diesen in Beziehung zu den Begriffen "Gottesbild" und "Gottesbeziehung". In Kapitel 3 wird die Bedeutung der religiösen Sozialisation für die Entwicklung von Gottesvorstellungen analysiert und verschiedene Lernorte der religiösen Sozialisation - Familie, Kirche und Schule - werden im Detail betrachtet.
Kapitel 4 beschäftigt sich mit den empirischen Befunden zur Glaubensentwicklung und Gottesvorstellung von Kindern und Jugendlichen. Hierzu werden zunächst zwei bedeutende Stufenmodelle aus der Entwicklungspsychologie - die Stufenmodelle von James W. Fowler und Fritz Oser/ Paul Gmünder - vorgestellt und kritisch diskutiert. Im weiteren Schritt werden die Ergebnisse ausgewählter empirischer Untersuchungen von Arnold et al., Bucher, Hanisch und Klein zusammengefasst und reflektiert.
Kapitel 5 widmet sich den religionspädagogischen Konsequenzen der dargestellten Untersuchungen für den Religionsunterricht. Dabei werden die Bedeutung der Ergebnisse für die Unterrichtspraxis, die Aufgaben des Religionsunterrichts angesichts religiöser Pluralität sowie die Aufgaben einer religionspädagogischen Begleitung bei der Entwicklung des Gottesbildes von Kindern und Jugendlichen beleuchtet. Abschließend wird das Konzept der Kinder- und Jugendtheologie als ein möglicher Ansatz zur Förderung theologischen Denkens bei Kindern und Jugendlichen vorgestellt.
Schlüsselwörter
Gottesvorstellungen, Gottesbild, Gottesbeziehung, religiöse Sozialisation, Entwicklungspsychologie, Stufenmodelle, empirische Untersuchungen, Religionsunterricht, religionspädagogische Praxis, Kindertheologie, Jugendtheologie
- Quote paper
- Maren Krebbing (Author), 2017, Gottesvorstellungen von Kindern und Jugendlichen. Religionspsychologische Modelle, empirische Befunde und didaktische Konsequenzen für den Religionsunterricht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/381267