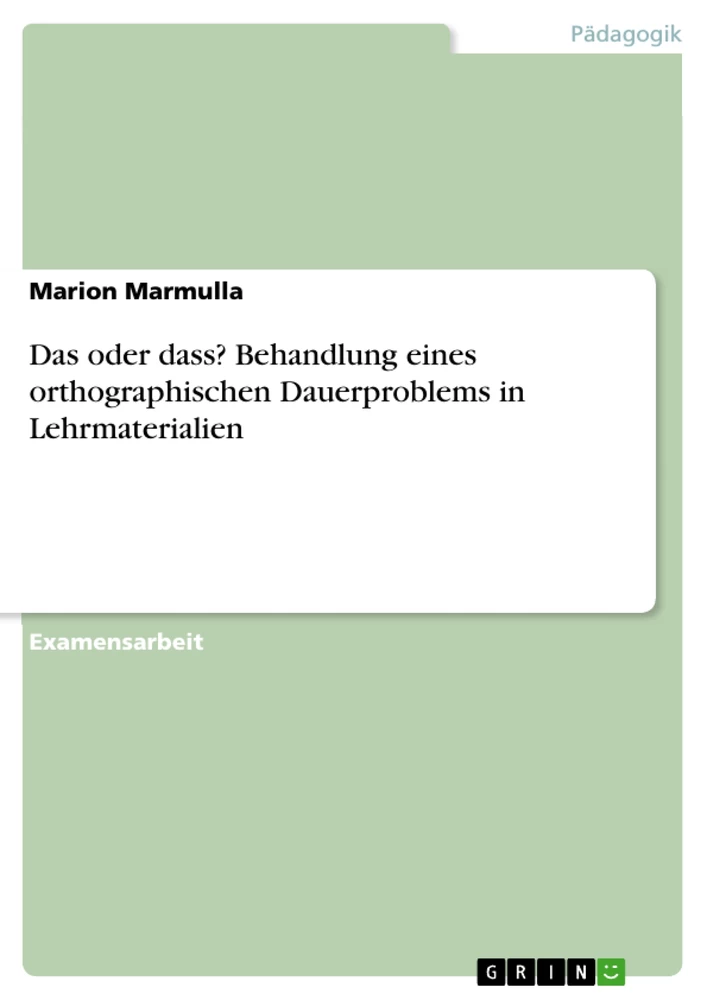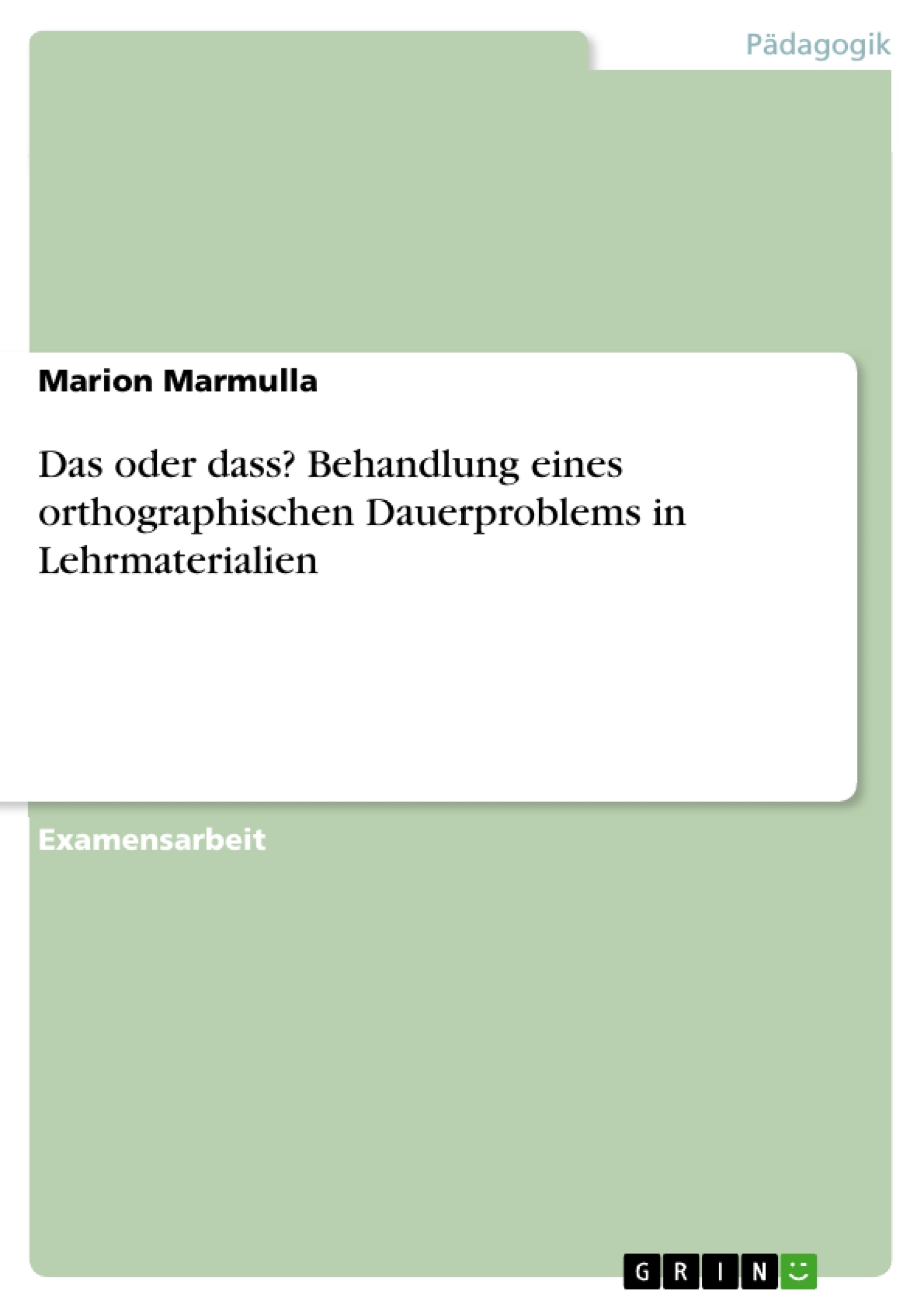In den Vorüberlegungen zu einer Reform der deutschen Rechtschreibung schreibt Peter Eisenberg, dass es schwierig sei, für eine Schrift wie die des Deutschen zu entscheiden, welche Regelungen Vereinfachungen mit sich bringen und welche nicht. Er bezieht dies unter anderem auf die Regelung, unter welchen Bedingungen die verschiedenen s-Laute s, ss und ß verwendet werden.
Im Zuge der Rechtschreibreformen von 1996 und 2006 wurde das ß der Konjunktion "daß" durch ss ersetzt, um die Regel „ss-Schreibung nach kurzem Selbstlaut“ zur Vereinfachung durchgängig einheitlich zu gestalten. Reformvorschläge, die Unterscheidungsschreibung komplett aufzuheben, scheiterten spätestens mit dem Argument des besseren und schnelleren Leseverständnisses.
Diese Vereinheitlichung hat aber die Fehleranzahl bei der Unterscheidungsschreibung von "das/dass" keineswegs verringert; nach wie vor gilt, dass das Wörtchen "dass" bis heute das mit Abstand am häufigsten falsch geschriebene Einzelwort der deutschen Sprache geblieben ist.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einführung
- 2 Sprachwissenschaftliche Hintergründe
- 2.1 Sprachhistorie des s-Lautes
- 2.2 Entstehung von untergeordneten Nebensätzen
- 2.3 Entstehung der das/dass-Heterographie
- 2.4 Vergleich mit anderen Sprachen
- 3 Funktion und Semantik von das und dass
- 3.1 Der Artikel das
- 3.2 Das Pronomen das
- 3.3 Zur Semantik der Nebensätze mit dass
- 3.4 Die Subjunktion dass
- 4 Problemanalyse und Fehlerbestimmung
- 4.1 Kognitiver Lernprozess von Schülern
- 4.1.1 Schüler im Grundschulalter
- 4.1.2 Schüler der Sekundarstufe I und II
- 4.2 Regeln: Kommasetzung und Ersatzprobe
- 4.3 Kontrollhypothese versus Verwechslungshypothese
- 4.4 Textverstehen/Leseverstehen
- 4.5 Zusammenfassung und weiterführende Fragestellungen
- 4.1 Kognitiver Lernprozess von Schülern
- 5 Untersuchung der Sprachbücher
- 5.1 Vorgehensweise
- 5.2 Tabellen und Ergebnisse
- 5.3 Diskussion der Sprachbuchuntersuchung
- 6 Didaktische Problemlöseansätze in der Literatur
- 6.1 Strategien in der Grundschule nach Kluge/Kluge
- 6.2 Strategien in der Sekundarstufe I und II
- 6.2.1 Grammatikwerkstatt von Menzel
- 6.2.2 Didaktischer Ansatz von Sewig
- 7 Wege zu einer erfolgreichen „Didaktik der Heterographie“
- 7.1 Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse
- 7.1.1 Bedeutsamkeit der Subjunktion
- 7.1.2 Stand und Diskussion der Didaktik
- 7.1.3 Zusammenfassung
- 7.2 Idee einer,,alternativen Didaktik“
- 7.1 Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse
- 8 Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit der grammatischen und orthografischen Unterscheidung von „das“ und „dass“ im Deutschen. Ziel ist es, die Herausforderungen bei der Vermittlung dieser Heterographie in Lehrmaterialien zu untersuchen und didaktische Lösungsansätze zu analysieren.
- Sprachwissenschaftliche Hintergründe der das/dass-Schreibung
- Funktion und Semantik von „das“ und „dass“
- Problemanalyse und Fehlerbestimmung bei der Unterscheidungsschreibung
- Analyse von Lehrmaterialien zur Vermittlung der das/dass-Heterographie
- Didaktische Ansätze zur erfolgreichen Vermittlung der Unterscheidungsschreibung
Zusammenfassung der Kapitel
Im ersten Kapitel wird eine Einführung in die Problematik der das/dass-Schreibung gegeben. Kapitel 2 beleuchtet die sprachwissenschaftlichen Hintergründe der Unterscheidungsschreibung und betrachtet die Entstehung des s-Lautes, die Entwicklung von Nebensätzen und die historische Entstehung der Heterographie. Kapitel 3 beschäftigt sich mit der Funktion und Semantik von „das“ und „dass“, wobei sowohl der Artikel als auch das Pronomen „das“ sowie die Subjunktion „dass“ betrachtet werden. Kapitel 4 untersucht die Fehlerquellen bei der Unterscheidungsschreibung und beleuchtet den kognitiven Lernprozess von Schülern sowie verschiedene Regeln und Theorien zur Fehleranalyse. Kapitel 5 analysiert ausgewählte Sprachbücher und präsentiert die Ergebnisse der Untersuchung.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Arbeit konzentriert sich auf die Themenbereiche deutsche Orthografie, Heterographie, das/dass-Schreibung, Sprachbuchforschung, Didaktik, Fehleranalyse, Lernprozess, Sprachwissenschaft, Semantik, Subjunktion, Artikel, Pronomen.
- Citar trabajo
- Marion Marmulla (Autor), 2011, Das oder dass? Behandlung eines orthographischen Dauerproblems in Lehrmaterialien, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/380612