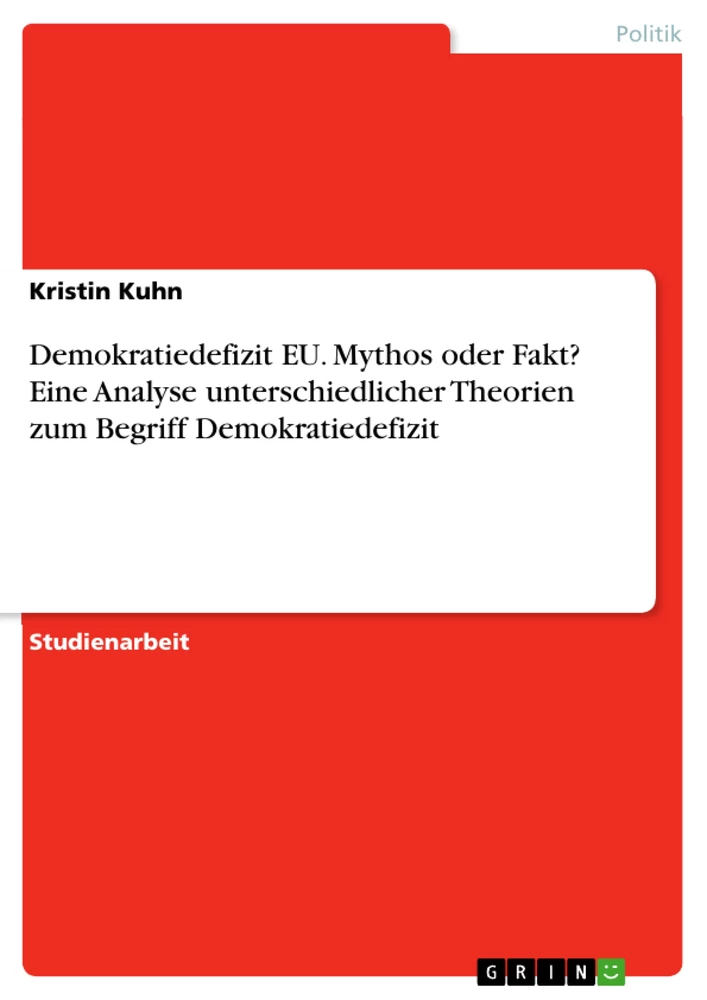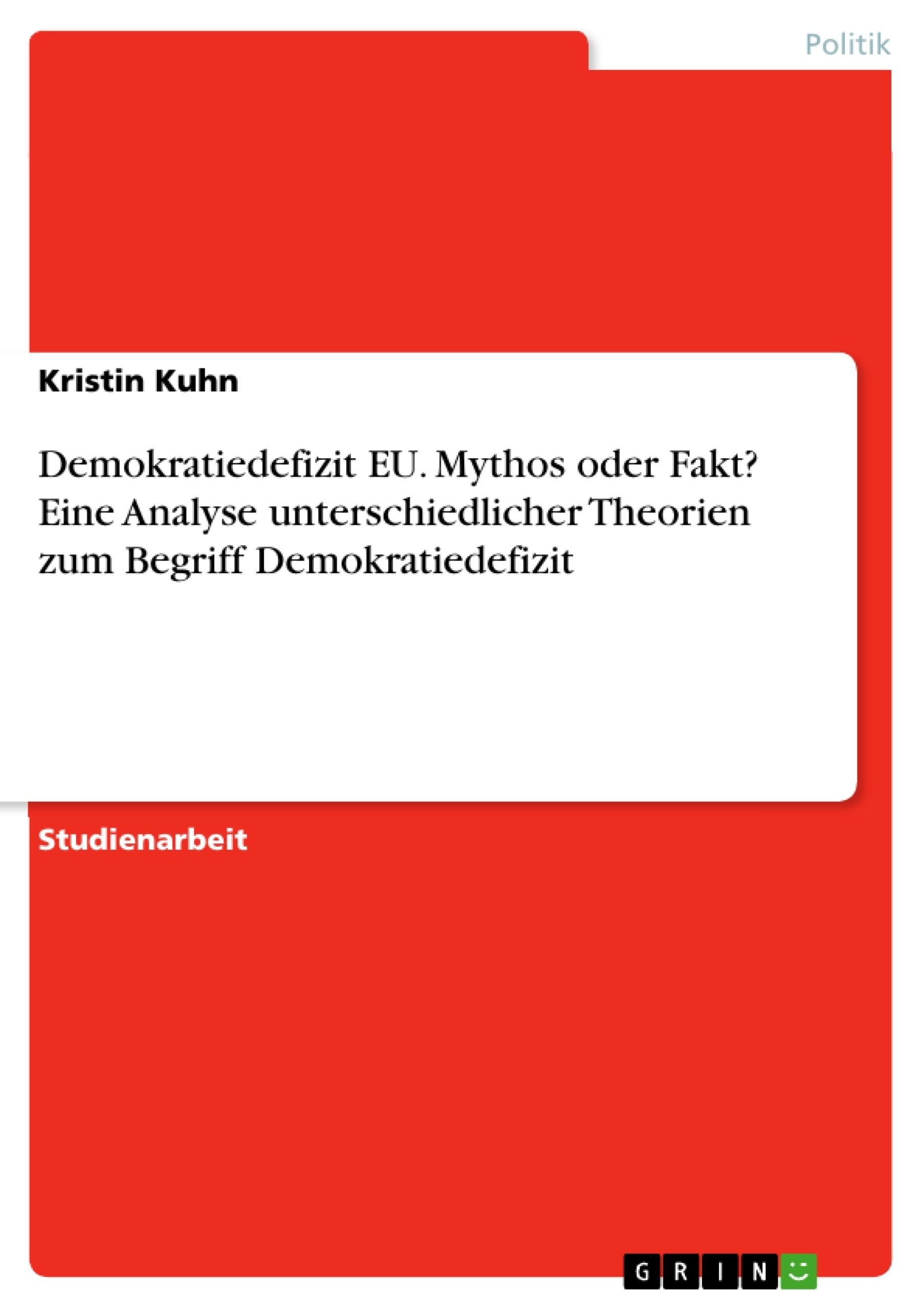Mit dem Vertrag von Lissabon hat die EU versucht, anhand EU-Reformen dem Problem des Demokratiedefizits entgegenzuwirken. Der Vertrag von Lissabon solle die demokratische Legitimation und Arbeitseffizienz erhöhen sowie eine klare Aufgabenverteilung innerhalb der EU-Institutionen gewährleisten. Die Europäische Union leide an einem Demokratiedefizit. Europa müsse handlungsfähiger und transparenter werden. Doch können die Punkte Handlungsfähigkeit und Transparenz überhaupt an einem Strang ziehen?
Bereits seit dem Entstehen der Europäischen Union muss sie sich den Vorwürfen fehlender Demokratie stellen. Mit Unterzeichnung des Maastricht-Vertrages hat sich die Wahrnehmung der Bürgerinnen und Bürger in Bezug auf die europäische Politik gewandelt. Der „permissive Konsens“ hat angefangen sich aufzulösen. Seitdem leidet die EU bis heute an fehlender Zustimmung ihrer EU-Bürger. Dies lässt sich insbesondere auch an der mangelnden Wahlbeteiligung bei den Europawahlen festmachen.
Ziel dieser Hausarbeit ist es, die Debatte über das Demokratiedefizit wiederzugeben. Hier stellt sich die Frage, ob ein solches Demokratiedefizit in der EU überhaupt vorhanden ist oder ob es sich dabei lediglich um eine Legitimationskrise handle. Dabei soll der Begriff Demokratiedefizit charakterisiert und analysiert werden. Die Arbeit verweist auf ein Analyseraster, welches Positionen zum Demokratiedefizit verschiedener Autoren darstellen soll. Die Theorien der einzelnen Autoren werden vorgestellt und verglichen, abschließend soll ein Fazit gezogen werden. Können alle Autoren mit Ihren Theorien richtig liegen oder bleibt die EU ein Konstrukt, welches noch lange gänzlich unerforscht ist?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Demokratiedefizit der Europäischen Union - Mythos oder Fakt?
- Strukturelle Defizite
- Institutionelle Defizite
- Autoren
- Majone
- Moravcsik
- Føllesdal /Hix
- Gegenüberstellung der einzelnen Autoren nach Armin Schäfer
- Der Vertrag von Lissabon - Fortschritt der Demokratisierung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Debatte um das Demokratiedefizit der Europäischen Union. Sie analysiert, ob ein solches Defizit tatsächlich existiert oder ob es sich lediglich um eine Legitimationskrise handelt. Der Begriff „Demokratiedefizit“ wird charakterisiert und anhand des Lissabonner Vertrags geprüft, ob eine Behebung möglich ist. Die Arbeit vergleicht die Theorien verschiedener Autoren zum Thema und zieht ein abschließendes Fazit.
- Charakterisierung des Begriffs „Demokratiedefizit“
- Analyse struktureller und institutioneller Defizite der EU
- Vergleichende Betrachtung der Theorien verschiedener Autoren zum Demokratiedefizit
- Bewertung des Lissabonner Vertrags im Hinblick auf die Bekämpfung des Demokratiedefizits
- Abschließende Beurteilung der Frage nach dem Vorhandensein eines Demokratiedefizits in der EU
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung zitiert Angela Merkel und führt in die Thematik des Demokratiedefizits der EU ein. Sie erwähnt den Vertrag von Lissabon als Reformversuch und die langjährige Kritik an mangelnder demokratischer Legitimation der EU. Die Arbeit formuliert ihr Ziel, die Debatte über das Demokratiedefizit darzustellen und zu untersuchen, ob es sich tatsächlich um ein Defizit oder nur um eine Legitimationskrise handelt. Sie skizziert die Methodik, die auf der Analyse verschiedener Autorentheorien und des Lissabonner Vertrags basiert.
Demokratiedefizit der Europäischen Union - Mythos oder Fakt?: Dieses Kapitel erörtert den Begriff "Demokratiedefizit" und dessen historische Entwicklung im Kontext der Europäischen Gemeinschaft. Es beleuchtet das Problem der fehlenden Volkssouveränität bei der EU im Vergleich zu Nationalstaaten und diskutiert dennoch Aspekte demokratischer Legitimation, beispielsweise durch den Einfluss des Europäischen Parlaments. Es leitet zur Unterscheidung zwischen strukturellen und institutionellen Defiziten über.
Autoren: Dieses Kapitel stellt die unterschiedlichen Positionen verschiedener Autoren zur Frage des Demokratiedefizits dar. Es beleuchtet die jeweiligen Verständnis von Demokratie und EU und ihren Ansatz zur Beurteilung der Legitimität der EU-Institutionen. Es werden die Perspektiven von Majone, Moravcsik und Follesdal vorgestellt, die unterschiedliche Schwerpunkte setzen (z.B. Machtmissbrauch vs. nationale Parlamente als Legitimationsquelle).
Schlüsselwörter
Demokratiedefizit, Europäische Union, Lissabonner Vertrag, Legitimation, Institutionelle Defizite, Strukturelle Defizite, Europäisches Parlament, Demokratietheorie, Volkssouveränität, Machtmissbrauch, Partizipation.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Demokratiedefizit der Europäischen Union - Mythos oder Fakt?
Was ist der Gegenstand der Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Debatte um das Demokratiedefizit der Europäischen Union. Sie analysiert, ob ein solches Defizit tatsächlich existiert oder ob es sich lediglich um eine Legitimationskrise handelt. Dabei wird der Begriff "Demokratiedefizit" charakterisiert und anhand des Lissabonner Vertrags geprüft, ob eine Behebung möglich ist. Die Arbeit vergleicht die Theorien verschiedener Autoren zum Thema und zieht ein abschließendes Fazit.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit der Charakterisierung des Begriffs "Demokratiedefizit", der Analyse struktureller und institutioneller Defizite der EU, dem Vergleich verschiedener Autorentheorien zum Demokratiedefizit, der Bewertung des Lissabonner Vertrags im Hinblick auf die Bekämpfung des Demokratiedefizits und einer abschließenden Beurteilung der Frage nach dem Vorhandensein eines Demokratiedefizits in der EU.
Welche Autoren werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit stellt die unterschiedlichen Positionen von Majone, Moravcsik und Føllesdal/Hix zur Frage des Demokratiedefizits dar. Es werden deren jeweilige Verständnis von Demokratie und EU und ihren Ansatz zur Beurteilung der Legitimität der EU-Institutionen beleuchtet. Die Gegenüberstellung erfolgt nach Armin Schäfer.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zum Demokratiedefizit (Mythos oder Fakt?), ein Kapitel zu den verschiedenen Autoren, ein Kapitel zum Vertrag von Lissabon und ein Fazit. Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt die Methodik. Das Kapitel zum Demokratiedefizit erklärt den Begriff und unterscheidet zwischen strukturellen und institutionellen Defiziten. Das Autorenteil stellt verschiedene Perspektiven dar. Das Kapitel zum Lissabonner Vertrag bewertet dessen Auswirkungen auf das Demokratiedefizit. Das Fazit fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Rolle spielt der Vertrag von Lissabon?
Der Vertrag von Lissabon wird als Reformversuch zur Behebung des möglichen Demokratiedefizits untersucht. Die Arbeit prüft, inwiefern der Vertrag zu einem Fortschritt der Demokratisierung beigetragen hat.
Was sind die zentralen Schlussfolgerungen der Arbeit?
Die Arbeit kommt zu einer abschließenden Beurteilung der Frage, ob ein Demokratiedefizit in der EU existiert. Die konkreten Schlussfolgerungen sind im Fazit der Arbeit zusammengefasst.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Arbeit?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Demokratiedefizit, Europäische Union, Lissabonner Vertrag, Legitimation, institutionelle Defizite, strukturelle Defizite, Europäisches Parlament, Demokratietheorie, Volkssouveränität, Machtmissbrauch und Partizipation.
- Quote paper
- Kristin Kuhn (Author), 2017, Demokratiedefizit EU. Mythos oder Fakt? Eine Analyse unterschiedlicher Theorien zum Begriff Demokratiedefizit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/380594