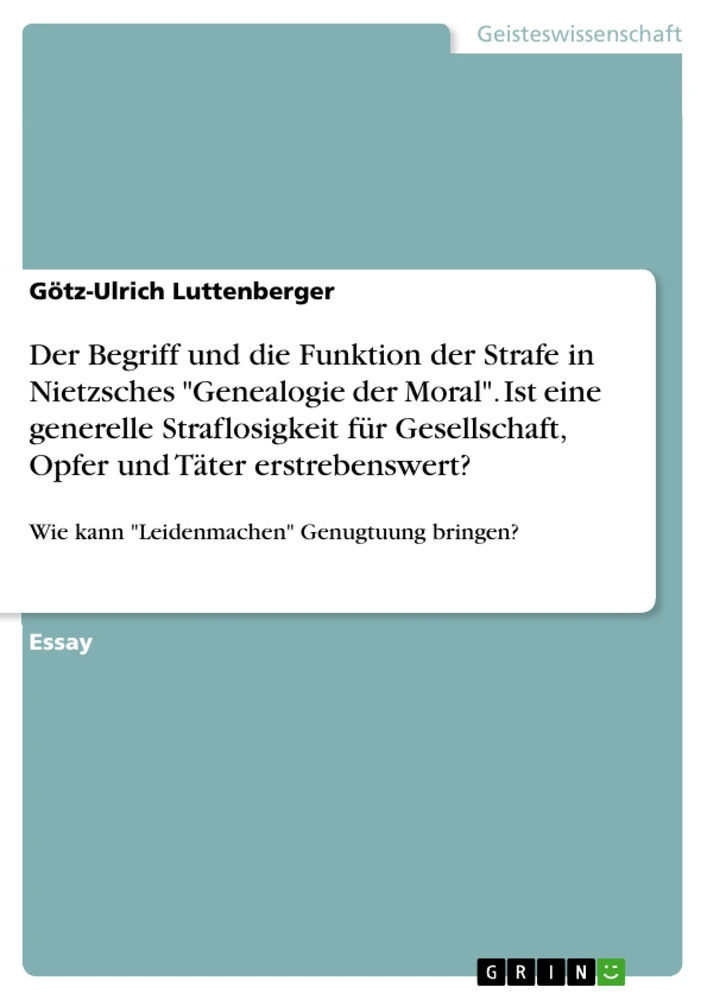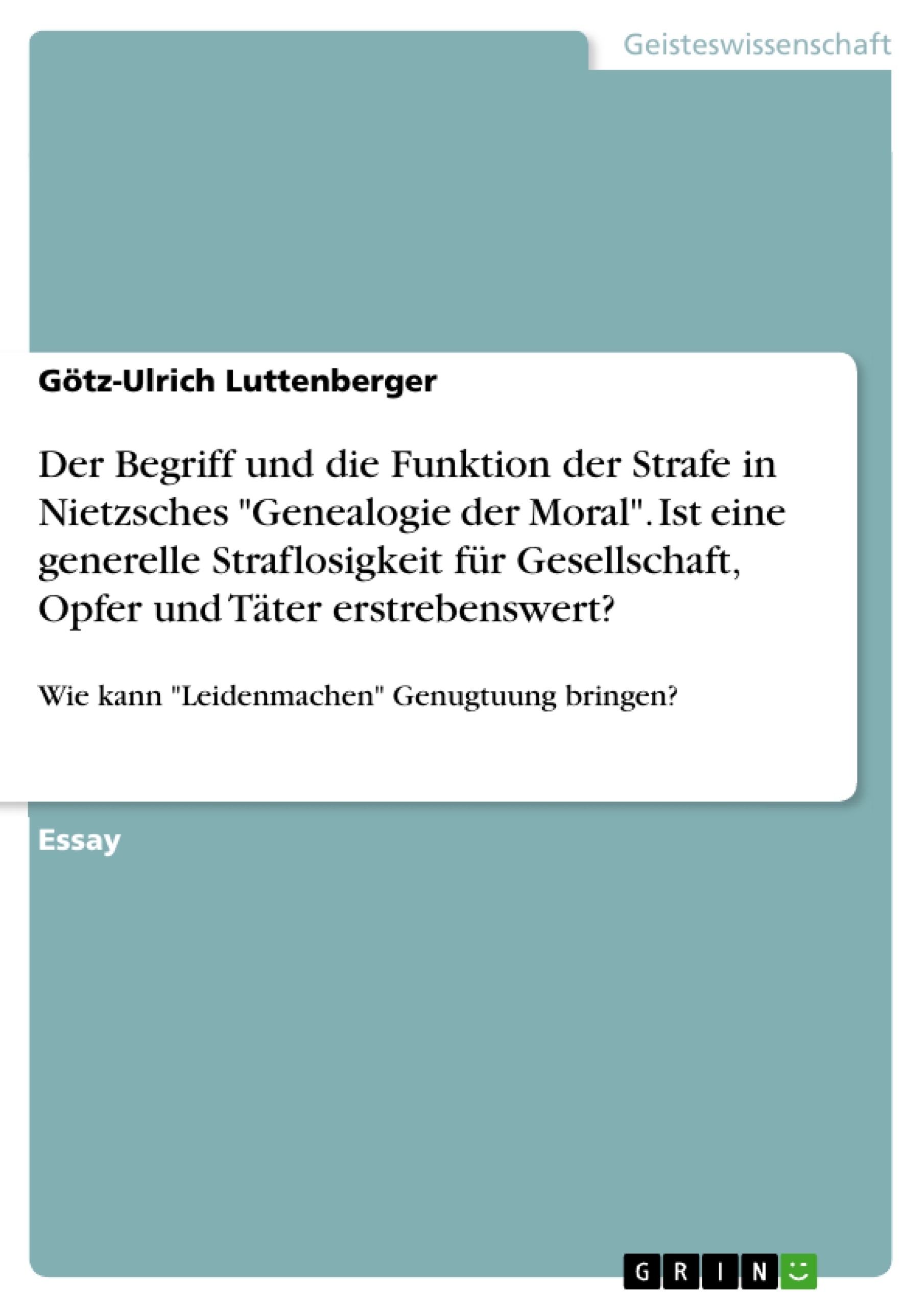Die Arbeit setzt sich mit Nietzsches „Genealogie der Moral“ auseinander. Sie stellt die Behauptung Nietzsches auf den Prüfstand, wonach es für eine Gesellschaft das Vornehmste wäre, wenn sie ihre Schädiger straflos ließe. Der Autor stellt zunächst die zweite Abhandlung „Schuld“, „schlechtes Gewissen“ und "Verwandtes" vor und geht sodann auf den Begriff und die Funktion des Strafens im Laufe der menschlichen Entwicklungsgeschichte ein. Dann wird untersucht, ob aus Sicht des Opfers, der Gesellschaft und des Täters eine generelle Straflosigkeit erstrebenswert ist. Im Ergebnis verneint Luttenberger, dass – wie Nietzsche behauptet – generelle Straflosigkeit erstrebenswert ist. Denn eine Bestrafung kommt allen Beteiligten- sogar dem Täter zu Gute. Strafe ist in einer freien Gesellschaft unverzichtbar, weil ansonsten die Regelungsdichte und der Gesetzesvollzug so groß sein müssten, dass es zu Gesetzesverstößen erst gar nicht kommen kann.
Mit seiner Streitschrift „Zur Genealogie der Moral.“ beschreibt Friedrich Nietzsche die Entstehung und Interessengebundenheit von Moral. Es geht in erster Linie nicht um die philosophische Auseinandersetzung mit ethischen Normen sondern um deren geschichtliche Herleitung. Gleichwohl geschieht das nicht historisch-wissenschaftlich, leidenschaftslos sondern – wie bereits der Untertitel „Eine Streitschrift“ vermuten lässt – im Kampf gegen unsere „moralischen Vorurtheile“. Vor diesem Hintergrund ist es nicht verwunderlich, dass Nietzsche nicht nach einer philosophischen Begründung für Moral sucht. Es geht ihm nicht um die Frage, warum der Mensch so oder so handeln soll. Vielmehr fragt er nach dem geschichtlichen, kulturellen und auch psychologischen Ursprung von Moral mit dem Ziel, „zur wirklichen Historie der Moral“ vorzudringen.
Inhaltsverzeichnis
- Einordnung der Streitschrift Nietzsches „Zur Genealogie der Moral.“
- Die Zweite Abhandlung: „Schuld“, „schlechtes Gewissen“ und Verwandtes.
- Vergesslichkeit
- Verantwortlichkeit und Gewissen
- Schuld und Strafe
- Macht, Gerechtigkeit und Straferleichterung, Straflosigkeit.
- Begriff und Funktion von Strafe
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Frage, wie das Leidenmachen des Täters zur Genugtuung der Gesellschaft und des Opfers beitragen kann, und analysiert dabei die Argumentation Nietzsches in seiner Streitschrift „Zur Genealogie der Moral.“ Im Zentrum steht die Frage nach der Funktion von Strafe und deren historischer Entwicklung, wobei die zweite Abhandlung mit den Themen „Schuld“, „schlechtes Gewissen“ und „Vergesslichkeit“ im Vordergrund steht.
- Entstehung und Entwicklung des Moralbegriffs
- Die Rolle der Vergesslichkeit und die Entwicklung von Gedächtnis
- Verantwortlichkeit und Gewissen als Resultat von Übung und Gebrauch
- Der Zusammenhang zwischen Schuld und Strafe im Kontext des ökonomischen Tauschhandels
- Die Frage nach der Berechtigung und Funktion von Strafe aus unterschiedlichen Perspektiven
Zusammenfassung der Kapitel
Die zweite Abhandlung von Nietzsches „Zur Genealogie der Moral“ beginnt mit einer Diskussion über die Vergesslichkeit, die er als essentielle Eigenschaft des Gehirns beschreibt. Nietzsche argumentiert, dass die Vergesslichkeit notwendig ist, um Platz für Neues zu schaffen, und gleichzeitig ein Gegenvermögen für Versprechungen entwickelt, die in der Zukunft liegen. Die Entwicklung des Gedächtnisses wird mit Schmerzen und Qualen in Verbindung gebracht, die das Individuum zum Erinnern zwingen.
Verantwortlichkeit, so Nietzsche, ist ein Ergebnis von Übung und Gebrauch, die den Menschen „berechenbar“ machen. Die Regelmäßigkeit, mit der ein Mensch seine Versprechungen einhält, führt zur Entstehung eines Gewissens.
Nietzsche leitet den Begriff der Schuld vom Wort „Schulden“ ab und verortet ihn im ökonomischen Tauschhandel. Das Äquivalenz-Prinzip findet sich sowohl im privaten Obligationenrecht, im zivilen Deliktsrecht und im staatlichen Strafrecht wieder. Für den Fall, dass ein Schuldner sein Leistungsversprechen nicht einhält, erlangt der Gläubiger „Herren-Rechte“ über diesen und kann ihn strafen. Im Strafrecht sieht Nietzsche den Äquivalenzgedanken ebenfalls verwirklicht: Der Gesetzbrecher muss für sein Vergehen „zahlen“, um einen Ausgleich herzustellen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit widmet sich den zentralen Themen der Entstehung und Entwicklung von Moral, Schuld und Strafe, sowie deren Bedeutung in der Gesellschaft. Dabei werden die philosophischen Positionen Nietzsches, insbesondere seine Kritik an der traditionellen Moralvorstellung und die Bedeutung von Vergesslichkeit und Gedächtnis, untersucht. Die zentrale Frage ist, wie der Mensch mit Schuld und Strafe umgehen soll und ob Straflosigkeit ein erstrebenswertes Ziel ist. Die Untersuchung umfasst auch die Analyse des Äquivalenz-Prinzips im Kontext von Schuld und Strafe.
- Citar trabajo
- Götz-Ulrich Luttenberger (Autor), 2017, Der Begriff und die Funktion der Strafe in Nietzsches "Genealogie der Moral". Ist eine generelle Straflosigkeit für Gesellschaft, Opfer und Täter erstrebenswert?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/380307