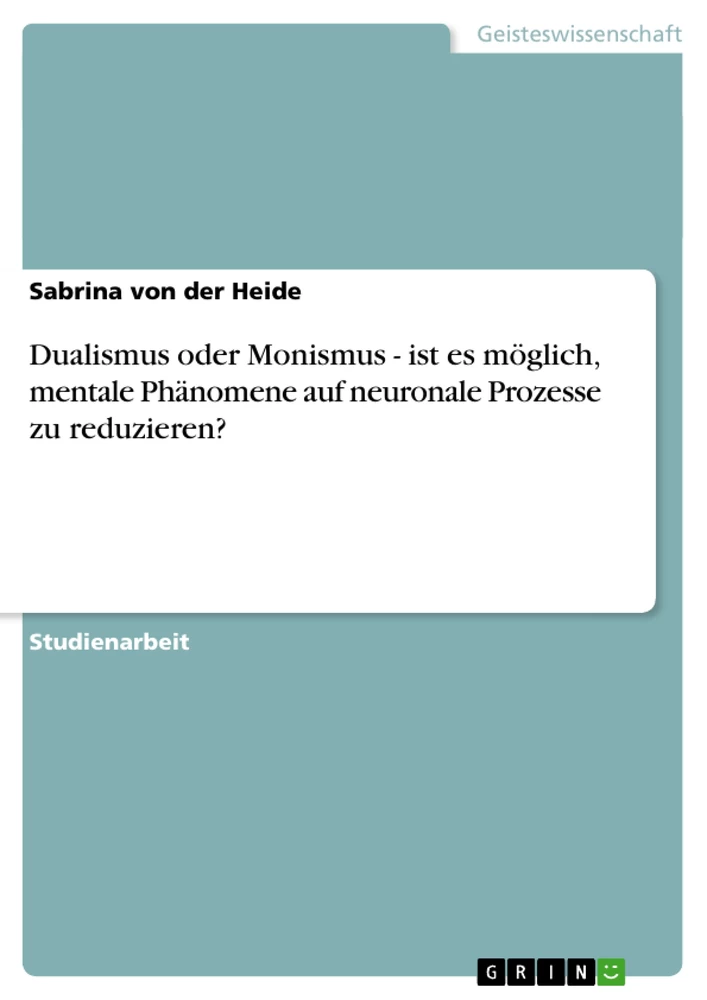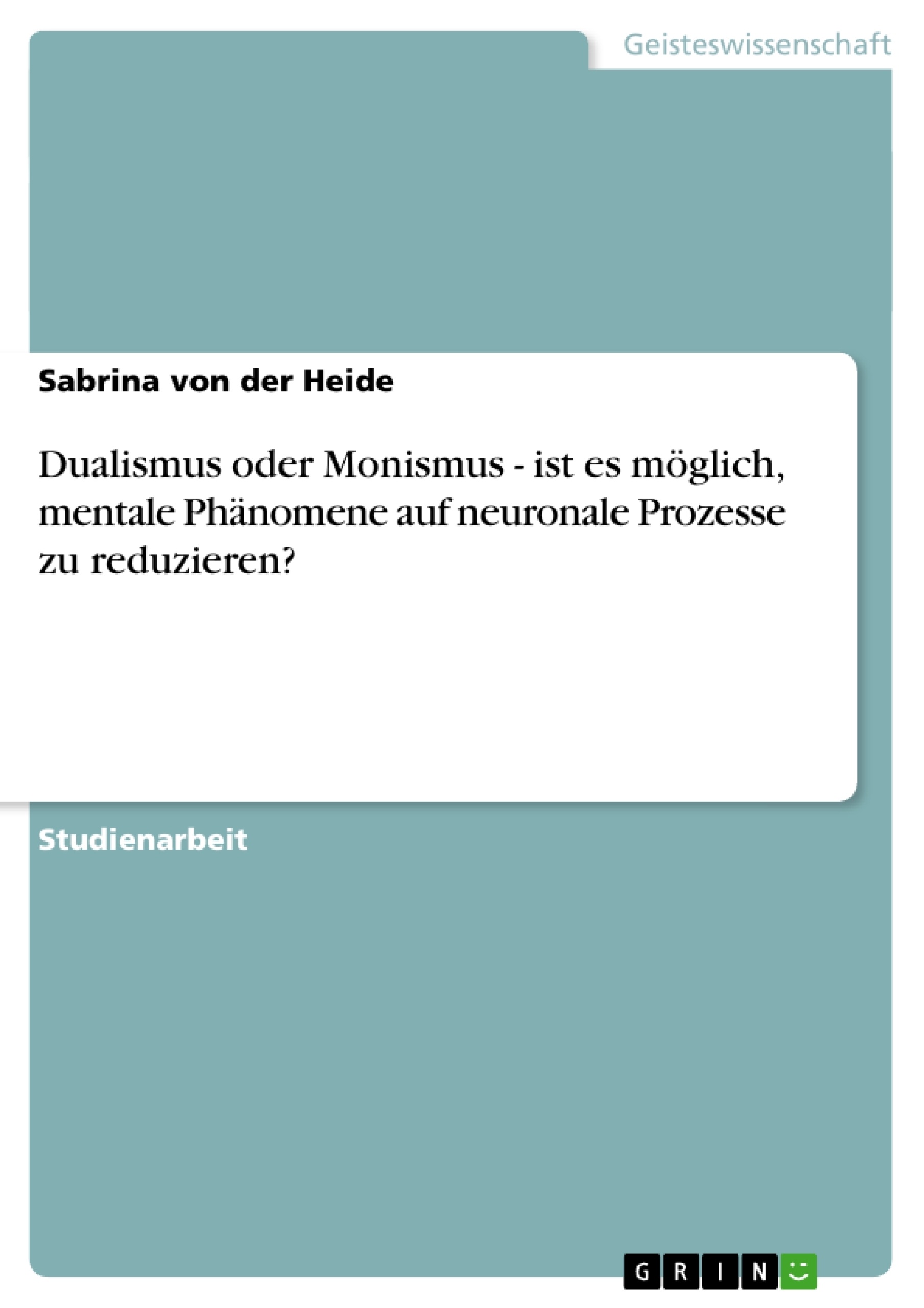Seit jeher erscheint das Bewusstsein als etwas Mystisches, nicht Fassbares. Es mag nicht einfach sein, etwas nicht Greifbares für den Verstand greifbar darzustellen. Bewusstsein wird von den meisten Menschen immer noch getrennt vom Gehirn betrachtet und als immateriell bezeichnet, so dass in diesem Zusammenhang auch häufig der Begriff der Seele fällt. Philosophisch bzw. wissenschaftlich betrachtet, ist die Entwicklung zur Erklärung des Bewusstseins mittlerweile jedoch so weit vorangeschritten, dass es zu Zeiten der modernen Hirnforschung und der rasanten Entwicklung in Bereichen wie Neurophilosophie und –psychologie logisch sein sollte, zu denken, dass das Bewusstsein mehr ist als die Gedanken in unserem Kopf; dass es an Neuronen und an die graue Masse unter der Schädeldecke gebunden sein muss und nicht ohne diese zur Existenz gelangen könnte und auch nicht ohne diese weiterexistieren kann.
Die Bedingung zur Existenz des Bewusstseins besteht darin, dass es an das Gehirn gebunden ist und dass wir ein Körperbewusstsein besitzen, das phänomenales bzw. mentales Erleben erst ermöglicht. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Geist und Gehirn
- 2.1 Psychophysischer Parallelismus
- 2.2 Interaktionistischer Dualismus
- 2.3 Eigenschaftsdualismus
- 2.4 Erklärungslückenargument
- 2.5 Epiphänomenalismus
- 3. Monistische Theorien
- 3.1 Cartesianischer Materialismus
- 3.2 Eliminativer Materialismus
- 3.3 Identitätstheorie
- 4. Phänomenales Bewusstsein
- 5. Fazit
- 6. Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Reduzierbarkeit phänomenalen Erlebens auf neurologische Prozesse. Es wird der Frage nachgegangen, ob dualistische oder monistische Theorien die Beziehung zwischen Gehirn und Bewusstsein besser beschreiben. Die Arbeit beleuchtet die Schwierigkeit, das immaterielle Bewusstsein mit dem materiellen Gehirn in Einklang zu bringen.
- Dualismus vs. Monismus im Kontext von Bewusstsein und Gehirn
- Verschiedene dualistische Positionen (z.B. Parallelismus, Interaktionismus)
- Untersuchung monistischer Ansätze (z.B. Eliminativer Materialismus, Identitätstheorie)
- Das Konzept des phänomenalen Bewusstseins
- Die These der Gehirnabhängigkeit des Bewusstseins
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die zentrale Forschungsfrage ein: die Reduzierbarkeit mentaler Bewusstseinszustände auf neuronale Prozesse. Sie betont die historische Schwierigkeit, das Bewusstsein zu erklären und verweist auf den Fortschritt in der Hirnforschung, Neurophilosophie und -psychologie, der eine engere Verbindung zwischen Bewusstsein und Gehirn nahelegt. Die Arbeit kündigt die Darstellung verschiedener dualistischer und monistischer Positionen an, um die Forschungsfrage zu beleuchten.
2. Geist und Gehirn: Dieses Kapitel diskutiert verschiedene dualistische Positionen. Es beleuchtet den traditionellen Dualismus, der Geist und Gehirn als separate Substanzen ansieht, unter Bezugnahme auf Descartes und die platonisch-christliche Tradition. Weiterhin werden der Psychophysische Parallelismus und der Okkasionalismus erläutert, wobei die Grenzen und die metaphysischen Voraussetzungen dieser Theorien hervorgehoben werden. Das Kapitel legt den Grundstein für die anschließende Auseinandersetzung mit monistischen Theorien.
3. Monistische Theorien: Dieses Kapitel präsentiert verschiedene monistische Ansätze zur Erklärung des Bewusstseins. Es beschreibt den Cartesianischen Materialismus, den Eliminativen Materialismus und die Identitätstheorie. Jeder Ansatz wird im Detail erläutert und seine Stärken und Schwächen im Hinblick auf die Erklärung des Verhältnisses zwischen Geist und Gehirn werden abgewogen. Diese Darstellung kontrastiert mit den im vorherigen Kapitel diskutierten dualistischen Positionen.
4. Phänomenales Bewusstsein: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Konzept des phänomenalen Bewusstseins, einem zentralen Aspekt der Debatte um Geist und Gehirn. Es analysiert die Eigenschaften und die Bedeutung des phänomenalen Bewusstseins im Zusammenhang mit der Reduzierbarkeit auf neuronale Prozesse. Die Diskussion dieses Kapitels wird essentiell sein für das abschliessende Fazit.
Schlüsselwörter
Bewusstsein, Gehirn, Dualismus, Monismus, Reduktionismus, Phänomenales Bewusstsein, Psychophysischer Parallelismus, Eliminativer Materialismus, Identitätstheorie, Neurophilosophie, Neuropsychologie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Geist und Gehirn - Eine Untersuchung dualistischer und monistischer Theorien
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Beziehung zwischen Geist und Gehirn, insbesondere die Frage, ob und wie phänomenales Erleben auf neurologische Prozesse reduziert werden kann. Sie vergleicht und kontrastiert dabei dualistische und monistische Theorien.
Welche Theorien werden behandelt?
Die Arbeit behandelt verschiedene dualistische Positionen wie den psychophysischen Parallelismus, den interaktionistischen Dualismus und den Epiphänomenalismus. Auf der monistischen Seite werden der Cartesianische Materialismus, der eliminative Materialismus und die Identitätstheorie diskutiert.
Was ist der Unterschied zwischen Dualismus und Monismus?
Der Dualismus sieht Geist und Gehirn als zwei separate Substanzen an, während der Monismus davon ausgeht, dass nur eine Substanz existiert (entweder materiell oder mental, je nach Ausprägung des Monismus). Die Arbeit untersucht, welche Position die Beziehung zwischen Gehirn und Bewusstsein besser erklärt.
Welche Bedeutung hat das phänomenale Bewusstsein?
Das phänomenale Bewusstsein, also die subjektive, qualitative Erfahrung, steht im Zentrum der Debatte. Die Arbeit analysiert dessen Eigenschaften und Bedeutung im Kontext der Reduzierbarkeit auf neuronale Prozesse.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu dualistischen Theorien (Geist und Gehirn), ein Kapitel zu monistischen Theorien, ein Kapitel zum phänomenalen Bewusstsein, ein Fazit und ein Literaturverzeichnis. Jedes Kapitel behandelt spezifische Aspekte der Geist-Gehirn-Problematik.
Welche Schlüsselkonzepte werden behandelt?
Schlüsselkonzepte sind Bewusstsein, Gehirn, Dualismus, Monismus, Reduktionismus, Phänomenales Bewusstsein, Psychophysischer Parallelismus, Eliminativer Materialismus, Identitätstheorie, Neurophilosophie und Neuropsychologie.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Reduzierbarkeit mentaler Bewusstseinszustände auf neuronale Prozesse zu untersuchen und die Vor- und Nachteile dualistischer und monistischer Theorien in diesem Zusammenhang zu beleuchten.
Welche Zusammenfassung der Kapitel wird angeboten?
Die Arbeit bietet zusammenfassende Übersichten zu jedem Kapitel, welche die zentralen Argumente und Erkenntnisse jedes Abschnitts hervorheben. Dies erleichtert das Verständnis der komplexen Thematik.
- Quote paper
- Sabrina von der Heide (Author), 2005, Dualismus oder Monismus - ist es möglich, mentale Phänomene auf neuronale Prozesse zu reduzieren?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/37997