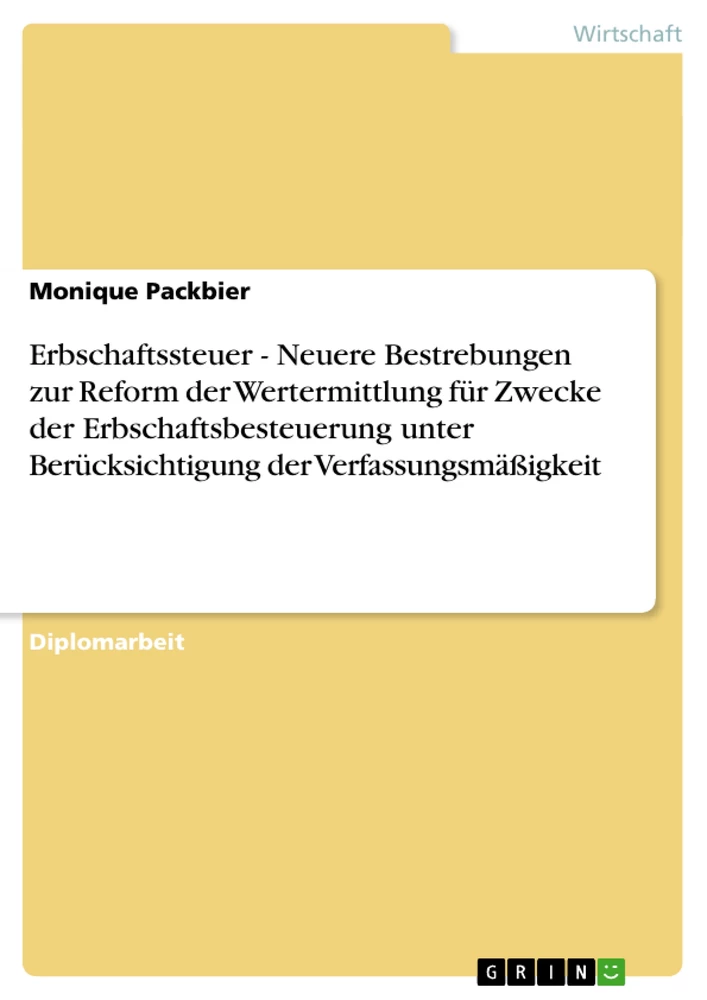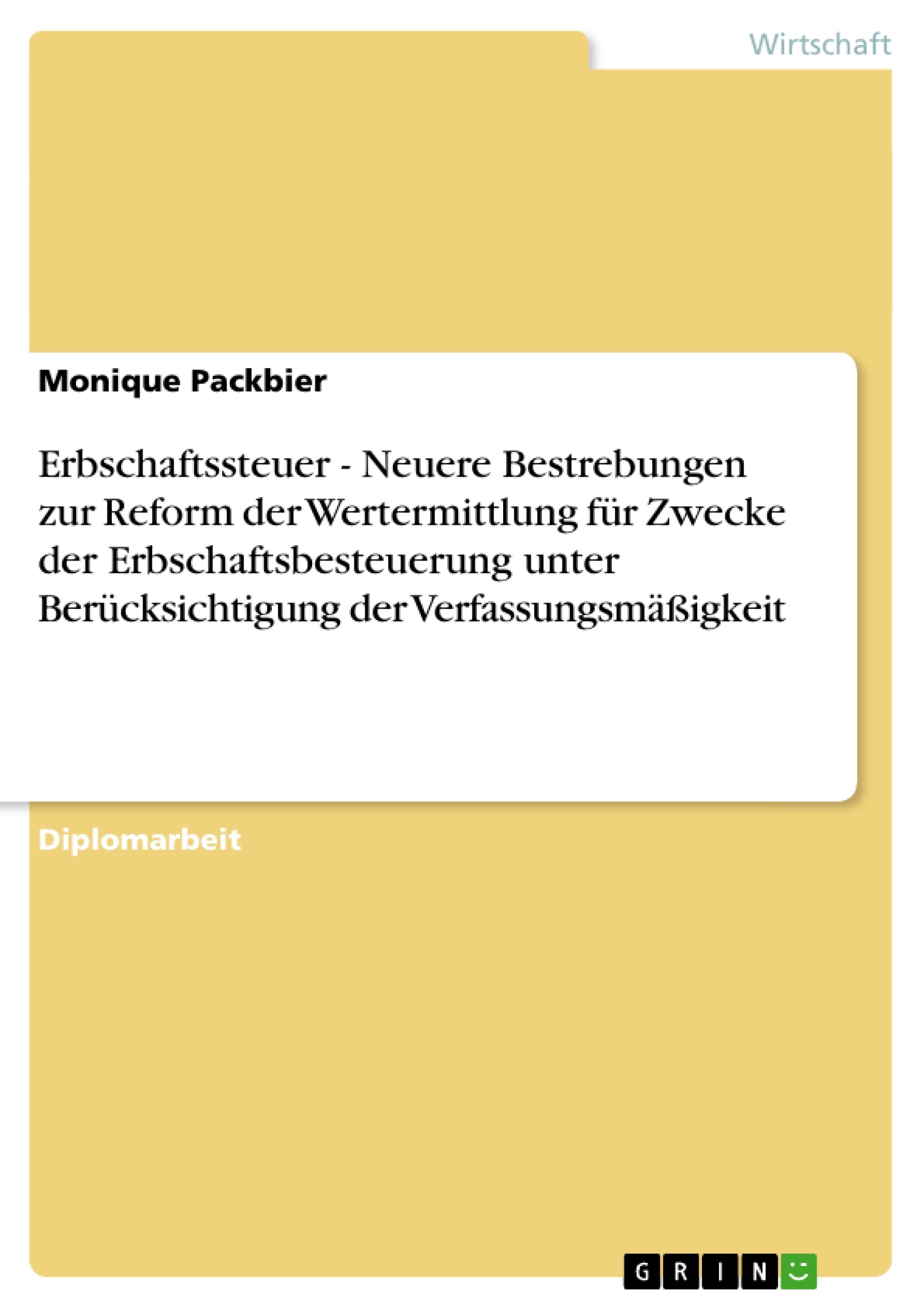[...] Der erste, Kap. 2 und 3, befasst sich mit der bis Ende 1995 maßgebenden Wertermittlung und den, durch den BVerfG-Beschluss vom 22.06.1995 herausgearbeiteten, verfassungsrechtlichen Bedenken. Hierdurch zum Handeln gezwungen, verabschiedete der Gesetzgeber das Jahressteuergesetz 1997. Daher wird im zweiten Abschnitt, Kap. 4 und 5, die mit diesem Gesetz einhergehende aktuelle Wertermittlung erläutert und sodann untersucht, ob die verfassungswidrigen Feststellungen seitens des BVerfG ausgeräumt wurden. Ferner wird in diesem Abschnitt auf diverse Beschlüsse des BFH eingegangen, in denen dieser erneut verfassungsrechtliche Zweifel an der durch das JStG 1997 normierten Wertermittlung äußert. Durch die Beschlüsse des BFH einerseits bzw. durch die i.R.d. Wertermittlung anstehenden Neubewertungen 2006 andererseits, ist der Gesetzgeber erneut zum Handeln gezwungen. So wird letztlich im dritten Abschnitt, Kap. 6 und 7, die zukünftige Wertermittlung beschrieben und analysiert, die auf einem aktuellen Gesetzesentwurf Schleswig-Holsteins zur Reform der Erbschaftsbesteuerung basiert. Aufgrund des limitierten Rahmens kann hier nur auf wesentliche Punkte eingegangen werden. Keine nähere Berücksichtigung finden, weil im Zusammenhang mit der Verfassungsmäßigkeit unrelevant, daher die §§10 und 11 ErbStG. Auch auf die Wertermittlung bzgl. des Erbbaurechts, bzgl. der Gebäude auf fremdem Grund und Boden bzw. der Gebäude im Zustand der Bebauung wird nicht näher eingegangen. Gleichfalls nicht erörtert wird die Problematik der Bewertung im Zusammenhang mit den Vermögensgegenstände in den neuen Bundesländern. Außer Acht gelassen werden auch Kriterien in Bezug auf den Grundbesitz, die sich aufgrund besonderer baulicher Ausgestaltungen oder aufgrund spezieller landwirtschaftlicher Nutzungen ergeben. Anzumerken ist ferner, dass Änderungen, wie sie durch das Steuerentlastungsgesetz 1999/2000/ 2002 bzw. durch das Steueränderungsgesetz 2001 entstanden, im Hinblick auf die Wertermittlung und die damit zusammenhängende Verfassungsmäßigkeit unerheblich sind und demzufolge einbezogen wurden. Hingegen werden die Anpassungen an den Euro – normiert durch das Euroglättungsgesetz 2000 - ab Kapitel 4 mit eingearbeitet, um spätere Vergleiche mit dem Gesetzesentwurf Schleswig-Holsteins zu erleichtern. Die nun folgenden Ausführungen sollen dazu beitragen, am Ende der Arbeit Ausblicke über die Verfassungsmäßigkeit der Wertermittlung im neusten Gesetzesentwurf Schleswig-Holsteins zu ermöglichen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Wertermittlung für Zwecke der Erbschaftsbesteuerung bis 31.12.1995
- 2.1 Die Vermögensbewertung gem. §12 ErbStG - Die Einheitsbewertung
- 2.2 Die Steuerbefreiungen gem. §13 ErbStG
- 3. Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 22.06.1995
- 3.1 Die Bedeutung des Art. 3 GG für die Bewertung von Grundbesitz
- 3.2 Die Bedeutung des Art. 3 GG für die Regelung des Betriebsvermögens
- 3.3 Die Erbrechtsgarantie nach Art. 14 GG
- 3.4 Die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts
- 4. Die durch das JStG 1997 reformierte Wertermittlung seit 01.01.1996
- 4.1 Die Vermögensbewertung gem. §12 ErbStG – Die Bedarfsbewertung
- 4.2 Die Steuerbefreiungen gem. §13 ErbStG
- 4.3 Die Begünstigungen gem. §13a ErbStG
- 5. Die Verfassungsmäßigkeit der aktuellen Wertermittlung
- 5.1 Die Wertermittlung nach §12 Abs.2 und 3 ErbStG versus Art. 3 GG
- 5.2 Die Berücksichtigung der verminderten Leistungsfähigkeit
- 5.3 Die Vermeidung der Betriebsgefährdung
- 5.4 Die Beschlüsse des Bundesfinanzhofs
- 6. Der Gesetzentwurf Schleswig-Holsteins zur Reform der Erbschaftsbesteuerung
- 6.1 Die Vermögensbewertung gem. §12 ErbStG
- 6.2 Die Steuerbefreiungen gem. §13 ErbStG
- 6.3 Die Begünstigungen gem. §13a ErbStG
- 7. Die Verfassungsmäßigkeit auf erneutem Prüfstand
- 7.1 Die Änderungen im neuen Gesetzesentwurf
- 7.2 Die Verfassungsmäßigkeit hinsichtlich der Wertermittlungen
- 7.3 Die Verfassungsmäßigkeit hinsichtlich des Betriebsvermögens
- 8. Das Ende der bestehenden Divergenzen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit analysiert die jüngsten Bemühungen um eine Reform der Bewertung von Vermögenswerten im Erbschaftsteuerrecht unter Berücksichtigung der verfassungsrechtlichen Vorgaben. Ziel ist es, die Entwicklung der Wertermittlungsmethoden aufzuzeigen und deren Verfassungsmäßigkeit zu überprüfen.
- Entwicklung der Wertermittlung im Erbschaftsteuerrecht
- Verfassungsrechtliche Anforderungen an die Wertermittlung
- Bewertung von Grundbesitz und Betriebsvermögen
- Analyse des Schleswig-Holsteinischen Gesetzentwurfs
- Zusammenführung verschiedener Bewertungsansätze
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Erbschaftsteuerbewertung ein und skizziert den Aufbau der Arbeit. Sie betont die Bedeutung der verfassungsrechtlichen Aspekte im Kontext der Wertermittlung.
2. Die Wertermittlung für Zwecke der Erbschaftsbesteuerung bis 31.12.1995: Dieses Kapitel beschreibt die vor 1996 geltende Einheitsbewertung im Erbschaftsteuerrecht. Es beleuchtet die unterschiedlichen Bewertungsmethoden für land- und forstwirtschaftliches Vermögen, Grundvermögen, Betriebsvermögen und sonstiges Vermögen, und zeigt die damit verbundenen Probleme und Ungleichheiten auf, die letztendlich zu verfassungsrechtlichen Bedenken führten.
3. Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 22.06.1995: Dieses Kapitel analysiert das Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 1995, das die damalige Wertermittlung als verfassungswidrig erklärte. Es untersucht die Kritikpunkte des Gerichts hinsichtlich des Verstoßes gegen den Gleichheitsgrundsatz (Art. 3 GG) und die Eigentumsgarantie (Art. 14 GG), insbesondere im Hinblick auf die Bewertung von Grundbesitz und Betriebsvermögen.
4. Die durch das JStG 1997 reformierte Wertermittlung seit 01.01.1996: Das Kapitel beschreibt die Reform der Wertermittlung durch das Jahressteuergesetz 1997 und die Einführung der Bedarfsbewertung. Es vergleicht die neue Methode mit dem vorherigen System und analysiert die Auswirkungen auf die Bewertung verschiedener Vermögensarten. Es befasst sich auch mit den Steuerbefreiungen und Begünstigungen nach §13 und §13a ErbStG.
5. Die Verfassungsmäßigkeit der aktuellen Wertermittlung: Dieses Kapitel untersucht die Verfassungsmäßigkeit der nach der Reform geltenden Bewertungssystematik. Es analysiert die Kritikpunkte des Bundesfinanzhofs zur Bewertung von Grundbesitz und Betriebsvermögen im Kontext des Gleichheitsgrundsatzes und der Vermeidung von Betriebsgefährdungen.
6. Der Gesetzentwurf Schleswig-Holsteins zur Reform der Erbschaftsbesteuerung: Dieses Kapitel präsentiert und analysiert einen alternativen Gesetzentwurf aus Schleswig-Holstein. Der Fokus liegt auf den vorgeschlagenen Änderungen der Vermögensbewertung und den damit verbundenen Implikationen für die Verfassungsmäßigkeit.
7. Die Verfassungsmäßigkeit auf erneutem Prüfstand: Dieses Kapitel untersucht die Verfassungsmäßigkeit des neuen Gesetzesentwurfs. Es analysiert die Auswirkungen der Änderungen auf die Bewertung und diskutiert die verbleibenden verfassungsrechtlichen Herausforderungen.
8. Das Ende der bestehenden Divergenzen: Dieses Kapitel wird in der Zusammenfassung nicht berücksichtigt, um keine Spoiler zu verraten.
Schlüsselwörter
Erbschaftsteuer, Wertermittlung, Vermögensbewertung, Grundbesitz, Betriebsvermögen, Bundesverfassungsgericht, Gleichheitsgrundsatz, Art. 3 GG, Art. 14 GG, Bedarfsbewertung, Einheitsbewertung, Jahressteuergesetz, Verfassungsmäßigkeit, Steuerbefreiungen, Gesetzentwurf Schleswig-Holstein.
Häufig gestellte Fragen zur Diplomarbeit: Reform der Erbschaftsteuerbewertung
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit analysiert die Reform der Bewertung von Vermögenswerten im deutschen Erbschaftsteuerrecht unter Berücksichtigung verfassungsrechtlicher Vorgaben. Sie untersucht die Entwicklung der Wertermittlungsmethoden und deren Verfassungsmäßigkeit.
Welche Wertermittlungsmethoden werden behandelt?
Die Arbeit vergleicht die bis 1995 geltende Einheitsbewertung mit der seit 1996 gültigen Bedarfsbewertung. Sie untersucht die damit verbundenen Änderungen und deren Auswirkungen auf die Bewertung von Grundbesitz und Betriebsvermögen.
Welche Rolle spielt das Bundesverfassungsgericht?
Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 1995, welches die damalige Einheitsbewertung als verfassungswidrig erklärte, ist ein zentraler Bestandteil der Arbeit. Die Kritikpunkte des Gerichts bezüglich des Gleichheitsgrundsatzes (Art. 3 GG) und der Eigentumsgarantie (Art. 14 GG) werden ausführlich analysiert.
Wie wird der Schleswig-Holsteinische Gesetzentwurf behandelt?
Die Arbeit analysiert einen alternativen Gesetzentwurf aus Schleswig-Holstein zur Reform der Erbschaftsbesteuerung. Der Fokus liegt auf den vorgeschlagenen Änderungen der Vermögensbewertung und deren Implikationen für die Verfassungsmäßigkeit.
Welche Vermögensarten werden besonders betrachtet?
Die Arbeit konzentriert sich insbesondere auf die Bewertung von Grundbesitz und Betriebsvermögen, da diese im Kontext der Erbschaftsteuerbewertung besondere Herausforderungen darstellen.
Welche verfassungsrechtlichen Aspekte werden untersucht?
Die Arbeit untersucht die Verfassungsmäßigkeit der verschiedenen Wertermittlungsmethoden im Hinblick auf den Gleichheitsgrundsatz (Art. 3 GG) und die Eigentumsgarantie (Art. 14 GG). Sie analysiert, ob die Methoden die Vermeidung von Betriebsgefährdungen gewährleisten und die verminderte Leistungsfähigkeit berücksichtigen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in acht Kapitel: Einleitung, Wertermittlung bis 1995, Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 1995, Reformierte Wertermittlung seit 1996, Verfassungsmäßigkeit der aktuellen Wertermittlung, Schleswig-Holsteinischer Gesetzentwurf, Erneute Prüfung der Verfassungsmäßigkeit und Schlussfolgerungen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Erbschaftsteuer, Wertermittlung, Vermögensbewertung, Grundbesitz, Betriebsvermögen, Bundesverfassungsgericht, Gleichheitsgrundsatz, Art. 3 GG, Art. 14 GG, Bedarfsbewertung, Einheitsbewertung, Jahressteuergesetz, Verfassungsmäßigkeit, Steuerbefreiungen, Gesetzentwurf Schleswig-Holstein.
Welche Ziele verfolgt die Diplomarbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Entwicklung der Wertermittlungsmethoden im Erbschaftsteuerrecht aufzuzeigen, deren Verfassungsmäßigkeit zu überprüfen und die verschiedenen Bewertungsansätze zusammenzuführen.
- Quote paper
- Monique Packbier (Author), 2005, Erbschaftssteuer - Neuere Bestrebungen zur Reform der Wertermittlung für Zwecke der Erbschaftsbesteuerung unter Berücksichtigung der Verfassungsmäßigkeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/37968